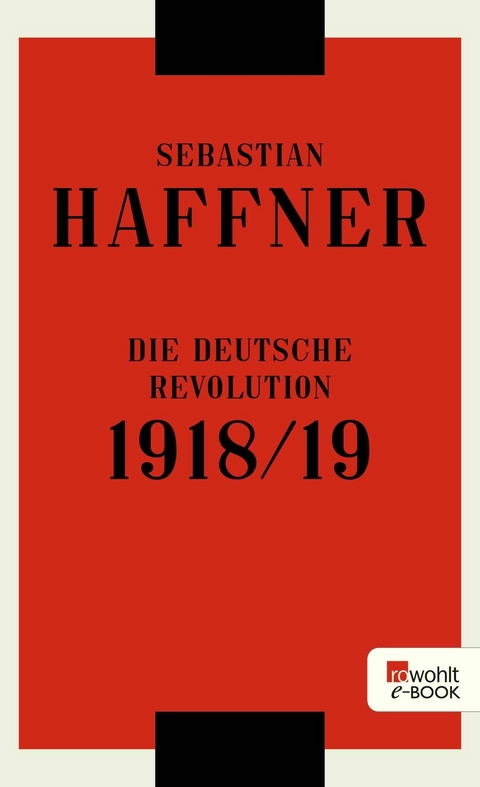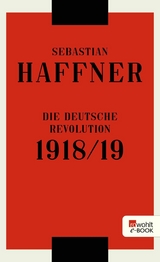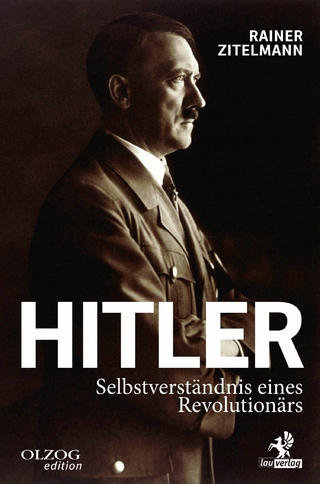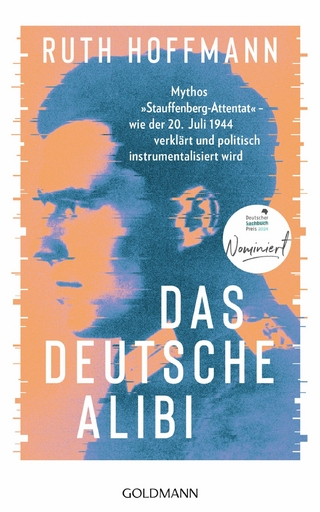Die deutsche Revolution 1918/19 (eBook)
256 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-30004-0 (ISBN)
Sebastian Haffner, geboren 1907 in Berlin, war promovierter Jurist. Er emigrierte 1938 nach England und arbeitete als freier Journalist für den «Observer». 1954 kehrte er nach Deutschland zurück, schrieb zunächst für die «Welt», später für den «Stern». Sebastian Haffner starb 1999.
Sebastian Haffner, geboren 1907 in Berlin, war promovierter Jurist. Er emigrierte 1938 nach England und arbeitete als freier Journalist für den «Observer». 1954 kehrte er nach Deutschland zurück, schrieb zunächst für die «Welt», später für den «Stern». Sebastian Haffner starb 1999.
1 Kaiserreich und Sozialdemokratie
Das Deutsche Reich und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands sind nicht nur gleichzeitig entstanden, sie haben dieselbe Wurzel: die gescheiterte bürgerliche Revolution von 1848. Diese Revolution hatte zwei Ziele gehabt, nationale Einigung nach außen und demokratische Neugestaltung im Innern. Beides war fällig. Kleinstaaterei und Feudalismus, immer noch die Grundlagen des vormärzlichen Deutschland, waren im beginnenden Industriezeitalter liquidationsreif.
Aber die bürgerliche Revolution scheiterte, und das deutsche Bürgertum fand sich mit ihrem Scheitern ab. Was seine Aufgabe gewesen wäre, übernahmen andere. Die nationale Einigung – die Einebnung überholter Staatsgrenzen – besorgte statt seiner Bismarck, an der Spitze der preußischen Junkerklasse und mit Hilfe der preußischen Armee. Die innere Modernisierung – die Einebnung überholter Standesgrenzen – nahm der vierte Stand als unerledigte Aufgabe aus den schwach gewordenen Händen des dritten. Bismarck und die beginnende deutsche Arbeiterbewegung hielten in den sechziger Jahren je ein Ende des 1849 abgerissenen Fadens in der Hand. Hätten sie zusammengestanden, so hätte in den Jahren um 1870 das 1848 Verfehlte nachgeholt werden und ein moderner, gesunder, langlebiger deutscher Nationalstaat entstehen können. Aber sie standen nicht zusammen, sie standen gegeneinander, und das konnte wohl auch nicht anders sein – trotz des kurzen, faszinierenden, aber unfruchtbaren Flirts zwischen Bismarck und Lassalle.
Das Ergebnis war ein Deutsches Reich, das, mächtig und gefürchtet nach außen, seinem inneren Zustand nach einer schief zugeknöpften Weste glich. Dass es als Nationalstaat etwas Ungenaues, Ungefähres darstellte – es schloss bekanntlich viele Deutsche aus, viele Nichtdeutsche ein –, war vielleicht unvermeidlich und mochte hingehen. Auch das merkwürdig Verbaute, etwas Unwahrhaftige der Bismarck’schen Verfassung – der ungelöste Dualismus zwischen Reich und Preußen, die Scheinmacht der Bundesfürsten und des Bundesrats, die unklar geteilte Allmacht von Kaiser und Reichskanzler, die institutionalisierte Ohnmacht des Reichstags, die unintegrierte Armee – war nicht das Grundübel dieses Staats; Verfassungen lassen sich ändern. Was Bismarcks Reich, bei allem Glanz der Waffensiege, «von Anfang an todkrank» machte (so der Historiker Arthur Rosenberg in seinem Werk Entstehung der Weimarer Republik), war eine falsche, überholte, geschichtswidrige Machtverteilung zwischen seinen Klassen.
Der Staat stand unter falschem Management. Die wirtschaftlich absinkenden, langsam parasitär werdenden preußischen Junker, die nicht wussten, wie ihnen geschah, hatten plötzlich einen modernen Industriestaat zu führen. Das kapitalistische Bürgertum, seit 1849 an Verantwortungslosigkeit gewöhnt und durch Verantwortungslosigkeit verwöhnt, suchte draußen die Macht, die ihm drinnen verwehrt war, und drängte auf außenpolitische Abenteuer. Und die sozialdemokratischen Arbeiter, objektiv die stärkste Reserve der Nation, die willigen Erben der Verantwortung, auf die das Bürgertum verzichtet hatte, waren «Reichsfeinde».
Waren sie es wirklich? Sie waren gefürchtet, verfemt, verhasst und in den letzten zwölf Jahren der Bismarck-Zeit, von 1878 bis 1890, verfolgt. Ohne Zweifel waren sie – damals – unversöhnliche Gegner der Staats- und Gesellschaftsordnung, die Bismarck seinem Reich gegeben hatte. Ohne Zweifel proklamierten sie die politische und soziale Revolution, über die sie freilich – schon damals – keine klaren Vorstellungen hatten, von konkreten Plänen ganz zu schweigen. Ohne Zweifel hatten sie, ebenso wie die anderen «Reichsfeinde», die katholischen Zentrumswähler, Bindungen und Loyalitäten über die Reichsgrenzen hinaus; was für jene die katholische Weltkirche war, war für sie die Sozialistische Internationale.
Und trotzdem waren die einen so wenig Reichsfeinde wie die anderen. Im Gegenteil: Sozialdemokratie und Zentrum waren von Anfang an die eigentlichen Reichsparteien: im Reich, mit dem Reich und durch das Reich entstanden und gewachsen; tiefer in ihm verwurzelt als seine preußischen Gründer. Weder Sozialdemokraten noch Zentrum dachten im Traum daran, das Deutsche Reich, das ihr Lebenselement war, aufzulösen oder seine Auflösung zu wünschen. Sie fühlten sich vielmehr – die Sozialdemokraten noch mehr als das Zentrum – von Anfang an als Anwärter auf sein Erbe. Es ist nur leicht übertrieben, wenn Arthur Rosenberg schreibt: «So war der sozialdemokratische Parteivorstand die heimliche Gegenregierung und August Bebel auf der Höhe seines Einflusses eine Art von Gegenkaiser.»
Die Sozialdemokraten des Bismarck-Reiches waren revolutionäre Patrioten. Sie wollten inneren Umsturz und Umbau – keineswegs wollten sie äußere Ohnmacht und Auflösung. Sie wollten aus Bismarcks Reich ihr Reich machen – nicht um es zu schwächen oder gar abzuschaffen, sondern um es auf die Höhe der Zeit zu bringen. Freilich ist eine solche Haltung, theoretisch klar genug, in der Praxis nicht ohne Widersprüchlichkeiten. Es liegt ein gewisser Widerspruch in den beiden berühmtesten Aussprüchen des langjährigen Parteiführers August Bebel: «Diesem System keinen Mann und keinen Groschen!» und «Wenn es gegen Rußland geht, werde ich selbst die Flinte nehmen!» Aber es ist nicht dieser Widerspruch, an dem die Sozialdemokraten 1918 gescheitert sind, sondern ein anderer.
Die deutsche soziale Revolution, die sie bis zum letzten Augenblick versprachen und anfangs auch wirklich erhofften und erstrebten, war für sie immer eine Sache des Morgen oder Übermorgen, niemals die Forderung des Tages. Nie hat sich ein deutscher Sozialdemokrat wie Lenin die Frage gestellt: «Was tun?» Die Revolution, sagte man sich, würde irgendwann «kommen»; sie war nicht etwas, das man selber hier und heute machen musste. Es genügte, sie abzuwarten; und inzwischen lebte man im Kaiserreich so, wie es nun einmal war, als Anhänger einer seiner Parteien, erfreut darüber, von Reichstagswahl zu Reichstagswahl stärker zu werden. Aber eine revolutionäre Partei, die sich begnügt, auf die Revolution zu warten, hört allmählich auf, eine revolutionäre Partei zu sein. Die wirkliche Gegenwart ist stärker als die nur erhoffte und erwartete Zukunft, besonders dann, wenn das Erhoffte und Erwartete in eine immer fernere Zukunft zurückweicht und die Gegenwart sich als immer erträglicher erweist.
Beides war der Fall. Im Jahre 1891 sagte August Bebel auf dem Parteitag der SPD: «Die bürgerliche Gesellschaft arbeitet so kräftig auf ihren eigenen Untergang los, daß wir nur den Moment abzuwarten brauchen, in dem wir die ihren Händen entfallende Gewalt aufzunehmen haben … ja, ich bin überzeugt, die Verwirklichung unserer letzten Ziele ist so nahe, daß wenige in diesem Saale sind, die diese Tage nicht erleben werden.» Zwanzig Jahre später nannte er die Revolution nur noch «den großen Kladderadatsch» – ein vielsagendes Wort; ein großer Kladderadatsch ist nicht gerade etwas heiß Ersehntes. Wieder rief er seinen bürgerlichen Gegnern zu (diesmal im Reichstag): «Er [der ‹Kladderadatsch›] kommt nicht durch uns, er kommt durch Sie selber.» Aber davon, dass der Tag der Revolution unmittelbar bevorstehe, war nicht mehr die Rede, sondern: «Er kommt; er ist nur vertagt.» Diesmal waren wirklich nur wenige im Saale, die ihn nicht erleben sollten: Sieben Jahre später war es soweit. Aber die SPD hatte innerlich aufgehört, das, was sie jetzt den «großen Kladderadatsch» nannte, noch wirklich zu wollen.
Es ist merkwürdig, wie genau die Schicksalsdaten der deutschen Reichsgeschichte mit denen der sozialdemokratischen Parteigeschichte zusammenfallen. Die achtundvierzig Jahre des Kaiserreichs umfassen drei deutlich getrennte Perioden: die zwanzig Jahre Bismarcks bis 1890; die Wilhelminische Periode von 1890 bis 1914 und die vier Kriegsjahre von 1914 bis 1918. Genau dies sind auch die Perioden der sozialdemokratischen Parteigeschichte. In der Bismarck‑Zeit war sie, wenigstens in ihrer Selbsteinschätzung, die Partei der roten Revolution. Zwischen 1890 und 1914 war sie nur noch in Worten revolutionär; heimlich hatte sie begonnen, sich als ein Bestandteil des wilhelminischen Deutschland zu fühlen. Von 1914 an wurde diese Wandlung offenbar.
Auf die Frage, was die Wandlung bewirkt hatte, muss man zunächst das Aufhören der Verfolgung nennen. Bismarck hatte in seinen letzten Amtswochen die Sozialistengesetze noch verschärfen wollen, bis zur Herausforderung des offenen Bürgerkriegs. Wilhelm II. ließ sie fallen. Die sozialdemokratischen Führer und Funktionäre, die zwölf Jahre lang Geächtete und Gejagte gewesen waren, konnten fortan das ungefährdete, angenehme und interessante Leben parlamentarischer Honoratioren führen. Sie hätten mehr als menschlich sein müssen, um die Erleichterung nicht mit einer gewissen Dankbarkeit zu empfinden.
Aber das war nicht alles. Die ganze innenpolitische Atmosphäre des wilhelminischen Deutschland war anders als die des Bismarck’schen – entspannter, gelöster, weniger hart und streng. Das Deutschland der Jahrhundertwende war ein glücklicheres Land als das der achtziger Jahre. In Bismarcks Deutschland hatte Stickluft geherrscht. Wilhelm II. hatte Fenster aufgerissen und Luft hereingelassen; die große, dankbare Popularität, die er in seinen Anfangsjahren genoss, kam nicht von ungefähr. Freilich, die wohltuende innere Entspannung wurde erzielt durch die Ablenkung gestauter Energien und...
| Erscheint lt. Verlag | 24.7.2018 |
|---|---|
| Zusatzinfo | Zahlr. s/w Abb. |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |
| Schlagworte | 20. Jahrhundert Geschichte • Auswirkungen des Weltkriegs • Berlin • Bolschewismus • Deutsche Geschichte • Deutsche Revolution • Erster Weltkrieg • Europäische Geschichte • Friedrich Ebert • Geschichte Deutschland • historische Analyse • Historisches Sachbuch • Novemberrevolution • Politische Bildung • politische Bücher • Politische Geschichte • Revolution • Revolutionsgeschichte • Revolution von 1918/19 • Sozialdemokratie • SPD • Weimarer Republik • Weltkrieg Nachkriegszeit • Zeitgenössische Geschichte |
| ISBN-10 | 3-644-30004-6 / 3644300046 |
| ISBN-13 | 978-3-644-30004-0 / 9783644300040 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 12,2 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich