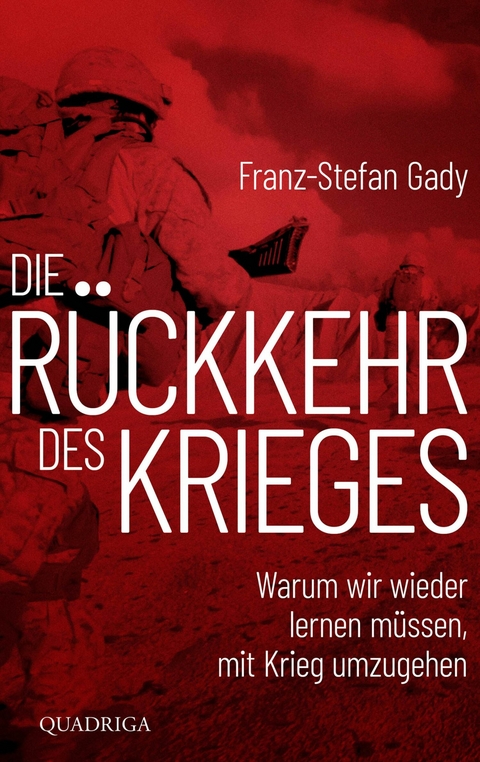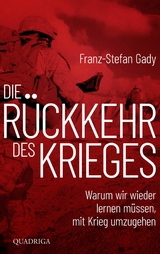Die Rückkehr des Krieges (eBook)
Quadriga (Verlag)
978-3-7517-6020-1 (ISBN)
Franz-Stefan Gady ist unabhängiger Analyst und Militärberater. Darüber hinaus ist er Senior Fellow am Institute for International Studies in London und Adjunct Senior Fellow am Center for New American Security in Washington DC. Er berät Regierungen und Streitkräfte in Europa und den Vereinigten Staaten in Fragen der Strukturreform und der Zukunft der Kriegsführung. Feldforschungen und Beratungstätigkeiten führten ihn mehrmals in die Ukraine, nach Afghanistan und in den Irak, wo er die ukrainischen Streitkräfte, die afghanische Armee, sowie NATO-Truppen und kurdische Milizen bei verschiedenen Einsätzen begleitete. Er ist auch Reserveoffizier.
»Ein Buch für alle, die sich sachlich und unaufgeregt mit einem schweren Thema befassen möchten. Gady gelingt die seltene Kunst, zu erklären und gleichzeitig kurzweilig zu sein.« – Dr. Florence Gaub, Forschungsdirektorin der NATO-Verteidigungsakademie
»Wer wissen will, warum es zum Krieg kommt, wie er geführt wird und was er mit den Beteiligten macht, der kommt an diesem exzellent geschriebenen Buch von einem der führenden europäischen Militäranalysten und Militärhistorikern nicht vorbei. Ein Standardwerk.« – Prof. Dr. Carlo Masala
Erster Teil
Warum der Krieg wieder zurück ist
Kapitel 1.
Fehleinschätzungen als Kriegsgrund
Kriege sind oft das Resultat von Fehleinschätzungen der politischen und militärischen Führung. Die Geschichte kennt unzählige Beispiele dafür, dass die Kampfkraft der eigenen Armee überschätzt und/oder der Widerstandswille des Gegners unterschätzt wurde: von den antiken Persern, die 490 v. Chr. bei Marathon von den Athenern geschlagen wurden, bis hin zu dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem im Februar 2022 losgetretenen Angriffskrieg gegen die Ukraine.
Ein Hauptgrund für diese und viele weitere Fehleinschätzungen ist schlicht die enorme Komplexität von Krieg. Sie macht es – zumal in Friedenszeiten – schwer bis unmöglich, verlässlich vorherzusagen, wie lange eine militärische Auseinandersetzung dauern, auf welche Weise und mit welcher Intensität sie geführt und wie sie am Ende ausgehen wird. Der britische Militärhistoriker Michael Howard sprach deshalb einmal von einem »Nebel des Friedens«, der eine klare Sicht auf Krieg verhindere und Prognosen über zukünftige Kriegsführung erschwere.2
Im Grunde kann man sagen: Es lässt sich im Frieden nahezu unmöglich sagen, wie sich eine Armee oder ein Staat als Ganzes im Falle eines Krieges wirklich verhalten würde. Es ist, als würde man über die relativen Stärken und Schwächen einer Fußballmannschaft urteilen, die man über Jahre oder gar Jahrzehnte immer nur im Trainingscamp beobachten konnte und nie in einem echten Spiel gegen ein anderes Team. Analog dazu kann nur der reale Kampf irgendwelche konkreten Rückschlüsse auf die Qualität der eigenen Truppe liefern. Eine allzu lange Pause zwischen solchen realen »Auseinandersetzungen« wirkt sich insofern natürlich negativ auf die Einsatzbereitschaft der Truppe aus. Genau das dürfte einer meiner militärischen Ausbilder in Österreich, der unter dem Spitznamen »Ranger Gustl« in der gesamten Armee bekannt war, gemeint haben, als er nach einer Nahkampfausbildung trocken kommentierte: »Fünfzig Jahre Frieden machen eine jede Armee kaputt!«
Militärische und politische Entscheidungsträger versuchen zwar regelmäßig, sich auf der Basis von Militärübungen und jeder Menge Datenanalysen ein Bild zu machen. Doch jeder Fußballkenner weiß: Ein Trainingsspiel bleibt immer nur ein Trainingsspiel. Wenn es wirklich einmal darauf ankommt, sind viele Prognosen und Annahmen Makulatur, denn die Realität erweist sich stets als komplexer und dynamischer. Und das Gleiche gilt in der Kriegsführung. Keine Militärübung kommt annähernd an die Realität eines militärischen Ernstfalls heran. Oft stellt sich auch erst nach Ausbruch eines Krieges heraus, wie die Bevölkerungen und Armeen des eigenen Landes und des Gegners, aber auch wie etwaige Verbündete und andere Länder auf diese Extremsituation reagieren. Weder der Widerstandswille eines Gegners noch die Motivation der eigenen Truppe lassen sich vorab messen. Ebenso wenig lässt sich vorhersagen, wie Menschen reagieren, wenn sie plötzlich im Kugelhagel oder unter Artilleriebeschuss stehen. Nicht selten bricht dann Panik aus. So erzählten mir mehrere ukrainische Soldaten, viele ausländische Freiwillige hätten im März 2022 gleich bei der ersten Explosion russischer Artillerie Reißaus genommen. Als jemand, der 2023 das Pech hatte, einen russischen Artillerieangriff mit schwerer 152mm-Munition mitzuerleben, kann ich das nur zu gut verstehen.
Als Faustregel gilt letztlich: Wie gut die eigene Truppe für den Krieg trainiert ist und ob sie über die richtige Ausrüstung verfügt, um ihre Ziele zu erreichen, zeigt sich immer erst nach dem ersten Schuss. Fast schlimmer noch als diese allgemeine Ungewissheit über die eigene Truppe in Friedenszeiten ist häufig allerdings die Unfähigkeit, sich in den Gegner hineinzuversetzen, um dessen Handeln zu verstehen. Dabei heißt es schon bei dem chinesischen Militärstrategen und Philosophen Sunzi (ca. 544 bis ca. 496 v. Chr.): »Wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von hundert Schlachten nicht zu fürchten.« Umgekehrt bedeutet das aber auch: Wenn du weder dich selbst noch den Gegner gut kennst, erhöht sich das Risiko von Fehlkalkulationen.
Leider begünstigt gerade die heutige Zeit politische und militärische Fehleinschätzungen, was Kriege und Kriegsführung betrifft. Das hat mehrere Gründe. Erstens ist unter politischen und militärischen Entscheidungsträgern ein gewisses Grundverständnis dafür abhandengekommen, warum es überhaupt zu Kriegen kommt. Zweitens wecken immer komplexere Technologien die Illusion, Kriege ließen sich schnell, mit geradezu »chirurgischer« Präzision und damit weitgehend unblutig führen und gewinnen. Diese Illusion verleitet wiederum dazu, militärische Abenteuer einzugehen. Drittens befinden wir uns strukturell in einem allmählichen Wandel der globalen Ordnung – von einem System, das von der Ordnungsmacht USA dominiert ist, hin zu einem System, in dem die amerikanische Militärmacht nicht mehr die gleiche abschreckende Wirkung wie früher besitzt, da in den USA selbst kein innenpolitischer Konsens mehr über die eigene globale Rolle besteht. Damit dürfte auch die Gefahr von militärischen Fehleinschätzungen aufseiten der Rivalen der USA wachsen – mit potenziell fatalen Konsequenzen.
Die Summe all dieser Faktoren erhöht nicht nur das Risiko, dass neue Kriege tatsächlich ausbrechen werden, sondern auch das Risiko, dass sowohl die Streitkräfte als auch die Gesellschaften der westlichen Staaten insgesamt die Art und Weise, wie Kriege künftig geführt werden, falsch einschätzen.
Kurz ein Wort zur Struktur der folgenden Kapitel im Teil 1. Ich liste auf den folgenden Seiten auf drei unterschiedlichen Ebenen Faktoren auf, die politische und militärische Fehleinschätzungen in Bezug auf Kriege und Kriegsführung wahrscheinlicher machen. Diese Fehleinschätzungen wiederum erhöhen das Risiko auf künftige militärische Konflikte.
Die wichtigste Ebene hierbei ist die individuelle Ebene, denn letztendlich wird die Entscheidung zum Krieg von Individuen, politischen Entscheidungsträgern, bewusst getroffen. Die Hauptgründe, warum sich Individuen zum Krieg entschließen und warum Kriege falsch eingeschätzt werden, wird in Kapitel 1 diskutiert. Die technologische Ebene, die in Kapitel 2 behandelt wird, will vor allem zeigen, welchen Einfluss Technologie auf Entscheidungen von politischen Entscheidungsträgern hat. Wir klammern uns im »Westen« gern an eine Art technologischen Lösungsglauben, der uns dazu verleitet, zu glauben, wir könnten Kriege, die wir anfangen, mithilfe neuer Technologien schneller und unblutiger beenden, während Technologie andererseits die Gefahr verringert, von Krieg überrascht zu werden. Beide Annahmen erweisen sich als große Irrtümer.
Im dritten Kapitel führe ich dann die Diskussion auf globaler Ebene weiter. Das globale System, gern auch wertebasierte Weltordnung genannt, wird nach wie vor von den USA, der führenden Militärmacht und gleichzeitig Europas Schutzmacht, dominiert. Wegen dieser Vormachtstellung haben Entscheidungen über Krieg und Frieden in den USA die größten systemischen Konsequenzen für den Rest der Welt. Die Sicherheitspolitik Washingtons wird für Partner wie Gegner zunehmend schwer einschätzbar, was auf allen Seiten die Gefahr gravierender militärischer Fehleinschätzungen erhöhen dürfte. Daher versucht dieses Kapitel vor allem, ein besseres Verständnis für die amerikanische Sicherheitspolitik zu vermitteln.
Individuelle Fehleinschätzungen
»Jede Lösung ist besser als Krieg«, erklärte mein leider schon verstorbener Vater, Franz Gady, immer dann, wenn das Thema Krieg, meistens von mir losgetreten, in der Familie diskutiert wurde. Geboren 1937 in Bachsdorf im Süden Österreichs gehörte er der Generation an, die im Zweiten Weltkrieg aufwuchs. Was er in jenen Kindheitsjahren erlebt hatte, prägte ihn sehr und machte ihn zu einem überzeugten Pazifisten. Als ich noch ein Kind war, erzählte er mir immer wieder von »Christbäumen«, die er damals am Himmel gesehen habe, woraufhin ich wissen wollte, ob denn auch das Christkind in den Wolken geflogen sei. Erst später habe ich verstanden, dass er von deutschen Leuchtgranaten sprach, die zum Einsatz gekommen waren, um alliierte Bomber auch in der Nacht sichten und abschießen zu können. Außerdem berichtete er davon, dass er häufig auf einem rotierenden Fliegerabwehrgeschütz der Luftwaffe, das im Garten hinter dem Haus stand, Karussell hatte fahren dürfen. Auch das hörte sich für mich als Kind ganz toll an.
Schlimm waren für ihn andere Erinnerungen, etwa die an die Kolonnen deutscher Kriegsgefangener, die von Jugoslawen mit Peitschenhieben und Schlägen am elterlichen Haus vorbei Richtung Süden getrieben wurden. Oder an die Plünderungen im Dorf und an den Moment, als plötzlich ein sowjetischer Soldat in der Stube stand und meine Großmutter nur deshalb einer Vergewaltigung entkam, weil mein Vater und sein jüngerer Bruder sich so fest an sie klammerten, dass der Soldat schließlich »nur« in die Decke schoss und unverrichteter Dinge wieder abrückte.
Obwohl ich diese und andere bedrückende Schilderungen sehr wohl kannte, zitierte ich als siebzehnjähriger Teenager gegenüber meinem Vater einmal Winston Churchill, der 1941 gesagt hatte, dass Sklaverei und Entehrung schlimmer seien als Krieg. Dementsprechend, so meine Schlussfolgerung, könne Krieg zumindest unter gewissen Umständen eine Lösung sein. Mein Vater antwortete darauf nur lapidar, ich solle mich doch einmal mit meinen beiden »Onkel Hans«...
| Erscheint lt. Verlag | 25.10.2024 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Abschreckung • Atombombe • Aufrüstung • Bodentruppen • Bündnis • Cyber • EU • Europa • Frieden • Gaza • Gefechte • Geopolitik • Grenzen • Israel • Kalter Krieg • Konflikte • Krieg • Kriegsführung • Kunst des Krieges • Luftwaffe • Marine • Militär • Naher Osten • NATO • Panzer • Pazifismus • Politik • Raketen • Russland • Rüstungspolitik • Sicherheit • Soldaten • Strategie • Terror • Ukraine • USA • Verteidigung • Waffen • warfare |
| ISBN-10 | 3-7517-6020-2 / 3751760202 |
| ISBN-13 | 978-3-7517-6020-1 / 9783751760201 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,2 MB
Digital Rights Management: ohne DRM
Dieses eBook enthält kein DRM oder Kopierschutz. Eine Weitergabe an Dritte ist jedoch rechtlich nicht zulässig, weil Sie beim Kauf nur die Rechte an der persönlichen Nutzung erwerben.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich