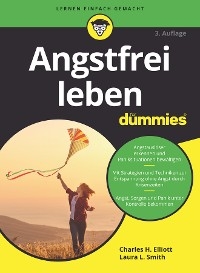Sterblich sein (eBook)
336 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-403584-0 (ISBN)
Atul Gawande ist Facharzt für Chirurgie an einer Klinik in Boston. Vor seiner medizinischen Ausbildung an der Harvard Medical School studierte der Sohn zweier Ärzte Philosophie und Ethik. Er veröffentlicht regelmäßig Beiträge im »New Yorker« und hat mehrere Bücher zum Thema Medizin und Gesellschaft geschrieben, die große Bestseller wurden. ?Sterblich sein? stand viele Wochen auf der »New York Times«-Bestsellerliste. Gawande lebt mit seiner Familie in Newton, Massachusetts.
Atul Gawande ist Facharzt für Chirurgie an einer Klinik in Boston. Vor seiner medizinischen Ausbildung an der Harvard Medical School studierte der Sohn zweier Ärzte Philosophie und Ethik. Er veröffentlicht regelmäßig Beiträge im »New Yorker« und hat mehrere Bücher zum Thema Medizin und Gesellschaft geschrieben, die große Bestseller wurden. ›Sterblich sein‹ stand viele Wochen auf der »New York Times«-Bestsellerliste. Gawande lebt mit seiner Familie in Newton, Massachusetts.
Kraftvoll.
Gekonnt webt Gawande in die Erzählung über den letzten Lebensabschnitt seiner Protagonisten die Erkenntnisse der modernen Medizin ein und die schonungslose Beschreibung des körperlichen Verfalls.
ein glänzend geschriebenes Plädoyer dafür, sich in aller gebotenen Gefasstheit damit abzufinden, dass jedes Leben, vor allem das eigene, mit dem Tod endet.
Nicht anbiedernd, nicht pathetisch, sondern ehrlich und offen. Sein Buch regt zum Nachdenken und vor allem zum Nachfragen an.
Selten wurde ein Sachbuchautor diesem ebenso komplexen wie sensiblen Thema so gerecht wie der Chirurg einer Klinik in Boston.
Sterben kann man später. Aber Gawandes Buch sollte man jetzt lesen. Sofort.
Gawande beschönigt nichts, gibt aber zugleich Einblicke in eine bessere Alten- und Palliativpflege, die hoffnungsfroh stimmen.
Meisterhaft. Bedeutend.
1 Das unabhängige Selbst
Als Kind erlebte ich weder schwere Krankheiten noch die Schwierigkeiten des Alters mit. Meine Eltern, beide Ärzte, waren fit und gesund. Sie waren aus Indien eingewandert, und das Leben meiner Großeltern spielte sich weit weg, auf einem anderen Kontinent ab, während ich mit meiner Schwester in der kleinen Collegestadt Athens, in Ohio, aufwuchs. Der einzige betagte Mensch, den ich regelmäßig zu Gesicht bekam, war eine Frau in der Nachbarschaft, die mir Klavierstunden gab, als ich im Gymnasium war. Später wurde sie krank und musste umziehen, aber ich fragte mich nie, wohin sie zog und was aus ihr wurde. Die Erfahrung des Altwerdens, wie es heute geschieht, spielte sich völlig außerhalb meiner Wahrnehmung ab.
Doch im College begann ich mich regelmäßig mit einem Mädchen namens Kathleen aus meinem Wohnheim zu treffen, und 1985, anlässlich eines Weihnachtsbesuchs bei ihr zu Hause in Alexandria, Virginia, lernte ich ihre Großmutter Alice Hobson kennen, die damals siebenundsiebzig war. Ich fand sie überraschend temperamentvoll und geistig unabhängig. Sie versuchte nie, ihr Alter zu verschleiern. Ihr ungefärbtes weißes Haar trug sie glatt und seitlich gescheitelt, im Stil von Bette Davis. Ihre Hände waren mit Altersflecken übersät, und ihre Haut war voller Falten. Sie trug schlichte, säuberlich gebügelte Blusen und Kleider, etwas Lippenstift und Absätze in einer Höhe weit jenseits dessen, was andere für ratsam halten mochten.
Wie ich im Lauf der Jahre – denn schließlich wurde Kathleen meine Frau – erfahren sollte, war Alice in einem Landstädtchen in Pennsylvania aufgewachsen, das bekannt war für seine Blumen und seine Pilzfarmen. Ihr Vater war Blumenzüchter gewesen und hatte in seinen großen Treibhäusern Nelken, Ringelblumen und Dahlien gezogen. Alice und ihre Geschwister waren die ersten Mitglieder ihrer Familie, die aufs College gingen. An der Universität von Delaware lernte Alice Richmond Hobson kennen, einen angehenden Ingenieur. Wegen der Weltwirtschaftskrise konnten sie sich erst sechs Jahre nach ihrem Abschluss die Heirat leisten. In den frühen Jahren ihrer Ehe zogen Alice und Rich wegen seiner Arbeit oft um. Sie hatten zwei Kinder, Jim, meinen späteren Schwiegervater, und dann Chuck. Rich war beim Ingenieurcorps der Army beschäftigt, sein Spezialgebiet war der Damm- und Brückenbau. Nach einem Jahrzehnt wurde er befördert und arbeitete für den leitenden Ingenieur der Truppe in der Hauptverwaltung bei Washington, D.C., wo er bis zum Ende seiner Laufbahn auch wohnte. Er und Alice ließen sich in Arlington nieder. Sie kauften ein Auto, machten Ausflüge in die nähere und fernere Umgebung und legten auch etwas Geld zurück. Bald konnten sie sich ein größeres Haus leisten und ihre gescheiten Kinder aufs College schicken, ohne sich in Schulden stürzen zu müssen.
Auf einer Dienstreise nach Seattle bekam Rich plötzlich einen Herzinfarkt. Er hatte seit längerer Zeit immer wieder Angina gehabt und nahm Nitroglycerintabletten gegen die gelegentlich auftretenden Schmerzen in der Brust, doch wir befinden uns im Jahr 1965, und damals konnten die Ärzte noch nicht viel gegen ein Herzleiden ausrichten. Er starb im Krankenhaus, bevor Alice zu ihm kommen konnte. Er war nicht älter als sechzig. Alice war fünfundfünfzig.
Dank der Pension vom Ingenieurscorps war es ihr möglich, das Haus in Arlington zu behalten. Als ich sie kennenlernte, wohnte sie schon zwanzig Jahre dort in der Greencastle Street, allein. Meine angeheirateten Verwandten Jim und Nan waren in der Nähe, doch Alice lebte völlig unabhängig von ihnen. Sie mähte selbst ihren Rasen und konnte ein kaputtes Waschbecken, ein verstopftes Klo reparieren. Mit ihrer Freundin Polly ging sie zur Gymnastik. Sie nähte und strickte gern und stellte für jedes Familienmitglied Kleider, Schals und kunstvolle rot-grüne Weihnachtsstrümpfe mit den dazugehörigen plattnasigen Weihnachtsmännern und aufgenähten Namen her. Sie war der Kopf einer Gruppe, die regelmäßig Theater- und Musikaufführungen in der Stadt besuchte. Sie fuhr einen großen Chevrolet und hatte sich ein Kissen auf den Sitz gelegt, damit sie über das Armaturenbrett sehen konnte. Alle notwendigen Alltagsdinge erledigte sie allein; dazu machte sie gern Besuche und Ausflüge mit Freunden und lieferte Essen für Leute aus, die schwächer waren als sie selbst.
Die Zeit verging, und immer öfter drängte sich Außenstehenden die Frage auf, wie lange sie es wohl noch schaffen würde, so weiterzumachen. Sie war eine kleine Frau, höchstens einen Meter dreiundfünfzig groß, und obwohl sie gereizt reagierte, wenn jemand es feststellte, verlor sie mit jedem Jahr an Körpergröße und Kraft. Als ich ihre Enkelin heiratete, strahlte Alice; sie umarmte mich und sagte mir, wie glücklich diese Hochzeit sie mache, sie könne nur leider wegen ihrer Arthrose nicht mit mir tanzen. In den nächsten Jahren blieb sie in ihrem Haus und versorgte sich weiterhin selbst.
Als mein Vater sie kennenlernte, überraschte es ihn, dass sie allein lebte. Er war Urologe, was bedeutete, dass er viele alte Menschen als Patienten hatte, und es machte ihm immer Sorgen, wenn er erfuhr, dass einer von ihnen allein lebte. Er meinte, wenn sie nicht schon bedürftig seien, würden sie es sicher bald werden, und da er aus Indien kam, sah er es als die Verantwortung der Familie an, die Alten zu sich zu nehmen, ihnen Gesellschaft zu leisten und sich um sie zu kümmern. Seit er 1963 in New York seine Facharztausbildung gemacht hatte, hatte mein Vater sich so gut wie jedem Aspekt der amerikanischen Kultur angepasst. Er aß nicht mehr vegetarisch und ging mit Mädchen aus. Er fand eine Freundin, eine angehende Kinderärztin aus einem Teil von Indien, dessen Sprache er nicht sprach. Als er sie einfach heiratete, statt meinen Großvater die Heirat arrangieren zu lassen, war die Familie entsetzt. Er begeisterte sich für Tennis, wurde Präsident des lokalen Rotary Clubs und erzählte gern gewagte Witze. Einer seiner stolzesten Tage war der 4. Juli 1976, an dem die Vereinigten Staaten ihren zweihundertsten Geburtstag feierten und er vor Hunderten jubelnder Menschen auf der Haupttribüne des Jahrmarkts von Athens zwischen Schweine-Auktion und Demolition Derby seine Einbürgerungsurkunde überreicht bekam. Aber eine Sache, an die er sich nie gewöhnen konnte, war die Weise, wie wir unsere Alten und Gebrechlichen behandeln – dass wir sie allein leben lassen oder sie zu einem isolierten Dasein in diversen anonymen Einrichtungen verdammen, wo sie ihre letzten bewussten Momente mit Pflegerinnen und Ärzten verbringen, die kaum wissen, wie sie heißen. Hier lag der größte Unterschied zu der Welt, in der er aufgewachsen war.
Der Vater meines Vaters führte im Alter ein Leben, das aus der westlichen Perspektive idyllisch erscheint. Sitaram Gawande war Bauer in einem Dorf namens Uti, etwa fünfhundert Kilometer landeinwärts von Mumbai entfernt, wo unsere Vorfahren jahrhundertelang das Land bestellt hatten. Ich erinnere mich daran, wie ich ihn mit meinen Eltern und meiner Schwester besuchte, etwa zu der Zeit, als ich Alice kennenlernte. Er war damals schon über hundert Jahre alt, weitaus der älteste Mensch, den ich je gesehen hatte. Er lief am Stock, krumm wie ein gebeugter Weizenhalm, und er war so taub, dass man ihm durch einen Gummischlauch ins Ohr schreien musste. Weil er so schwach war, brauchte er manchmal Hilfe beim Aufstehen. Doch er war ein würdiger Mann, der einen dicht gewickelten weißen Turban trug, eine gebügelte karierte Strickjacke und eine altmodische Malcolm-X-Brille mit dicken Gläsern. Zu jeder Zeit war er von Familienmitgliedern umgeben, die ihn unterstützten, und man verehrte ihn – nicht trotz, sondern wegen seines Alters. Bei allen wichtigen Angelegenheiten fragte man ihn um Rat – wenn es ums Heiraten ging, bei Streitigkeiten um Land, bei geschäftlichen Dingen –, und in der Familie nahm er stets den Ehrenplatz ein. Wenn wir aßen, wurde ihm zuerst serviert. Wenn junge Leute ins Haus kamen, verbeugten sie sich und berührten demütig seine Füße.
In Amerika wäre er höchstwahrscheinlich in ein Pflegeheim gekommen. Es gibt in der Gesundheits- und Krankenpflege eine modellhafte Klassifikation der Tätigkeiten eines Menschen zur Erfüllung seiner Grundbedürfnisse, bekannt als »Aktivitäten des täglichen Lebens« (ATLs). Wenn man ohne fremde Hilfe nicht mehr zur Toilette gehen, essen, sich anziehen und waschen kann, wenn man nicht mehr allein aus dem Bett kommt, nicht mehr aufstehen und laufen kann, mangelt es an der Fähigkeit der grundlegenden physischen Selbständigkeit. Wenn man nicht mehr allein einkaufen, sich sein Essen zubereiten, seinen Haushalt führen, seine Wäsche waschen, seine Tabletten vorschriftsmäßig einnehmen kann und nicht mehr in der Lage ist, zu telefonieren, ohne Begleitung zu reisen und seine Finanzen zu regeln, hat man die Fähigkeit verloren, sicher allein zu leben.
Mein Großvater konnte nur noch wenige dieser einfachen und sehr wenige der komplexeren Aktivitäten selbständig ausführen. Doch in Indien hatte das keine bösen Folgen. Es wurden wegen ihm keine Krisensitzungen der Familie abgehalten, es gab keine qualvollen Debatten darüber, was mit ihm geschehen solle. Es war klar, dass man dafür sorgen würde, dass er weiterhin so leben konnte, wie er es wünschte. Er lebte bei einem meiner Onkel, und da immer einige der zahlreichen Kinder, Enkel, Nichten und Neffen in seiner Nähe waren, mangelte es ihm nie an Hilfe.
In modernen Gesellschaften können nur wenige...
| Erscheint lt. Verlag | 24.9.2015 |
|---|---|
| Übersetzer | Susanne Röckel |
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Lebenshilfe / Lebensführung |
| Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie | |
| Schlagworte | Alter • checklist • Checklist Maifesto • Checklist Manifesto • Chemotherapie • Gebrechen • Krankenhaus • Krankheit • Krebs • Leben • Loslassen • Manifesto • Medizin • Medizinische Versorgung • Patientenverfügung • Pflege • Pflegeheim • Pflegenotstand • Pflegereform • Sachbuch • Sterben • Tapferkeit • Tod • Vollmacht • Würde |
| ISBN-10 | 3-10-403584-9 / 3104035849 |
| ISBN-13 | 978-3-10-403584-0 / 9783104035840 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 940 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich