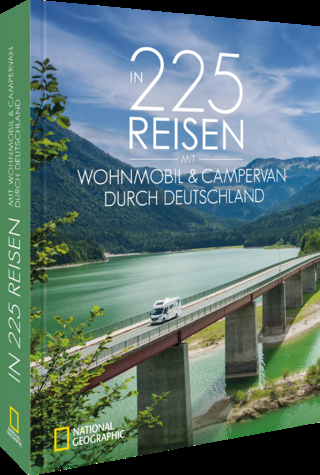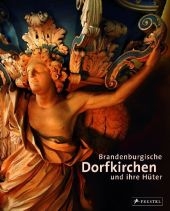
Brandenburgische Dorfkirchen und ihre Hüter
Prestel (Verlag)
978-3-7913-4005-0 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen, Neuauflage unbestimmt
- Artikel merken
In Brandenburg gibt es über 1.400 Kirchen, von denen viele vom Verfall bedroht sind. Es ist besonders den Fördervereinen und Schlüsselhütern der Dorfkirchen zu verdanken, dass viele historisch wertvolle Gebäude gerettet und mit neuem Leben erfüllt worden sind. Mit stimmungsvollen Fotografien und kurzen Texten prominenter „Paten“ werden 22 ganz unterschiedliche Kirchen in diesem Bildband porträtiert. Damit zeigt er nicht nur einen interessanten Querschnitt durch die brandenburgische Kirchengeschichte, sondern rückt auch die Bewahrer dieser Kirchen in den Mittelpunkt.
Kara Huber ist Pädagogin und Buchautorin, sie engagiert sich ehrenamtlich für Projekte in den Bereichen Kultur und Kirche.
Leo Seidel, geboren 1977 in Berlin, absolvierte eine Ausbildung zum Fotodesigner am Lette-Verein Berlin. Seit Juni 2004 ist er Archivfotograf bei OSTKREUZ Agentur der Fotografen und arbeitet freiberuflich für Verlage, Magazine und Agenturen.
Zum Geleit Kirchengebäude sind oft die ältesten Zeugnisse einer Siedlung. Ihr Glanz strahlt über die eigentliche Bestimmung als Stätten des Glaubens und des Gottesdienstes hinaus. Denn Kirchen sind ebenso Bauten von allgemeiner kultureller Bedeutung: Herbergen einmaliger Kunstschätze, viel besuchte Orte der Bildung und des Tourismus sowie Mittelpunkt kultureller Veranstaltungen. Ihre unverwechselbare Silhouette prägt weithin sichtbar die Ortsbilder unserer historisch gewachsenen Kulturlandschaften. Selbst Menschen, die dem Glauben fernstehen, identifizieren sich mit den Kirchengebäuden ihrer Heimat und engagieren sich für ihre Erhaltung. Denn sie fragen sich ebenso: Kann das soziale Gefüge einer Gemeinde lebendig bleiben, wenn aus einem Ort die Schule, die Gemeindeverwaltung, Läden und Gasthäuser verschwunden sind? Gerade Dorfkirchen sind hierbei nicht selten ein rettender Anker. Dennoch: Besonders in den ländlichen Gegenden Ostdeutschlands, die von Bevölkerungsschwund und Abwanderung betroffen sind, sind viele Kirchen gefährdet. Das gilt auch für etliche der mehr als 1.500 Dorfkirchen in Brandenburg. Soll die Öffentlichkeit für die Erhaltung und Pflege dieser Dorfkirchen gewonnen werden, so müssen sie vor allem zugänglich sein. Nur was bekannt ist, hat auch die Chance auf Zuwendung. Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Berlin, im Mai 2008 Daher begrüße ich die Initiative ausdrücklich, mit diesem Buch 22 Dorfkirchen auch einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Möge dieses Engagement Schule machen und dazu beitragen, dass die vielen ländlichen Kirchen in Brandenburg nicht nur als touristische Ziele, sondern auch als Orte der Stille und der Selbstfindung im Dorf bleiben können. Kara Huber Dorfkirchen im Wandel der Zeit Die Anziehungskraft brandenburgischer Dorfkirchen nimmt zu. In Zeiten von Hektik, Beschleunigung und "Globalisierung" wächst die Sehnsucht nach Heimat, nach einer Symbiose von Landschaft und Dorfleben. Dabei begegnen uns die Kirchen in den Dörfern nicht als verkleinerte Stadtkirchen, sondern sie stehen in Beziehung zu einem jeweils gewachsenen Gemeinwesen; Generation auf Generation hat sie bewahrt und gewandelt. Von der Kargheit des Bodens sollte nicht zu rasch auf die Kargheit von Architektur und Ausstattung brandenburgischer Dorfkirchen geschlossen werden. Häufig anheimelnd in ihrer schlichten Ausgestaltung, schärfen diese schon auf den ersten Blick unsere Sinne, doch Zugang erhält der Überraschte erst auf den zweiten Blick, wenn er die Formensprache der Gotteshäuser kennen lernt. Vom Mittelalter bis in die Gegenwart Beim Betrachten vieler Bauten nähern wir uns dem späten Mittelalter. In einigen Regionen, wie dem Barnim oder der Uckermark, blieben bis heute nahezu 80 % der Feldsteinkirchen aus der Zeit der deutschen Ostsiedlung im 13. Jahrhundert bewahrt. Jede Siedlung erhielt, im Unterschied zu anderen Regionen Deutschlands, im Zuge des Landesausbaus ihr eigenes Gotteshaus. In der heutigen Zeit ist dies Reichtum und Problem zugleich! Durch archäologische und kunsthistorische Forschungen wissen wir inzwischen, dass die steinernen Kirchen in den meisten Fällen kleine, hölzerne Vorgängerbauten besaßen, die in Wohnortnähe einen Raum für Andacht und Gebet bieten sollten. Der Rohstoff für die festen Gotteshäuser lag dann buchstäblich auf dem Felde. Granitquader sind ein sprödes Baumaterial; sie ohne Maschinen zu bearbeiten, war eine schwere Tätigkeit. Die gleichwohl hervorragende Bearbeitung des Gesteins beweist, dass hier professionelle Bauhütten am Werk waren und die Formensprache ihrer Herkunftsregionen mitbrachten. Rheinische, westfälische, ja sogar flämische Einflüsse auf den spätmittelalterlichen Kirchenbau in der Mark Brandenburg lassen sich unschwer finden. Anders als heute kannte man in den mittelalterlichen Kirchen kein Gestühl, denn die lateinische Messe wurde in den düsteren Innenräumen stehend gefeiert. Die Fenster waren nur schmale Schlitze, vermutlich mit Tierhäuten notdürftig gegen Witterungseinflüsse abgedichtet; erst später leistete man sich dafür das teure Glas. Als erste "Fertigbauteile" kamen die Backsteine in den Dorfkirchenbau - ein Baumaterial, das zuerst fürstlichen Bauten, später Klöstern und repräsentativen Stadtkirchen vorbehalten war. Die Ziegel im "Klosterformat" wurden aus heimischen Tonvorkommen gebrannt. Der Kalk kam beispielsweise aus Rüdersdorf, wo die Zinnaer Mönche eine Kalkgrube betrieben. Nach der Reformation wurden die Kirchen nur langsam und ohne eifernden Bildersturm umgestaltet. Vorreformatorische Schnitzaltäre mit Marienbildern und Heiligendarstellungen überdauerten in einigen Kirchen bis zum heutigen Tag. Veränderungen betrafen hauptsächlich den Innenraum: Um der langen Predigt besser folgen zu können, kam festes Gestühl in die Kirchen. Der Einbau von Emporen glich den entstandenen Platzmangel aus. Die Fenster wurden vergrößert, denn das Lesen in den Gesangbüchern erforderte Licht. Nach und nach entstanden neue Altäre, die Veränderungen des Glaubensverständnisses sichtbar machten. Im Zentrum der bildlichen Darstellung standen jetzt Ereignisse aus dem Leben Christi. In der Predella ist zumeist das Abendmahl zu sehen, darüber Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt. Durch die Aufwertung des Wortes im protestantischen Gottesdienst erhielt die Kanzel eine wesentliche Funktion, geschmückt wurde sie oft mit Darstellungen der vier Evangelisten oder ihrer Symbole. Als konsequente Fortsetzung entstand aus dieser Auffassung der Kanzelaltar als typisches Merkmal lutherischer Kirchenräume. Einen grausamen Einschnitt stellte in weiten Teilen Brandenburgs der Dreißigjährige Krieg dar; Jahrzehnte dauerte es, bis das Land sich von den verheerenden Auswirkungen erholt hatte. Zerstörte Kirchen wurden vielerorts als einfache Fachwerkbauten wieder aufgebaut. In ihren Heimatländern verfolgte Glaubensflüchtlinge aus Frankreich oder Salzburg halfen beim Aufbau der wüsten Dorfstellen und errichteten eigene schmucklose Gebetshäuser. Im Zeitalter des Barock kehrte die Repräsentationslust der adligen Patronatsherren in den Kirchenraum ein. Aufwändige Grabmale und Epitaphe schufen für die nachfolgenden Generationen einen Ort, an dem sie sich der verstorbenen Familienmitglieder erinnerten. Pausbäckige Engelsfiguren schmückten Altäre oder reich verzierte Orgelprospekte. Als barocke Bereicherung schwebte der Taufengel in manchen Kirchenräumen. Durch ein Gegengewicht auf dem Kirchenboden war es möglich, den Himmelsboten zur Taufe herabgleiten und danach wieder emporsteigen zu lassen. Die Patronatsfamilie erhielt in der Kirche einen gesonderten Eingang, der zu einer abgetrennten Loge führte. Der Patron bezahlte den Pfarrer und hatte so Einfluss auf die Berufung des Geistlichen. Unter König Friedrich Wilhelm III. kam es im Jahr 1817 zur Union zwischen der lutherischen und der reformierten Kirche in Preußen. Beide Konfessionen wurden als gleichberechtigt anerkannt und damit die Gemeinschaft im Abendmahl ermöglicht. Der Kirchenbau dieser Zeit unterlag zunehmend dem Einfluss der Königlichen Ober-Bau-Deputation, die auf Sparsamkeit achtete, aber auch Einfluss auf bauästhetische Fragen nahm. Karl Friedrich Schinkel, der sogar den Musterentwurf einer "Normalkirche" für ländliche Regionen Preußens fertigte, und Friedrich August Stüler wirkten prägend auf den Stil märkischer Kirchengebäude. Mit dem Entstehen der institutionellen Denkmalpflege in Preußen schärfte sich der Blick für das Vergangene.
| Erscheint lt. Verlag | 27.5.2008 |
|---|---|
| Illustrationen | Wolfgang Reiher, Leo Seidel |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 240 x 300 mm |
| Gewicht | 1376 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Reisen ► Bildbände ► Deutschland |
| Schlagworte | Brandenburg; Bildband • Brandenburg, Kunst; Architektur • Dorfkirchen |
| ISBN-10 | 3-7913-4005-0 / 3791340050 |
| ISBN-13 | 978-3-7913-4005-0 / 9783791340050 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich