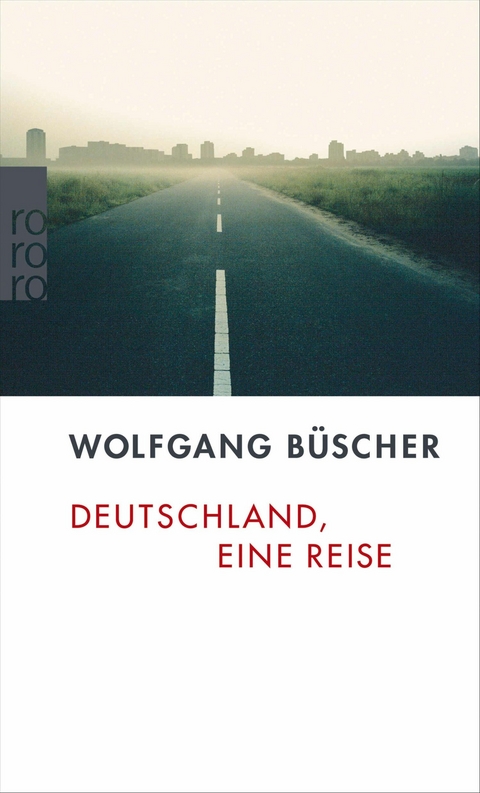Deutschland, eine Reise (eBook)
400 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-10021-3 (ISBN)
Wolfgang Bu?scher, geboren 1951 bei Kassel, ist Schriftsteller und Autor der «Welt». «Er hat der Reiseliteratur», wie es im «Deutschlandfunk» hieß, «zu neuem Glanz verholfen.» Zu seinen Veröffentlichungen zählen «Berlin - Moskau» (2003), «Deutschland, eine Reise» (2005), «Hartland» (2011) und «Ein Fru?hling in Jerusalem» (2014). Fu?r sein Werk wurde Wolfgang Bu?scher vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kurt-Tucholsky-Preis, dem Johann-Gottfried-Seume-Literaturpreis und dem Ludwig-Börne-Preis.
Wolfgang Büscher, geboren 1951 bei Kassel, ist Schriftsteller und Autor der «Welt». «Er hat der Reiseliteratur», wie es im «Deutschlandfunk» hieß, «zu neuem Glanz verholfen.» Zu seinen Veröffentlichungen zählen «Berlin – Moskau» (2003), «Deutschland, eine Reise» (2005), «Hartland» (2011) und «Ein Frühling in Jerusalem» (2014). Für sein Werk wurde Wolfgang Büscher vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kurt-Tucholsky-Preis, dem Johann-Gottfried-Seume-Literaturpreis und dem Ludwig-Börne-Preis.
Der Arzt von Helgoland
Die Überfahrt nach Helgoland verlief stürmischer als die Reise nach Borkum, bei Windstärke acht. An Bord waren bauchfreie Mädchen und moslemische Schülerinnen, das Tuch eng um den Kopf gewickelt, ein bayerischer Shanty-Chor und ein paar stille Passagiere, die wohl aus Passion auf die Insel fuhren, und das nicht zum ersten Mal. Sie hielten sich abseits. Ein baumlanger Schwarzer machte mit einem großen Schraubenschlüssel die Schotten dicht. Nach einer Stunde erreichten wir die offene See.
Als das Unwetter losbrach, stieg ich aufs höchste Deck und drückte mich in eine Ecke, damit der Matrose, der es räumen sollte, mich nicht sah. So stand ich nun allein dort oben und beobachtete – die Beine gespreizt, den Rücken an einen der beiden warmen Schlote gelehnt –, wie sich ein Wellental nach dem andern auftat, wie die «MS Helgoland» sich hineinstürzte und die Brecher über das Vorschiff tobten. Das war der beste Moment. Kleine Regenbogen blitzten sekundenlang in der Gischt. Immer wieder schüttelte das Schiff die See von sich ab und stieg hoch auf den nächsten Wellenkamm.
Unten auf dem großen Deck froren die bauchfreien Mädchen jetzt ganz erbärmlich, und die moslemischen Schülerinnen in ihren dünnen Tüchern auch. Einige versuchten, das Unwetter dicht zusammengedrängt wie Tiere zu überstehen, einige hatten aufgegeben und hingen nur noch bleich über der Reling. Drinnen sangen die Bayern Seemannslieder. Manche Passagiere tranken Bier und hörten zu, andere schwiegen gedankenverloren. Wenn das Singen für kurze Zeit verstummte, begann wieder einer ein Lied und stachelte den Chor zum Wechselgesang an. Ein Mann ging auf und ab und wiegte ein kleines Kind im Arm.
Erst als wir das Hafenbecken von Helgoland erreichten, das zerbrechlich wirkte in der schweren See, beruhigte sich das schaukelnde Schiff. Die Ausbootung fand noch auf die althergebrachte Weise statt. Die Passagiere drängten zum Ausgang, es regnete und stürmte fürchterlich. Das Boot, in das alle hineinmussten, kam längsseits, darin standen Männer in dunkelblauem Ölzeug und mit einer Art Enterhaken, die Kapuze im Gesicht, mit befremdlichen Sonnenbrillen wie aus nordkoreanischer Produktion. Sie packten uns Passagiere – schlotternde Kopftuchmädchen, seetüchtige Bayern, Männer, Frauen, Leichte, Schwere – und hoben einen nach dem anderen in ihr offenes Boot, stießen nach, sobald einer zögerte, die sturmgepeitschten Planken zu betreten. Dicht gedrängt saßen wir da, das nasse Gepäck an uns gepresst. Dann brachte das Boot uns an Land. Keine fünf Minuten, und die Anlegestelle war so leer wie zuvor.
Ich suchte mir ein Zimmer gleich am Hafen, es war eng und lag unterm Dach, der Regen schlug gegen das Fenster. Ich ließ mir Tee bringen und ruhte mich kurz aus, dann zog ich den langen Regenmantel an und die Kapuze über den Kopf, ging zum Inselaufzug und fuhr hoch aufs Oberland, um eine Nachtwanderung über den kraterübersäten Rücken der Insel zu machen.
Der Regen ließ nach, der Sturm legte sich, nach einer Weile war sogar der Mond zu sehen und tauchte die Insel minutenweise in Fotostudiolicht. Die Krater waren immer noch gut zu erkennen. Zwei Jahre nach dem Krieg, am 18. April 1947, hatten die Briten den irren, aber ernst gemeinten Versuch unternommen, die ganze Insel in die Luft zu sprengen. Das Datum war symbolisch gewählt – auf den Tag genau zwei Jahre nach dem Angriff tausend britischer Bomber auf Helgoland, dem letzten Flächenbombardement des Zweiten Weltkriegs.
In jenem Frühjahr 1947 war die Insel ein Geisterfelsen gewesen. Im Sommer 1945 hatte man sie vollständig evakuiert, die Helgoländer waren auf das Festland verbannt worden, nun sollte ihre Insel in die Luft fliegen. Ein drei viertel Jahr lang hatten die Briten alles, was der Krieg an Torpedoköpfen, Granaten, Minen hinterlassen hatte, in die Kasematten geschleppt, jetzt zündeten sie es, von See aus. 6700 Tonnen Sprengstoff. In den Zeitungen stand: die größte nichtnukleare Explosion der Weltgeschichte.
Die Helgoländer hörten sie deutlich an der Küste, unter Tränen, heißt es. Sie sahen, wie sich eine ungeheure Sprengwolke über der Nordsee erhob. In ganz Europa war das Beben seismographisch messbar. Als der big bang verklungen war und der Staub sich setzte, stand Helgoland noch immer. Sein charakteristischer roter Sandstein hatte sich als ungemein elastisch erwiesen. Er hatte einfach nachgegeben. Nur der Südteil der Insel versank im Meer. Helgoland war angeschlagen, aber es hatte überlebt.
Für seine früheren Bewohner indessen war nichts gewonnen, denn nun nahm sich die Royal Air Force den renitenten roten Felsen vor. Sieben Jahre lang, vom Ende des Krieges bis in die fünfziger Jahre hinein, übten ihre Piloten über Helgoland den Bombenabwurf. In den Pausen dazwischen mutierte die Insel zum Tagebau, dann suchte eine Schrottfirma auf ihr nach wieder verwertbarem Metall.
Das ging so lange, bis Weihnachten 1950 zwei Heidelberger Studenten mit Hilfe eines Helgoländer Fischers illegal auf der Insel landeten, durch die Trümmerlandschaft kletterten, die Eisentür des Flakturms aufbrachen und ihn besetzten. Er war das einzige Bauwerk auf der Insel, das noch existierte. Dann hissten sie die deutsche, die Helgoländer und eine kleine, selbst gemachte Europa-Fahne. Schon vorher hatten sie dafür gesorgt, dass die Welt davon erfahren würde.
Die Aktion löste eine Welle der Sympathie aus. Es bildete sich sogar ein Komitee jener Helgoländer, die noch als britische Staatsbürger geboren worden waren – bevor Britisch-Helgoland im Jahre 1890 deutsch geworden war, hatte das Kaiserreich im Gegenzug auf seine Ansprüche auf Sansibar verzichtet – und die nun, wie viele andere, an London appellierten, die Insel zu schonen.
Nach einigem diplomatischen Hin und Her gab die Royal Air Force nach, und 1952 konnten die Helgoländer auf ihre Kraterinsel zurückkehren, von der jede Spur menschlichen Lebens getilgt war, um sie neu zu besiedeln und noch einmal ganz von vorne zu beginnen.
Auf dem Rückweg erwischte mich ein kräftiger Schauer. In meiner Dachkammer hängte ich die nassen Sachen auf, bestellte neuen Tee, dann nahm ich die Aufzeichnungen des Inselarztes in die Hand, das Kriegstagebuch des Dr. med. Walter Kropatscheck. Ich las nicht gleich. Am Bild auf dem Umschlag blieb ich hängen, seinem Foto im Halbprofil.
Und wieder dachte ich, dass es ausgestorbene Gesichter gibt, dass Zeiten ihre Gesichter haben. Dieses hatte eine klassische Nase, leicht gebogen, und einen schmalen Mund. Etwas Entschiedenes lag in seinen Zügen. Dazu trugen auch die hohe Stirn bei und das zurückgekämmte, etwas schüttere Haar, die verschatteten Augen. Eine gewisse Hagerkeit, die später aus den Gesichtern gewichen war. Waren Sie ein schöner Mann, Herr Doktor? Waren Sie glücklich?
Ich hatte nur seinen Kopf, ich zog ihm Kostüme an. Offiziersmütze und Kragenspiegel? Schon möglich. Arztkittel? Sicher. Beffchen und Pastorenkleid? Ja, das ginge auch. Es ist etwas Theologisches um Sie, Herr Doktor. Und Tweed ist um Sie. Tweed, Pfeife, Kreuzfahrtplaid – wie wäre es, die ganze Sache ohne Krieg, ein Leben ohne Kriegstagebuch? Ebenfalls denkbar. Noch ein Kostüm, bitte, ein letztes. Rimini, später. Sand im Haar, Sand im Mund, und nur noch baden, baden, baden.
Hier war Schluss mit dem Kostümfest in der Dachkammer. Weiter kam ich nicht mit ihm. Gerade so bis an meine Schulzeit kam ich heran, bis an die Ränder des guten Lebens – da hörte es auf, die Kostüme ab jetzt saßen ihm nicht. Er war einer von jenseits der Zeitmauer, die das letzte Jahrhundert teilt, genau in der Mitte. Keiner von uns Diesseitigen. Einer von drüben. Einer, wie ich ihn gern kennen lernen würde. Das wäre kaum möglich. Solche wie Sie, Herr Doktor, gibt es nicht mehr.
Er stammte aus einer preußisch-schweizerischen Theologenfamilie (Kragenspiegel, Beffchen). Schule in Breslau und Göttingen, Studium in Berlin (Tweed). Dann als junger Mann Schiffsarzt in den Tropen (Pfeife). Und schließlich Inseldoktor auf Helgoland. Am 13. April 1945, fünf Tage vor dem großen Bombardement, schrieb er in sein Tagebuch: «Der Sanitäter N., dem wir vor zwei Wochen eine Niere entfernen mussten, hat seinen Marschbefehl an die Front erhalten. Im Garten des Kasinos werden große Beete mit Stiefmütterchen bepflanzt! Visionen aus dem Propagandaministerium: ‹Göttin des Sieges›, ‹wogende Kornfelder›, ‹Lorbeerkranz›.» Am Tag davor hatte er notiert: «Es ist ein Unterschied, ob einem die Lebenserfahrungen im ‹Inferno› oder in ‹Stahlgewittern› zugewachsen sind.»
Der Krieg war für ihn das Ereignis seines Lebens gewesen. Das war keine moralische Frage, und es hatte nichts mit «heroischem Lebensgefühl» zu tun. Im Sommer 1944 hatte er in sein Tagebuch geschrieben: «Hoffentlich glaubt später niemand, dass die Leute in diesen Kriegszeiten von großen Dingen – im Guten oder Bösen – bewegt wurden.»
Wenn alles untergeht, ist immer noch die Frage, welche Figur einer dabei macht. Desillusioniert? Ja, aber um Haltung bemüht. Haltung war essentiell. Mitgefühl? Ja, schon aus hippokratischen Gründen, aber nicht sentimental. Kühl, also modern. Gedankenvoll? Doch, ja, also «deutsch». Aber nicht treuherzig nach Meistersingerart, das ging nicht mehr. Und das Andere – der utopische oder kulturelle Rest? Ja, den gab es noch. Aber nach der Pflicht, in den Abendstunden. Seine Sterne hießen Simplicius und Seneca. Nachts notiert er, was am Tage war und worüber er nachdenkt. Über Sein und Schmerz. Über den todkranken Alten, der den Herrn Doktor einen Tag vor seinem Tod fragt, ob er bald heimkehren werde, und dem er...
| Erscheint lt. Verlag | 5.10.2009 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber |
| Reisen ► Reiseberichte ► Deutschland | |
| Reisen ► Reiseberichte ► Europa | |
| Reisen ► Reiseführer ► Europa | |
| Schlagworte | Deutschland • Melancholie • Reiseberichte • Reiseschriftsteller |
| ISBN-10 | 3-644-10021-7 / 3644100217 |
| ISBN-13 | 978-3-644-10021-3 / 9783644100213 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich