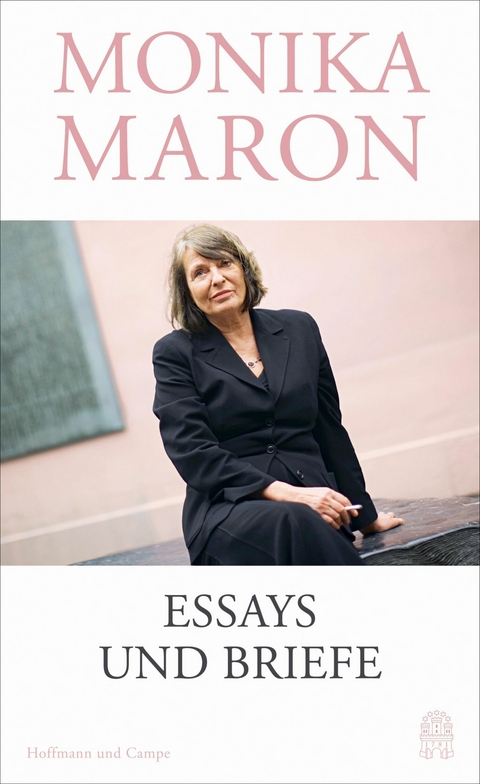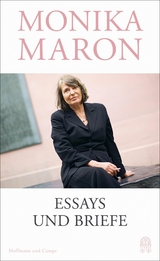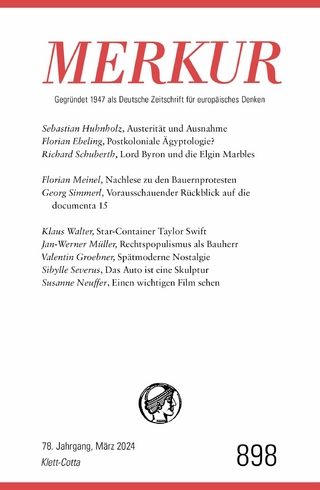Essays und Briefe (eBook)
608 Seiten
Hoffmann und Campe (Verlag)
978-3-455-01382-5 (ISBN)
Monika Maron, geboren 1941 in Berlin, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der Gegenwart. Sie wuchs in der DDR auf, übersiedelte 1988 in die Bundesrepublik nach Hamburg und lebt seit 1993 wieder in Berlin. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane und mehrere Essaybände. Ausgezeichnet wurde sie mit diversen Preisen, darunter der Kleistpreis (1992), der Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Homburg (2003), der Deutsche Nationalpreis (2009), der Lessing-Preis des Freistaats Sachsen (2011) und der Ida-Dehmel-Literaturpreis (2017). Bei Hoffmann und Campe erschienen zuletzt der Essayband Was ist eigentlich los? (2021) und der Roman Das Haus (2023).
Monika Maron, geboren 1941 in Berlin, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern der Gegenwart. Sie wuchs in der DDR auf, übersiedelte 1988 in die Bundesrepublik nach Hamburg und lebt seit 1993 wieder in Berlin. Sie veröffentlichte zahlreiche Romane und mehrere Essaybände. Ausgezeichnet wurde sie mit diversen Preisen, darunter der Kleistpreis (1992), der Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Homburg (2003), der Deutsche Nationalpreis (2009), der Lessing-Preis des Freistaats Sachsen (2011) und der Ida-Dehmel-Literaturpreis (2017). Bei Hoffmann und Campe erschienen zuletzt der Essayband Was ist eigentlich los? (2021) und der Roman Das Haus (2023).
Cover
Verlagslogo
Titelseite
Essays
Briefe
Textnachweis
Biographie
Impressum
Essays
Wir wollen trinken und dann ein bisschen weinen
Die Stadtmitte der Hauptstadt ist ihr westlicher Außenbezirk. Die Mitte ist die Grenze; das Nichtüberschreitbare ist die Mitte, auch des Denkens. Da, mitten in die Mitte hinein führt eine Tür, ein eisernes, braun angestrichenes Tor, durch das die von draußen kommen, von drüben, aus dem Westen, wie immer einer das nennt. Die Tür hat nur auf einer Seite eine Klinke, auf der anderen. Die Rede ist vom Bahnhof Friedrichstraße, dem symbolträchtigen Schauplatz von Stadtgeschichte, nationaler Geschichte, von unzähligen Familien- und Liebesgeschichten. Ein Ort voll stumpfer Dramatik.
Vor dieser Tür im Mittelbau des Bahnhofs stehe zuweilen auch ich und erwarte meine Gäste. Ich stehe im gleißenden, von den gelb gekachelten Wänden feindselig reflektierten Neonlicht inmitten anderer Wartender, glotze wie sie auf diese Tür, die alle paar Sekunden ein Menschlein ausspuckt, manchmal auch mehrere zugleich, ins Schloss fällt, sich öffnet, spuckt, wieder zufällt. Ich weiß, gleich neben der Tür hängt ein Schild: »Halt! Weitergehen verboten«; ich weiß es, aber ich sehe es nicht, ich sehe nur auf die Tür, wie die Blicke aller Umstehenden magisch auf die Tür gerichtet sind. Einziger Zeitvertreib: die Personenbestimmung der Ankömmlinge, Ostmensch oder Westmensch. Die meisten sind Rentner, Ostmenschen also. Sie schleppen schwere Taschen und Beutel, wenn sie vom Einkaufen am Zoo oder in der Neuköllner Karl-Marx-Straße kommen, große Koffer, wenn sie Verwandte in Westdeutschland besucht haben. Einmal habe ich hier einen Gepäckträger gesehen, ebenso alt und auch so gebrechlich wie die Frau, deren Koffer er trug.
Haben die schwer Beladenen sich samt ihrem Gepäck endlich durch den schmalen Spalt in der Tür bugsiert, retten sie sich zunächst an das eiserne Geländer, das ein zimmergroßes Areal vor dem Tor begrenzt. Da stellen sie ihr Gepäck ab, sortieren die Papiere, die sie in den nervösen, schweißfeuchten Händen halten, suchen unter den Wartenden jenseits der Absperrung nach einem, der ihretwegen da steht. Finden sie keinen, greifen sie seufzend oder entschlossen nach ihren Koffern und Taschen, schleppen sie und sich an den Taxistand vor dem Bahnhof, um sich ergeben in eine Schlange von dreißig oder mehr Leuten einzureihen. Andere bleiben keuchend hinter der Tür stehen, bleich, öffnen einen Kragenknopf, tupfen sich mit einem Tuch den Schweiß von Stirn und Schläfen, während ihre Kinder oder Enkelkinder auf sie zustürzen und sie zu einer der beiden Bänke mit insgesamt acht Sitzplätzen führen, die in dieser Wartehalle den Bedürftigen zugedacht sind. Der Weg vom Zug bis hierher war zu schwer, es gibt keine Rolltreppen, keine Gepäckwagen, die Wartezeiten an der Passkontrolle sind oft lang, Sitzgelegenheiten nicht vorhanden, die Luft ist schlecht. Dazu vielleicht die Angst wegen einem bisschen Schmuggel, Bücher oder Kassetten für die Enkel, wer weiß. Sie schaffen es bis hinter die Tür, gerade so.
An den Abenden finden sich auch jüngere Leute unter den einreisenden Ostmenschen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dringenden Familienangelegenheiten, mehr Frauen als Männer, wie mir schien. Die Kinder und der zurückgebliebene Elternteil stehen gespannt am Geländer, bis eines der Kinder einen Blick durch den Türspalt wirft und schreit: »Mama kommt.« Der Mann freut sich, weil die Frau wieder da ist, die Kinder mustern gierig Koffer und Tüten, die Frau, von den Geheimnissen des heimkehrenden Reisenden umgeben, strahlt eine leichte Überlegenheit aus – ein fast normales Bild.
Es kommt vor, dass ein Angehöriger des Grenzorgans durch die Tür tritt und sich einen Weg durch die Wartenden bahnt. Ich habe selten erlebt, dass einer von ihnen bittet, er wartet, bis man ihm aus dem Wege geht. Bittet er doch, murmelt er etwas Unverständliches durch den fast geschlossenen Mund. Auf keinen Fall lächelt er.
Zuweilen frage ich mich, was wohl ein Westmensch – in dem elektrisch erleuchteten Anzeigenkasten über der braunen Tür als Bürger der BRD, Bürger Berlin (West) oder Bürger anderer Staaten bezeichnet –, was die Sinne eines solchen Westmenschen wohl wahrnehmen, wenn sich das Eisentor zum ersten Mal in seinem Rücken schließt: unsere ihn gleichgültig und erbarmungslos taxierenden Blicke, die sieben Schilder, auf denen in schwarz-weiß-roter Bildersprache das Rauchen untersagt wird, der Gestank, der von den Toiletten aufsteigt, in die zwei der Eisentür gegenüberliegende Treppen führen, der graue schmutzige Fußboden … Kein Ort in der Stadtmitte wirkt trostloser, ungeschminkter. Was die Plakate an den Litfaßsäulen verheißen – Berlin, weltoffene Metropole –, beginnt erst einige Hundert Meter entfernt vom Sicherheitstrakt Bahnhof Friedrichstraße.
Vor zwanzig Jahren, als ich noch in unmittelbarer Nähe studierte, habe ich dem Schauspiel zwischen der schinkelschen Neuen Wache und der knobelsdorffschen Staatsoper zum letzten Mal zugesehen. Seitdem war diese leibhaftige Demonstration preußischer Geschichte eher ein Grund, die Stadt am Mittwoch zwischen zwei und drei zu meiden, wenn für eine halbe Stunde der Verkehr zwischen Friedrichstraße und Palast der Republik gesperrt, der Platz vor der Neuen Wache – heute Mahnmal für die Opfer des Faschismus und des Militarismus – von der Polizei mit Seilen eingezäunt wird. In mein Bild vom Stadtbezirk Mitte aber gehört die allwöchentliche Wachablösung ebenso wie die Straße, in der sie zu bestaunen ist: das architektonische Prunkstück preußischer Königsmacht Unter den Linden.
Also begebe ich mich an einem Mittwoch im September, eine Stunde vor Beginn des Spektakels, an den beschriebenen Ort. Vor einem klaren blauen Himmel strahlt in der herbstlichen Sonne weithin das frisch vergoldete Kreuz des Doms. Kaiserwetter, sagen alte Leute heute noch zu solchem Tag. Als ich um halb zwei vor der Wache ankomme, befestigen zwei Polizisten gerade die Seile, mit denen später der Bürgersteig abgesperrt wird, jetzt liegen sie noch schlapp auf den Steinen. Die ersten Zuschauer finden sich ein – an ihrem Dialekt identifiziere ich sie als Bewohner südlicher Regionen dieses Landes –, sie stellen sich auf einen Platz, den sie für den besten halten, offenbar bereit, ihn für die nächste Stunde nicht zu verlassen.
Auf der Promenade zwischen den beiden Fahrbahnen reitet in philosophisch-nachdenklicher Pose Eff Zwo. Kurz nach dem Krieg hatte man das Denkmal von Christian Daniel Rauch als Sinnbild militaristischer Preußenherrschaft nach Potsdam verbannt und vor sechs Jahren, nachdem die ältere deutsche Geschichte weniger emotional betrachtet, dafür auf ihre praktische Verwendbarkeit untersucht wurde, hierher, auf seinen seit 1851 angestammten Platz, zurückgebracht.
Der Platz vor dem Ehrenmal füllt sich; Schülergruppen, Touristen, drei Busse mit französischen Soldaten, ein Bus mit englischen und ein Bus mit amerikanischen Soldaten. Berlin – weltoffene Metropole.
Eine ungewohnte Stille beherrscht die Straße, der Verkehr ist umgeleitet. Bauarbeiter, die die Staatsoper für die 750-Jahr-Feier Berlins herrichten, stehen mit verschränkten Armen auf der Balustrade und sehen auf uns herab. Nur ein einzelner Zimmermann drischt rhythmisch auf das Dach der Oper ein, und ich, der Suggestion des Wartens erliegend, halte sein Hämmern für die Pauke des nahenden Musikcorps.
Dann, fünf Minuten vor halb drei, kommen sie wirklich. Mit Tschingderassabum und Tambourmajor biegen sie im preußischen Stechschritt aus der Universitätsstraße in die Linden ein. Die Augen unter den Stahlhelmen starr nach vorn gerichtet, marschieren sie an dem ihnen leicht zugeneigten Alten Fritz und an den Zuschauern vorbei.
Ich stehe inmitten einer französischen Reisegruppe, Frauen und Männer verschiedenen Alters, die dem Geschehen mit belustigten oder befremdeten Blicken folgen. Einige lachen. Der Zug ist vor dem Ehrenmal angekommen; es wird kommandiert, präsentiert, salutiert, marschiert.
Hinter mir fragt eine Frau ihren um einen Kopf größeren Mann, was die da vorne machen. »Faxen«, sagt der Mann.
Die Kapelle spielt »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit«.
Es war ein Jahr nach dem Krieg, als meine Mutter mich zum ersten Mal zu einer Maidemonstration mitnahm. Wir marschierten hierher, zum ehemaligen Lustgarten am östlichen Ende der Linden. Es gibt ein Foto, auf dem sind sie und ich zu sehen zwischen vielen anderen Leuten, mager und fröhlich wie wir, Überlebende des Krieges, der Konzentrationslager, der Emigration, der Illegalität, die alle eines wussten: Nie wieder Krieg!
Auch damals sangen wir das Lied »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit«. Keinem von denen, die auf dem Bild zu sehen sind, wäre es eingefallen, sein Bekenntnis zum Frieden durch ein preußisches Militärzeremoniell zu bestärken.
Ein älterer Franzose vor mir singt einige Takte mit, bricht, als der Rhythmus in einen forcierten Marsch wechselt, ab. Dann ist alles vorbei, Tambourmajor, Kapelle, Soldaten marschieren durch die Universitätsstraße zurück in die Kaserne am Weidendamm. Die Seile werden eingerollt, die Linden für den Verkehr wieder freigegeben, bis zum nächsten Mittwoch.
Eine Gruppe westdeutscher Mädchen unterhält sich noch verwundert über die sportliche Leistung der Wachsoldaten, die reglos wie Wachsfiguren links und rechts vom Eingang des Ehrenmals stehen.
»Ist alles Disziplin und Training«, sagt ein Mädchen. Ein anderes verweist auf die Guards vor dem Buckingham-Palast, die schließlich Ähnliches zu vollbringen hätten.
»Die fallen aber auch um wie die...
| Erscheint lt. Verlag | 4.10.2022 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | Belletristik • BRD • DDR • Debatte • Demokratie • Diskurs • Essayistik • Geschichte • Gesellschaft • Gesellschaftskritik • Joseph von Westphalen • Kunst • Kunstfreiheit • Literatur • Meinungsfreiheit • Politik • Schriftsteller • Schriftstellerin • Tagebücher |
| ISBN-10 | 3-455-01382-1 / 3455013821 |
| ISBN-13 | 978-3-455-01382-5 / 9783455013825 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich