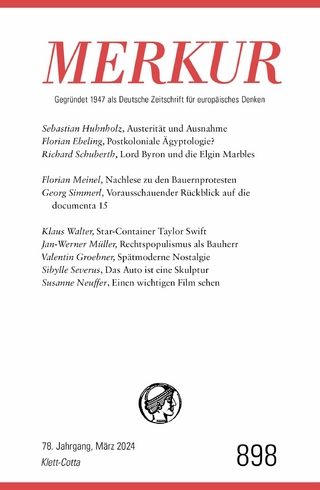Allein (eBook)
160 Seiten
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
978-3-446-27181-4 (ISBN)
Zu keiner Zeit haben so viele Menschen allein gelebt, und nie war elementarer zu spüren, wie brutal das selbstbestimmte Leben in Einsamkeit umschlagen kann. Aber kann man überhaupt glücklich sein allein? Und warum wird in einer Gesellschaft von Individualisten das Alleinleben als schambehaftetes Scheitern wahrgenommen?
Im Rückgriff auf eigene Erfahrungen, philosophische und soziologische Ideen ergründet Daniel Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Dabei leuchtet er aus, welche Rolle Freundschaften in diesem Lebensmodell spielen: Können sie eine Antwort auf den Sinnverlust in einer krisenhaften Welt sein? Ein zutiefst erhellendes Buch über die Frage, wie wir leben wollen.
Daniel Schreiber, geboren 1977, ist als Kunstkritiker für verschiedene internationale Zeitungen und Magazine tätig. Er ist Autor der Susan-Sontag-Biografie 'Geist und Glamour' (2007) sowie der hochgelobten Essays Nüchtern (2014), Zuhause (2017) und des Bestsellers Allein (2021). Er lebt in Berlin.
Das Leben allein
Wir saßen auf wackeligen Klappstühlen hinter dem Haus, tranken Kaffee, genossen die letzten warmen Strahlen der Spätsommersonne und schauten auf das verwilderte Grundstück, das einmal ein großer Schrebergarten gewesen war. Sylvia und Heiko hatten sich dieses Haus in der Nähe des Liepnitzsees, im Berliner Umland, gebaut. Es hatte einige Jahre gedauert, bis es fertig geworden war, doch nun waren sie und ihre kleine Tochter Lilith eingezogen und hatten ihrem Leben in Berlin endgültig den Rücken gekehrt. Ich hatte den Umzug mit gemischten Gefühlen verfolgt. Ich war mir nicht sicher, was die neue räumliche Entfernung für mein soziales Leben und vor allem für die Freundschaft bedeuten würde, die Sylvia und mich seit langem verband.
Seit Jahren schon hatte sich niemand mehr um diesen Garten gekümmert. Vor uns lag ein struppiges Feld aus Trockengräsern, Meldepflanzen und Brennnesseln, umgeben von dicht aneinandergedrängten, meterhohen Thujen. In der Mitte ragten drei große Kiefern in den Himmel, zwischendrin ein paar dürre Kirschlorbeer- und Rhododendronbüsche, mit sperrigen Ästen und spärlichen Blättern. Nur einige überraschend trockenresistente purpurne Kronen-Lichtnelken, etwas rosa Storchschnabel und orange-gelb leuchtende Sonnenaugenpflanzen konnten sich noch behaupten. Kurzentschlossen fragte ich Sylvia, ob ich dabei helfen könnte, den Garten neu zu gestalten. Ich kann nicht mehr genau sagen, warum sich das richtig anfühlte. Es hatte damit zu tun, dass ich mir von der Tätigkeit in der Natur, der Arbeit mit den Pflanzen, so etwas wie Erdung erhoffte. Vielleicht hatte ein Teil von mir den Eindruck, dass der desaströse Zustand des Gartens dem meines Lebens glich. Desaströs trotz aller Momente der Schönheit. In den vorangegangenen Monaten hatte sich in mir immer mehr das Gefühl verfestigt, dass ich etwas falsch gemacht hatte, dass ich in jungen Jahren einem verträumten Missverständnis erlegen war, was das Erwachsenenleben betraf, und dass sich die Auswirkungen dieses Missverständnisses erst jetzt wirklich zeigten.
Ich habe nie die bewusste Entscheidung getroffen, allein zu leben. Im Gegenteil, ich bin die längste Zeit davon ausgegangen, dass ich mit jemandem mein Leben teilen und zusammen alt werden würde. Ich habe früher eigentlich immer Beziehungen geführt, kürzere, längere und sehr viel längere, oft gingen sie ineinander über. Mit zweien meiner Partner habe ich zusammengewohnt und mit einem über Jahre hinweg eine gemeinsame Zukunft geplant. Die Wochen, in denen ich in jener Lebensphase allein war, fühlten sich oft wie eine Ewigkeit an, eine Ewigkeit, die ich mit Affären und One-Night-Stands füllte, mit romantischen Obsessionen, an die ich bis heute nur noch unwillig zurückdenke. Doch irgendwann war all das vorbei. Erst vergingen Wochen, dann Monate und schließlich Jahre, in denen ich keine Beziehungen führte und in denen schließlich auch die Affären immer seltener wurden. Hatte ich lange Zeit nicht allein sein können, schien ich das Alleinsein jetzt zu suchen.
Wenn ich mit meinen Freundinnen und Freunden darüber sprach, erklärte ich, es liege daran, dass ich früher einfach jünger, unvoreingenommener und risikofreudiger gewesen sei. Manchmal sagte ich, dass sich die schwule Welt des Liebens und Begehrens durch eine gewisse Gnadenlosigkeit auszeichne, die ab einem bestimmten Alter dafür sorge, dass man unsichtbar bleibe. Im Stillen fragte ich mich, ob ich psychisch nicht zu vorbelastet war, um wieder eine Beziehung zu führen, ob ich dafür überhaupt Platz in meinem Leben hatte, einem Leben, in dem ich viel arbeiten musste, um mich über Wasser zu halten, und viel Zeit für das Schreiben brauchte, mein eigentliches Projekt.
All das stimmte und ließ als Erklärung doch zu wünschen übrig. Denn an manchen Tagen glaubte ich zu ahnen, dass ich auch allein lebte, weil mir so etwas wie eine essenzielle Zuversicht fehlte. Ich hatte ganz grundsätzlich nicht den Eindruck, dass vor mir eine gute, eine vielversprechende Zukunft läge, eine Zukunft, die es sich zu teilen lohnte. Diese Hilflosigkeit betraf bei weitem nicht nur mein privates Leben. Die Folgen unüberbrückbarer wirtschaftlicher Ungleichheit, der wachsende Einfluss autokratischer Regime, der nach Meinung der meisten Wissenschaftler nicht mehr aufhaltbare Klimawandel — der Menschheit schien der Wille abhandengekommen zu sein, der Katastrophe, die sie erwartete, etwas entgegenzusetzen. Stattdessen gab sie sich ihr mit einem seltsam genussvollen Fatalismus hin. Jeder Dürresommer, jeder tropische Wirbelsturm, der ganze Landstriche und Inselstaaten zerstörte, jede Prognose über Hungersnöte, Fluchtbewegungen und in der Folge zusammenbrechende politische Systeme, jede Nachricht über die Untätigkeit der Regierungen der Welt machte mich noch hoffnungsloser. Immer wenn ich von den überraschenden Erfolgen politischer Desinformationskampagnen las, von Warnungen vor Cyber- und Bioterrorismus, vor neuen Viren und globalen Epidemien, die uns unvorbereitet treffen würden, verstärkte sich dieses Gefühl der Ausweglosigkeit.
Vielleicht ließ sich das, was ich empfand, am besten als eine »moral injury« beschreiben. Der Begriff stammt aus Studien über posttraumatische Störungen von Kriegsreporterinnen und -reportern und beschreibt eine Verletzung des inneren Realitätsverständnisses, die entsteht, wenn man grauenhafte Ereignisse miterleben muss, aber nicht eingreifen kann.1 Auch wenn unser Leben natürlich nicht mit dem jener Menschen vergleichbar ist, die aus Kriegen berichten, zeichnet es sich durch ein ähnliches Dilemma aus. Wir verfolgen das Grauen, das in der Welt geschieht und sind dabei weitgehend zu Tatenlosigkeit verdammt. Lange schon erschien es mir kaum möglich, das nicht als einen schmerzhaften Angriff auf meinen moralischen Kompass zu erfahren, auf mein Verständnis von mir und der Welt.
Ich liebe Gärten. Schon als kleines Kind habe ich meine Mutter, eine passionierte Gärtnerin, nach Pflanzennamen gefragt und selbstvergessen zwischen großen Obstbäumen und fedrigen Spargelpflanzen gespielt. Seit vielen Jahren fahre ich regelmäßig nach Bornim bei Potsdam, um mir den wunderschönen Garten des Staudenzüchters Karl Foerster anzuschauen. In Versailles kann ich stundenlang durch Jean-Baptiste de la Quintinies potager de roi spazieren. Sissinghurst Castle, der Landsitz und weitschweifige, nach Farbfamilien aufgeteilte Garten von Vita Sackville-West, raubt mir immer wieder den Atem. In den vergangenen Jahren hatte mich vor allem die Arbeit des niederländischen Gartendesigners Piet Oudolf fasziniert. Seine Gärten sind von einer wilden Schönheit. Sie gleichen rhythmischen Meeren aus Präriepflanzen, heimischen Stauden und Gräsern, in denen immer etwas blüht und die aufgrund der aparten Formen einiger Pflanzen selbst im Winter einladend wirken.
Oudolfs Gärten sprachen mich auf eine Weise an, die schwer in Worte zu fassen war. Sie stillten nicht nur mein Bedürfnis nach Rückzug, sie gaben mir auch das Gefühl, dass man den Widrigkeiten unserer Gegenwart etwas entgegensetzen konnte. Sie zeigten eine Möglichkeit auf, die Welt im Kleinen etwas schöner zu machen und wenigstens auf einer Parzelle Land die Grundlagen für eine bessere Zukunft zu legen. Die Möglichkeit, mit und in der Welt zu leben, mit der wir hadern.
Angeregt von Oudolf und seiner Gartenphilosophie schlug ich Sylvia und Heiko vor, das Grundstück um ihr Haus großflächiger umzugestalten. Ich besorgte mir seine Bücher und arbeitete sie systematisch durch. Das Ziel war ein ökologisch nachhaltiger Garten, der von Jahr zu Jahr weniger Arbeit bereiten würde, da die Pflanzen so gut aufeinander und auf ihren Standort abgestimmt sind, dass sie eine Art Mini-Ökosystem bilden. Ein Garten, der auch in heißen Sommern nur ein Minimum an Bewässerung benötigte.
Nach und nach machten wir uns ans Werk. Ich hatte einen Schlüssel zum Haus. Immer wenn es nötig war oder auch nur wenn es mir nicht so gut ging, setzte ich mich in den Regionalzug und fuhr an den Liepnitzsee. Wenn ich dort war, stand ich manchmal schon in aller Frühe auf, machte mir einen Kaffee und ging nach draußen. Die Arbeit mit den Händen wurde von einer Art geistigen Arbeit begleitet, das Bestellen des gärtnerischen Raums von einer Ausweitung meines mentalen Raums. Oder zumindest fühlte es sich so an.2
Ich musste in jenem Herbst oft an Jean-François Lyotards berühmte These vom »Ende der großen Erzählungen« denken. Lyotard hatte sie schon Ende der Siebzigerjahre in seinem Buch Das postmoderne Wissen aufgestellt. Mit dem »Ende der großen Erzählungen« meinte er keine literarischen Erzählformen, sondern beschrieb einen grundlegenden Glaubwürdigkeitsverlust,...
| Erscheint lt. Verlag | 27.9.2021 |
|---|---|
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Schlagworte | Allein • Autor • Beziehung • Corona • Covid • Depression • didion • Einsamkeit • Einzeln sein • Emotion • Essay • Familie • Freiheit • Freundschaft • Garten • Gärtnern • Gemeinschaft • Glück • Glücklich • Homosexuell • Isolation • Joan • Kochen • Lebensentwurf • Lebensmodell • Liebe • #ohnefolie • ohnefolie • Paar • Philosophie • Queer • Safranski • Scham • Schriftsteller • Schwul • sontag • Susan • Therapie • Wandern |
| ISBN-10 | 3-446-27181-3 / 3446271813 |
| ISBN-13 | 978-3-446-27181-4 / 9783446271814 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich