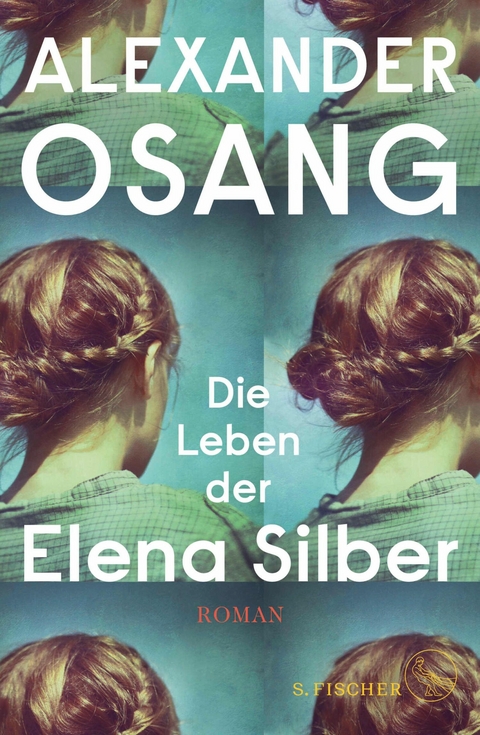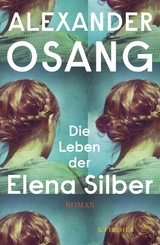Die Leben der Elena Silber (eBook)
624 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-491018-5 (ISBN)
Alexander Osang, geboren 1962 in Berlin, studierte Journalistik in Leipzig und arbeitete nach der Wende als Chefreporter der Berliner Zeitung. Für seine Reportagen erhielt er mehrfach den Egon-Erwin-Kisch-Preis und den Theodor-Wolff-Preis. Alexander Osang schreibt heute für den ?Spiegel? aus Tel Aviv, davor lebte er in Berlin und acht Jahre lang in New York. Sein erster Roman ?die nachrichten? wurde verfilmt und mit zahlreichen Preisen, darunter dem Grimme-Preis, ausgezeichnet. Im S. Fischer Verlag und Fischer Taschenbuch Verlag sind darüber hinaus die Romane ?Comeback?, ?Königstorkinder?, ?Lennon ist tot? und ?Die Leben der Elena Silber? erschienen, die Reportagenbände ?Im nächsten Leben? und ?Neunundachtzig? sowie die Glossensammlung ?Berlin - New York?. Literaturpreise: Theodor-Wolff-Preis 1995 Egon-Erwin-Kisch-Preis für die beste deutschsprachige Reportage 1993, 1999 und 2001 Reporter des Jahres 2009 TAGEWERK-Stipendium der »Guntram und Irene Rinke Stiftung« 2010
Alexander Osang, geboren 1962 in Berlin, studierte Journalistik in Leipzig und arbeitete nach der Wende als Chefreporter der Berliner Zeitung. Für seine Reportagen erhielt er mehrfach den Egon-Erwin-Kisch-Preis und den Theodor-Wolff-Preis. Alexander Osang schreibt heute für den ›Spiegel‹ aus Tel Aviv, davor lebte er in Berlin und acht Jahre lang in New York. Sein erster Roman ›die nachrichten‹ wurde verfilmt und mit zahlreichen Preisen, darunter dem Grimme-Preis, ausgezeichnet. Im S. Fischer Verlag und Fischer Taschenbuch Verlag sind darüber hinaus die Romane ›Comeback‹, ›Königstorkinder‹, ›Lennon ist tot‹ und ›Die Leben der Elena Silber‹ erschienen, die Reportagenbände ›Im nächsten Leben‹ und ›Neunundachtzig‹ sowie die Glossensammlung ›Berlin – New York‹. Literaturpreise: Theodor-Wolff-Preis 1995 Egon-Erwin-Kisch-Preis für die beste deutschsprachige Reportage 1993, 1999 und 2001 Reporter des Jahres 2009 TAGEWERK-Stipendium der »Guntram und Irene Rinke Stiftung« 2010
Beim Thema ›starke erste Sätze‹ ist er kaum zu toppen. Aber nicht nur das. [...] eine eindrucksvolle und manchmal sogar berührende Geschichte.
2 Berlin, Deutschland
Juni 2017
Seine Mutter hatte in der Stunde, die Konstantin Stein von Wien nach Berlin geflogen war, viermal angerufen. Viermal. Sie hatte keine Nachricht hinterlassen, das machte sie nie. Drei weitere Male rief sie an, als er am Gepäckband auf seinen Rollkoffer wartete. Das Handy summte an seinem Bein, als habe er eine Hummel in der Hosentasche. Er rief sie zurück, als er im Taxi saß.
»Was ist denn?«, fragte er.
»Wo bist du?«, fragte sie.
Zwei Fragen. Die klassische Eröffnung.
»Ich war in Odessa«, sagte er.
»Odessa«, rief seine Mutter. Sie sang es fast. Odääässsa.
Sie sprach kein Russisch, und sie war, soweit er wusste, auch nie in Odessa gewesen. Sie spielte eine Osteuropäerin, weil sie glaubte, es verleihe ihr mehr Seele. Er hätte dieses Fass öffnen können, hatte aber keine Lust und keine Kraft dazu. Er hatte vier Stunden Aufenthalt in Wien gehabt. Er hatte das Finale der French Open auf seinem Handy gesehen. Nadal ließ Wawrinka keine Chance. Wawrinka hatte all seine Kraft im Halbfinale gegen Murray gelassen. Das Halbfinale hatte er noch in Odessa gesehen, wo er sich für vierneunundneunzig ein Monatsabo des Eurosport-Players gekauft hatte. Aus Recherchegründen, wie er sich einredete. Diese hoch abspringenden Topspin-Bälle von Nadal auf die Rückhand zermürbten Wawrinka. Konstantin fühlte, wie er müder und müder wurde. Wie er selbst. Eine Folter eher als ein Tennisspiel.
»Ja«, sagte er.
»Wusstest du, dass Eisenstein dort seinen Panzerkreuzer gedreht hat?«
»Mmmh«, machte Konstantin. Es ärgerte ihn, wie seine Mutter »seinen Panzerkreuzer« sagte, als sei sie bei den Dreharbeiten dabei gewesen. Er war sich nicht mal sicher, dass sie den Film gesehen hatte. Außerdem fragte er sich, ob der Taxifahrer Umwege fuhr.
»Die Studios in Odessa waren weltberühmt. Noch vor Hollywood«, sagte seine Mutter.
»Fahren wir über Torstraße oder Bernauer?«, fragte Konstantin den Fahrer.
»Beides, Scheff«, sagte der Fahrer.
»Hörst du mir überhaupt zu?«, fragte seine Mutter.
»Ich habe mit dem Fahrer geredet«, sagte Konstantin.
»Du musst lernen, dass auch andere wissen, was sie tun«, sagte seine Mutter. »Stand schon in deiner Zeugnisbeurteilung. Vierte Klasse.«
»Fünfte.«
»Genau das meine ich«, sagte seine Mutter.
Konstantin fiel immer wieder auf sie herein. Dass er sich überhaupt an die Beurteilung erinnern konnte, war bedenklich.
Er sah aus dem Fenster. Männer in Unterhemden und Jogginghosen lehnten an Autos, verschleierte Frauen, Kinder auf Dreirädern, die aussahen wie kleine Formel-eins-Autos. Er wollte nicht Scheff genannt werden. Ein Wunsch, den man schwer aussprechen konnte. Nicht in diesem Taxi, nicht in dieser Gegend, schon gar nicht, wenn seine Mutter zuhörte, die größte proletarische Internationalistin von Berlin-Pankow, wo es vor proletarischen Internationalisten nur so wimmelte. Er sehnte sich nach Odessa zurück. Heute Vormittag hatte er noch im Schwarzen Meer gebadet. Es war klar gewesen und kalt. Die Leute am Strand erinnerten ihn an seine Kindheit.
»Weshalb hast du mich angerufen?«, fragte er.
»Bitte?«
»Ich hatte sieben Anrufe auf meinem Handy.«
»Sieben?«
»Ja.«
»Da siehst du mal, wie wichtig mir das ist.«
»Was?«, fragte Konstantin.
»Dein Vater.«
Draußen erschienen die Bayer-Werke. Hinter der Fabrik gab es am Wasser, am Rande einer dieser Townhaus-Siedlungen, die in Berlin wie Pilze aus dem Boden schossen, eine kleine Tennisanlage, auf der er Bogdan beobachtet hatte, als der einen Direktor der Chemiefabrik trainierte. Eins dieser sechzigjährigen Testosteron-Monster, die Bogdan mit derselben Gelassenheit ertrug wie die verzogenen Kinder am Jahn-Sportpark. Das Taxameter stand bei siebzehn Euro.
»Bist du noch da?«, fragte seine Mutter.
»Ja«, sagte er.
»Wir haben einen Heimplatz gefunden«, sagte sie.
»Ihr geht ins Heim?«, fragte er.
»Dein Vater«, sagte sie. »Wir haben einen Platz in dem Heim gefunden, das wir uns immer gewünscht haben.«
»Ihr?«
»Ja.«
»Aber nur er geht?«
»Es ist ganz in der Nähe. Am Bürgerpark.«
»Babas Heim?«
»Ja, aber es ist nicht wiederzuerkennen. Und er hat ein Einzelzimmer. Mit Blick auf den Park. Ich habe das mit Herrn Breitmann so durchgesprochen«, sagte sie. Sie jubelte, was nie ein gutes Zeichen war.
»Wer ist denn Herr Breitmann?«, fragte er.
»Der Heimleiter. Ein wunderbarer Mann. Papa und er werden sich gut verstehen.«
»War nicht immer der Plan, dass ihr gemeinsam geht?«
»Man kann ein Leben nicht planen. Die Krankheit hat ja kein System. Sie ist nicht gerecht. Man muss handeln, bevor sie uns beide zerstört. Unser Verhältnis. Unsere Beziehung.«
»Wer sagt denn das? Die Apotheken-Rundschau?«
»Diese Plätze in guten Heimen sind Gold wert. Und wenn du uns einen Gefallen tun willst, dann unterstütze uns auf diesem Weg«, sagte seine Mutter.
»Euer Weg?«, sagte er. »Es ist dein Weg. Es ist immer nur dein Weg.«
Der Taxifahrer musterte ihn im Rückspiegel. Wahrscheinlich war er zu laut geworden. Sie fuhren die Chausseestraße entlang. Je wütender er wurde, desto gelassener wurde seine Mutter. So war es immer. Sie redete ihn in seine Wut hinein wie in eine Schuld.
»Das Gute ist, ich kann deinen Vater jeden Tag besuchen. Es ist ja praktisch um die Ecke. Und du hast es auch nicht so weit«, sagte sie.
Er atmete ein. Und aus. Und ein. Und aus.
»Was sagt denn Papa?«
»Ich geb ihn dir mal«, sagte seine Mutter.
»Was gibt’s?«, fragte sein Vater.
»Willst du wirklich in das Heim?«, fragte Konstantin.
»Gute Heime sind Gold wert«, sagte sein Vater. Vielleicht war das ironisch gemeint, vielleicht auch nicht. Im Hintergrund redete seine Mutter weiter. Er verstand nur Breitmann und Parkblick.
»Ja, aber willst du?«, fragte er.
»Darum geht’s doch nicht«, sagte sein Vater.
»Nur darum geht’s.«
»Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit«, sagte sein Vater.
Es war ein Spruch. Er hangelte sich an Sprüchen durch den Nebel. Friedrich-Engels-Zitate waren eher die Ausnahme. Meistens waren es Dinge, die er in der Werbung aufschnappte. Geiz ist geil. Wer wird denn gleich in die Luft gehen. Ich soll Sie schön grüßen. Wenn einem so viel Gutes wird beschert. Er sagte: Wild ist der Wind mit Anna Magnani. Er sagte: Wir haben immer noch Paris. Er sagte: Ich liebte ein Mädchen auf dem Mars. Er sagte: Jeder Mann an jedem Ort, einmal in der Woche Sport.
Konstantin hatte mit seinem Vater seit langem kein ernsthaftes Gespräch geführt. Sie machten Witze. Sie bewarfen sich mit Zitaten. Es war ihre Art, mit dem Vergessen umzugehen, das seine Mutter »die Krankheit« nannte.
Vor etwa zehn Jahren hatte sein Vater angefangen, Dinge zu sehen, die niemand anderes sah. Manchmal erschienen blonde Mädchen im Wald, manchmal fand unter seinem Fenster ein Fußballspiel statt, das nur er wahrnehmen konnte. Vor etwa fünf Jahren begann er, sich zu verfahren. Der Verkehr schien ihn zu überfordern. Es passierten zu viele Dinge gleichzeitig. Seine Frau war eine nervöse Beifahrerin. Er gab seinen Führerschein ab und verkaufte das Auto. In großen Familienrunden schaltete er ab, sein Kinn sackte, sein Mund stand offen, sein Blick wurde trübe. Seine Frau begann, für ihn zu sprechen, Fragen zu beantworten, die ihm gestellt wurden. Sie trat ihn unauffällig unterm Tisch. Sie sagte Einladungen ab. Sie begann, sich für Alzheimerfilme zu interessieren. Es gab da erstaunlich viel. Ein richtiges Genre. Sie sah Christiane Hörbiger, Klaus Maria Brandauer und Didi Hallervorden beim Vertrotteln zu, während ihr Mann aus dem Fenster schaute und die Vögel beobachtete. Sein Vater war ein bekannter Tierfilmer gewesen, sein letzter Film lag fünfzehn Jahre zurück. Er hatte den Weg eines Fuchses nach Berlin beschrieben. »Reineke zieht in die Stadt«. Ein Achtungserfolg. Ein bisschen unkonzentriert, hatten die Kritiker geschrieben, wahrscheinlich hatte »die Krankheit« bereits an ihm genagt.
Seitdem arbeitete er an einem Projekt über die Veränderung der Vogelwelt in Berlin. Was genau das bedeutete, ließ er im Unklaren. Er hatte sich die Haltung bewahrt. Mama sieht ihren Demenzkitsch, sagte er am Telefon, wenn seine Frau nebenan im Wohnzimmer Julianne Moore als alzheimerkranke Professorin bestaunte. Sie schleppte ihn zu Ärzten, die ihn Fragebögen ausfüllen ließen und sein Gehirn scannten. Pausenlos musste er Uhren aufmalen. Es war kein Problem für ihn, eine Uhr aufzumalen. Es gab aber irgendwelche Veränderungen auf seinen Gehirnbildern, weiße Stellen, erklärte seine Frau zu Weihnachten vor der gesamten Familie so stolz, als sei es ihr Verdienst, als hätte sie die weißen Löcher im Kopfkosmos ihres Mannes entdeckt wie eine Astronomin. Ihre Schwester, seine Tante Vera, die Ärztin war, wenn auch Gastroenterologin, nickte ernst.
Sein Vater saß immer mit am Tisch. Nachsichtig lächelnd. Er ertrug es, das ständige Gerede. Er rannte nicht nackt in die Kaufhalle, aber manchmal kehrte er von seinen Vogelbeobachtungen lange nicht zurück. Seine Mutter rief dann Konstantin an, drängelte am Telefon, wollte eine Vermisstenmeldung bei der Polizei aufgeben. Rief immer wieder bei ihm an. Meistens kam sein Vater während eines dieser Telefonanrufe zur Tür herein. Lächelnd, so stellte sich Konstantin das vor. Was gibt’s? Warum so aufgeregt? Seine Mutter legte dann einfach den Hörer auf. Mitten im Gespräch. So beendete sie auch...
| Erscheint lt. Verlag | 14.8.2019 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | 20. Jahrhundert • Anspruchsvolle Literatur • Buchgeschenk • DDR • Deutscher Buchpreis • Deutschland • Drittes Reich • Ein Buch von S. Fischer • Familie • Familienepos • Frauen • Frauenleben • Generationen • Geschichte • Großmutter • Longlist • Longlist Deutscher Buchpreis • Provinz • Russland • Vergangenheit • Weihnachten • Weihnachtsgeschenk • Wiedervereinigung |
| ISBN-10 | 3-10-491018-9 / 3104910189 |
| ISBN-13 | 978-3-10-491018-5 / 9783104910185 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich