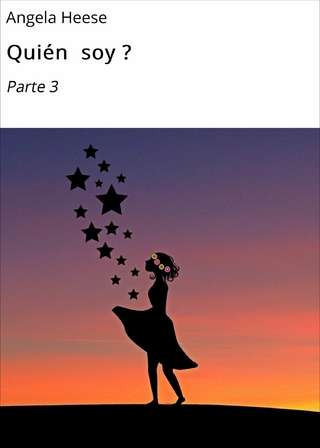Kafka (eBook)
736 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-401021-2 (ISBN)
Reiner Stach, geboren 1951 in Rochlitz (Sachsen), arbeitete nach dem Studium der Philosophie, Literaturwissenschaft und Mathematik und anschließender Promotion zunächst als Wissenschaftslektor und Herausgeber von Sachbüchern. 1987 erschien seine Monographie ?Kafkas erotischer Mythos?. 1999 gestaltete Stach die Ausstellung ?Kafkas Braut?, in der er den Nachlass Felice Bauers präsentierte, den er in den USA entdeckt hatte. 2002 und 2008 erschienen die ersten beiden Bände der hochgelobten dreiteiligen Kafka-Biographie. 2008 wurde Reiner Stach für ?Kafka: Die Jahre der Erkenntnis? mit dem Sonderpreis zum Heimito-von-Doderer-Literaturpreis ausgezeichnet. Für sein herausragendes Gesamtwerk auf dem Feld der literarischen Biographik erhielt er 2016 den Joseph-Breitbach-Preis. Literaturpreise: 2003 Kulturförderpreis des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land 2008: Sonderpreis zum Heimito von Doderer-Literaturpreis 2016: Joseph-Breitbach-Preis
Reiner Stach, geboren 1951 in Rochlitz (Sachsen), arbeitete nach dem Studium der Philosophie, Literaturwissenschaft und Mathematik und anschließender Promotion zunächst als Wissenschaftslektor und Herausgeber von Sachbüchern. 1987 erschien seine Monographie ›Kafkas erotischer Mythos‹. 1999 gestaltete Stach die Ausstellung ›Kafkas Braut‹, in der er den Nachlass Felice Bauers präsentierte, den er in den USA entdeckt hatte. 2002 und 2008 erschienen die ersten beiden Bände der hochgelobten dreiteiligen Kafka-Biographie. 2008 wurde Reiner Stach für ›Kafka: Die Jahre der Erkenntnis‹ mit dem Sonderpreis zum Heimito-von-Doderer-Literaturpreis ausgezeichnet. Für sein herausragendes Gesamtwerk auf dem Feld der literarischen Biographik erhielt er 2016 den Joseph-Breitbach-Preis. Literaturpreise: 2003 Kulturförderpreis des Landschaftsverbandes Osnabrücker Land 2008: Sonderpreis zum Heimito von Doderer-Literaturpreis 2016: Joseph-Breitbach-Preis
{17}Selbstverlassenheit
Eigenartig, welches Gefühl der Einsamkeit
im Misserfolg liegt.
Karel Čapek, DER METEOR
»Nicht so schreiben Felice. Du hast Unrecht. Es sind Missverständnisse zwischen uns, deren Lösung allerdings ich bestimmt erwarte, wenn auch nicht in Briefen. Ich bin nicht anders geworden (leider), die Wage, deren Schwanken ich darstelle, ist die gleiche geblieben, nur die Gewichtsverteilung ist ein wenig verändert, ich glaube, mehr über uns beide zu wissen und habe ein vorläufiges Ziel. Wir werden Pfingsten darüber sprechen, wenn es möglich sein wird. Glaube nicht, Felice, dass ich nicht alle hindernden Überlegungen und Sorgen als fast unerträgliche und widerliche Last empfinde, alles am liebsten abwerfen wollte, den geraden Weg allen andern vorziehe, gleich und jetzt im kleinen natürlichen Kreis glücklich sein und vor allem glücklich machen wollte. Es ist aber unmöglich, die Last ist mir nun einmal auferlegt, die Unzufriedenheit schüttelt mich und sollte ich auch das Misslingen ganz klar vor Augen haben, und nicht nur das Misslingen sondern auch den Verlust aller Hoffnungen und das Heranwälzen aller Verschuldung – ich könnte mich wohl nicht zurückhalten. Warum glaubst Du übrigens Felice – es scheint wenigstens dass Du es manchmal glaubst – an die Möglichkeit eines gemeinsamen Lebens hier in Prag. Früher hattest Du doch schwere Zweifel daran. Was hat sie beseitigt? Das weiss ich noch immer nicht.« [3]
›The Impossibility of Being Kafka‹ lautet der Titel eines Essays, den die amerikanische Erzählerin Cynthia Ozick im New Yorker veröffentlichte. [4]Die Unmöglichkeit, Kafka zu sein – eine Überschrift, die verblüfft und die dennoch einleuchtet, weil sie unterschwellig jenes vertraute Porträt eines neurotischen, hypochondrischen, skrupulösen, in jeder Beziehung schwierigen und empfindlichen Menschen heraufbeschwört, der ewig um sich selbst kreist und dem schlechthin alles zum Problem wird. Es ist das Bild, das dem Bildungsfundus der westlichen Welt seit langem sich eingebrannt hat, und so tief, {18}dass Kafka schließlich zum Urbild jenes Typus geworden ist, zum paradigmatischen Fall einer weltfremden, sich selbst verzehrenden Innerlichkeit.
Dass es unmöglich ist, Kafka zu sein – er selbst hätte diese Behauptung lächelnd und ohne zu zögern beglaubigt. Ja, unmöglich, und überhaupt zählte dieses Wort zu jenen für Kafka charakteristischen Adjektiven, die ihm auch in überraschenden Zusammenhängen leicht von der Zunge gingen und denen er stets einen geheimen Hintersinn verlieh. Es schien ihn nicht zu bekümmern, dass er damit den Verdacht des notorischen Übertreibens weckte und Freunde und Familie immer wieder gegen sich aufbrachte. Denn er verharrte ja gegenüber den Schwierigkeiten des Lebens keineswegs in duldender Passivität, was seinen eigenen Klagen zufolge, hätte man sie nur ernst nehmen können, doch wohl das Konsequenteste gewesen wäre. Vielmehr erledigte er das soeben noch für unmöglich Erklärte fast stets zur allgemeinen Zufriedenheit, bisweilen sogar aus eigenem Antrieb und ohne dass man ihn hätte drängen müssen. Er zeigte ein durchaus pragmatisches, bisweilen sogar ironisches Verhältnis zum Unmöglichen, und wer ihn nur flüchtig kannte, konnte durchaus auf den Gedanken verfallen, hier wolle sich jemand schwieriger machen, als er ist. » … man darf sich vor den kleineren Unmöglichkeiten nicht hinwerfen«, begründete Kafka diesen Widerspruch, »man bekäme ja dann die grossen Unmöglichkeiten gar nicht zu Gesicht.« [5]Das leuchtete ein. Aber meinte er das nun ernst?
Auch Max Brod, der ja Kafka aus frühesten Studententagen kannte, vermochte es letztlich nicht, ihn in diesem Punkt zu durchschauen. Unzählige Male hatte er sich als geduldiger Zuhörer von Kafkas Lamento bewährt, dessen schwankenden Willen ebenso ertragen wie die niemals schlafenden Skrupel, die noch die gewöhnlichsten Entscheidungen benagten. Und Brods Geduld rührte aus der allmählich wachsenden Erkenntnis, dass all die Hindernisse, die der Freund vor sich auftürmte, nicht einfach hypochondrische Hirngespinste waren, vielmehr einem übermächtigen, niemals zu beschwichtigenden Willen zur Vollkommenheit entsprangen. Kafka wollte Perfektion, im Größten wie im Kleinsten, und Perfektion war unmöglich – das konnte Brod weder bestreiten, noch wäre es ihm in den Sinn gekommen, jenes utopische Verlangen von vornherein als weltfremd oder gar lebensfeindlich abzutun. Aber ein Manuskript in den Ofen {19}werfen, weil es nicht vollkommen ist? Auf einen Beruf, eine Reise, eine Frau verzichten, weil man selbst nicht vollkommen ist? Das war unverantwortlich, fand Brod, und auch unter moralisch strengen Maßstäben nicht zu rechtfertigen. Denn Kafkas Rigidität musste sich letztlich gegen ihn selbst wenden, sie war selbstzerstörerisch, da sie doch auch das Mögliche, ja selbst das Einfachste unmöglich machte.
Aber Kafka lebte doch. Und darum war es ganz unlogisch, die anhaltenden literarischen, sozialen und vor allem die erotischen Probleme des Freundes allein auf dessen Sucht nach Vollkommenheit zurückzuführen. Wäre das tatsächlich der Quell allen Unglücks, argumentierte Brod, dann stelle sich die Frage, warum ihm dieser Perfektionswille nicht auch alles Übrige unmöglich mache, das Alltägliche, die Büroarbeit, ja sogar das Essen. »Das ist richtig«, antwortete Kafka trocken. »Zwar ist das Vollkommenheitsstreben nur ein kleiner Teil meines grossen gordischen Knotens, aber hier ist jeder Teil auch das Ganze und darum ist es richtig was Du sagst. Aber diese Unmöglichkeit besteht auch tatsächlich, diese Unmöglichkeit des Essens u.s.w. nur dass sie nicht so grob auffallend ist wie die Unmöglichkeit des Heiratens.« [6]Ja, das war Kafka. Man kam ihm nicht bei. Und vielleicht erinnerte sich Brod bei der Lektüre dieser ebenso abgeklärten wie unglücklichen Zeilen daran, dass er kaum je einen Text des Freundes gelesen hatte, in dem nicht Unmögliches geschah.
Ihr einstiger Verlobter habe sich verändert, befand Felice Bauer im Frühjahr 1915, und vermutlich war es die Veränderung der eigenen Situation, die ihr den Blick dafür schärfte. Sie war längst nicht mehr die »kindische Dame«, als die sie sich einmal gegenüber Kafka übermütig präsentiert hatte, und ihr gewohnheitsmäßiger Optimismus war erodiert unter dem Druck familiärer Katastrophen. Der geliebte und einzige Bruder, wegen einer Unterschlagung nach Amerika geflohen, ließ wenig von sich hören. Würde sie ihn jemals wiedersehen? Der Vater, ein schwacher Charakter, dessen Gegenwart aber trösten konnte, war plötzlich einem Infarkt zum Opfer gefallen, mit nur 58 Jahren, und die Trauer Felices und ihrer Schwestern reichte gewiss tiefer als die der Mutter. Auch ihre leitende Position in der Berliner Lindström A. G., auf die ihr Verlobter so stolz war, als sei es seine eigene, hatte sie mittlerweile eingebüßt. Denn für Herbst 1914 war ja die Hochzeit geplant, in Prag wollte sie ein neues Leben beginnen, ein {20}Leben ohne Büro, wie es den Ehekonventionen entsprach, und darum hatte sie fristgerecht gekündigt. Und musste noch froh sein, jetzt, da alle Pläne sich zerschlagen hatten, in der eben erst begründeten ›Technischen Werkstätte‹ unterzukommen, einem nicht sehr bedeutenden Zulieferbetrieb für Feinmechanik, der auf den deutschen Handelsmessen gewiss keiner eleganten Repräsentantin bedurfte und nach dem auch Kafka nur selten fragte.
Dieses abnehmende Interesse an Felices äußerem Leben, dessen Einzelheiten er noch im vergangenen Jahr beständig angemahnt und wie eine Droge aufgesaugt hatte, war jedoch keineswegs die einzige auffallende Veränderung, die sie inmitten all des übrigen Kummers bedrückt zur Kenntnis nehmen musste. Im Januar hatten sie sich im Grenzort Bodenbach getroffen, mit der Hoffnung auf Verständigung, vielleicht Versöhnung, doch Kafka blieb reserviert, verweigerte jede körperliche Näherung und stellte stattdessen bohrende Fragen, die sie nicht beantworten konnte. So schleppte sich die Korrespondenz in unregelmäßigen, teils wochenlangen Abständen fort, ein dürftiges Rinnsal, gemessen an dem hitzigen Briefstrom, den Kafka damals, nach der ersten Begegnung im Herbst 1912, sogleich entfesselt hatte. Und dennoch behauptete er, »nicht anders geworden« zu sein. Während doch beinahe jede einzelne Briefzeile das Gegenteil bezeugte.
Einstmals hatten Felices Mutter und ihre Schwester Toni ein wenig mitgelesen, heimlich, doch ohne Gewissensbisse; es gab einen kleinen Familienskandal, danach wurden Kafkas Briefe sicherer verwahrt. Diesen Brief hingegen durfte man offen liegen lassen: eine für jeden Außenstehenden vollkommen unverständliche Meta-Klage, aus der die forschende Mutter noch nicht einmal den bürgerlichen Status jener unseligen Beziehung hätte herausbuchstabieren können. Es war, als liefere Kafka nur noch einige wenige, dünn gestrichelte Umrisse, als verweise er auf eine von Tausenden von Seufzern eingegrabene emotionale Spur, in der Überzeugung, die Adressatin werde das farbige Ausmalen der Details dann schon allein besorgen. Nicht, dass er Vagheiten und Andeutungen je gemieden hätte. Doch dieser Brief ist der erste, der Satz für Satz aus Chiffren und Kürzeln errichtet ist, ein geistiges Stenogramm, das vielfach Besprochenes, vielfach Wiederholtes beschwört, ohne der Leserin einen einzigen Anhaltspunkt dafür zu bieten, ob sie bei der Dechiffrierung das Richtige erraten hat.
»Es sind...
| Erscheint lt. Verlag | 5.10.2010 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Literatur ► Lyrik / Dramatik ► Lyrik / Gedichte | |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft | |
| Schlagworte | ARD-Serie Kafka • Berlin • Biografie • Biographie • Daniel Kehlmann • David Schalko • Dora Diamant • Erster Weltkrieg • Franz Kafka • Heizer • Hungerkünstler • Klassiker der Moderne • Landarzt • Marienbad • Matliary • Max Brod • Nachlass • Ottla Kafka • Prag • Proceß • Sanatorium • Schloss • Verwandlung • Wien • Zürau |
| ISBN-10 | 3-10-401021-8 / 3104010218 |
| ISBN-13 | 978-3-10-401021-2 / 9783104010212 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,4 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich