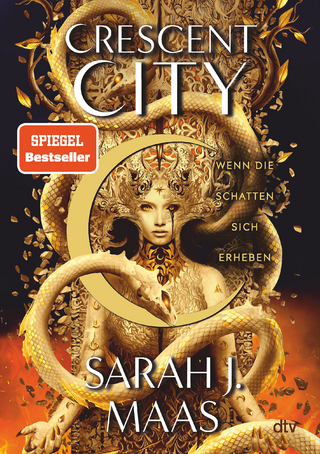Hell wie der Mond und tief wie der Ozean
Francke-Buchhandlung (Verlag)
978-3-86827-542-1 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Melissa fest, als sie mit ihrer chaotischen Familie zurück nach Anna Maria, Florida, zieht. Plötzlich wird sie nicht mehr wie früher gemobbt, sondern sie ist beliebt und Teil der angesagtesten Clique der Schule. Doch es gibt nicht nur den umschwärmten Sam, der Melissas Leben aufmischt. Da ist noch Robby, ihr verpeilter Außenseiter-Bruder; Josh, ihr geheimnisvoller Nachbar - und dieser Jesus, der im Leben von Josh offenbar eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt ...
Auf wen kann Melissa sich verlassen, als es hart auf hart kommt?
Nicole Quigley wuchs auf der Insel Anna Maria, Florida, auf. Dort spielt auch die Handlung ihres ersten Buches 'Hell wie der Mond und tief wie der Ozean', für den sie den ACFW Carol Award für den besten Jugendroman erhielt. Nicole Quigley studierte Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und hat viele Jahre in Washington, D.?C., gearbeitet. Mittlerweile lebt und schreibt sie wieder auf ihrer Heimatinsel Anna Maria.
Kapitel 1 Wenn die Leute wissen wollen, was am Anfang meines Abschlussjahres in der Schule passiert ist, dann stellen sie immer nur eine einzige Frage. Sie fragen immer nur, was seine letzten Worte waren. Irgendwie müssen es bedeutungsvolle Worte gewesen sein, das stellen sie sich jedenfalls vor. Die Art von letzten Worten, die ein Mädchen selbst Jahre nach dem Schulabschluss nicht vergisst. Atemlos warten sie auf den Teil in der Geschichte, wo ich beschreibe, wie er vom Boot gesprungen ist, mitten hinein in das vom Mondlicht beschienene dunkle Wasser. Nur das Weiße seiner Haut war danach noch für einen kurzen Moment im Wasser zu sehen. „Er wollte sich bestimmt umbringen“, sagen sie bei diesem Teil der Geschichte immer. „Warum wäre er sonst ins Wasser gesprungen, er hat doch gewusst, dass ihn keiner retten konnte?“ Und dann erzähle ich weiter, genau so, wie sie es von mir erwarten. Ich erzähle davon, wie ich verzweifelt die Wasseroberfläche absuche in der Hoffnung, seinen Kopf irgendwo zu entdecken. Wie ich selbst ins Wasser springe und zehn Meter schwimme, bevor mir bewusst wird, dass ich das Boot hinter mir kaum noch sehen kann – das Einzige, das mich vor der dunklen, lockenden Tiefe retten kann. Sie wollen hören, wie schwer es war, sich zum Boot zurückzukämpfen, und wie heftig der Sturm bereits tobte, als ich es endlich erreicht hatte. Sie wollen hören, wie ich panisch die Schränke nach einem Funkgerät durchwühlte und keines fand. Wie ich nach einer Leuchtpistole suchte, aber auch damit keinen Erfolg hatte. Und wenn ich ihnen all das erzähle, dann fragen sie nie – und ich erwähne es auch nicht –, dass sich das alles in vollkommener Stille abspielte. Um ehrlich zu sein: Er hat nichts gesagt, bevor er gesprungen ist. Und ich habe nicht einmal seinen Namen gerufen. Ich wusste sofort, dass er untergetaucht war, damit ich ihn nicht finden konnte. Als der Sheriff sein Boot neben meins steuerte und festmachte, waren Stunden vergangen. Stunden, in denen ich nicht weiter hörte als die Natur um mich herum und die Stille. Der Sheriff zog mich aus meinem Versteck unter dem Steuer, wo ich mich in meiner Verzweiflung hingekauert und gewartet hatte. Um uns herum und in unserem ganzen Staat tobte in dieser Nacht der Hurrikan Paul. In dieser Geschichte geht es nicht um Selbstmord. Aber als ich siebzehn war, nahm sich der einzige Junge, der mich je bei meinem ganzen Namen genannt hatte, das Leben. Es war das erste Mal, dass ich mit einem Fehler konfrontiert wurde, den man nicht wieder rückgängig machen konnte – weder mit Tipp-Ex noch mit Nachsitzen nach der Schule. Egal, was ich den Rest meines Lebens tun werde – diese Tatsache werde ich niemals ändern können. Eigentlich geht es in dieser Geschichte um drei Jungs. Um einen, der mich geliebt hat. Um einen, der das nicht konnte. Und um einen, der nicht wusste, wie. Mein Name ist Melissa Keiser und ich bin auf der Insel Anna Maria in Florida aufgewachsen. Die beste Beschreibung für diesen Ort ist seine Temperatur: 26° C. Natürlich sind es nicht immer 26°?C auf der Insel. Doch die Schwüle in der Luft, verbunden mit dem schwachen, aber widerlich süßen Geruch der Orangensaftfabrik, führt dazu, dass sich alles anfühlt, als wäre es in eine warme Decke gehüllt. Eine Decke, die gerade warm und weich genug ist, dass man schläfrig wird und sich sicher fühlt, die aber jede deiner Bewegungen unendlich langsam und anstrengend macht. Trotzdem ist es die schönste Stadt am Strand, die ich je gesehen habe. Doch dann kommt Wind auf und du merkst, dass du dich vor dem wahren Leben hinter einer Sanddüne versteckst. Die Insel, über die ich schreibe, kann man nicht vergleichen mit der Insel, die man im Internet findet. Dort gibt es nur die Bilder, die die Yankees oder die grauhaarigen Touristen aus Kanada gepostet haben. Diese Besucher lieben die Insel, wie man nur einen Ort lieben kann, an dem man noch nie gelitten hat. Auf solchen Bildern sieht man Dinge wie Seesterne und Sandburgen und Vögel im Sonnenuntergang. Wenn man den Touristen begegnet, dann bewundern sie die leuchtend bunten Blumen, die wie Unkraut in jedem Graben wachsen, oder die riesigen Fischreiher. Danach setzen sie sich auf die überdachten Sonnendecks der Restaurants am Strand und essen frisch gegrillten Zackenbarsch. Die Insel ist wirklich ein Ort, der so voll ist mit grenzenloser Schönheit, dass ihre Bewohner sogar die glänzenden Pfauen in die benachbarten Städte vertrieben haben, weil sie als Störung empfunden wurden. Das kann man sich nur erlauben, wenn man sich sehr sicher ist, dass man im Wettkampf der schönsten Strandorte ziemlich weit oben steht. Aber die Bilder im Internet zeigen nicht, wie das Leben in diesem Jahr für mich war und für die anderen, die auf der Insel lebten. Für die Touristen sind wir nur so etwas wie Ausstellungsstücke. Insgeheim fragen sie sich wahrscheinlich, wie es wohl wäre, wenn man seine Kinder an einem Ort großzieht, wo man nur dreißig km/h fahren darf und jeder Laden geschlossen wird, wenn in der Schule ein Footballspiel stattfindet. Und wir tun ihnen den Gefallen und zeigen ihnen, wie man Krabben mit bloßen Händen anfasst. So etwas passiert, wenn man ständig Menschen trifft, die nur zwei Wochen auf der Insel verbringen. Sie kommen, um Urlaub zu machen und Spaß zu haben. Dabei erinnern sie uns immer wieder daran, wie wunderschön die Insel ist, verglichen mit den Orten, aus denen sie kommen. Dort ist man schon froh, wenn man einen Park in der Stadt hat oder einen Baum, an dessen Ästen noch Blätter hängen. Doch wenn die Unterhaltung beendet ist, schaffen wir es trotzdem nicht auf ihre Bilder. In den letzten Jahren haben diese Touristen nach und nach die Stadtviertel meiner Kindheit zerstört – Haus für Haus – und stattdessen große, rosa verputzte Häuser gebaut, die sich normale Menschen wie meine Familie gar nicht leisten können. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Jetzt stehen diese neuen Winterdomizile sechs Monate im Jahr leer, während die Inselbewohner in Betonblöcke auf dem Festland umziehen, weil die Miete dort noch bezahlbar ist. Es ist schon seltsam. Da soll man diese Touristen lieben, weil wir letztendlich von ihnen leben, und doch weiß man gleichzeitig, dass immer weniger Platz für uns ist, je mehr von ihnen kommen. Ich schreibe nicht über die Insel, die man auf Google findet, sondern über die, auf der es immer noch eine gewisse Anzahl an Bewohnern gibt, die es geschafft haben, weiter auf diesem zehn Kilometer breiten wunderschönen Landstreifen zu wohnen, ohne dass es die reichen Leute merken. Als meine Mutter vor über einem Jahr nach drei Jahren im Norden mit uns zurück auf die Insel zog, hatte ich das Gefühl, von einer Flutwelle mitgerissen zu werden, ohne schwimmen zu können. „Wann kommst du nach Hause?“ Sofort bereute ich den Unterton in meiner Stimme, denn ich wusste, was jetzt kommen würde. „Das geht dich gar nichts an“, brüllte Denise ins Telefon, um die Band zu übertönen, die im Hintergrund gerade zu spielen anfing. „Ich habe zehn Dollar auf den Küchentisch gelegt. Geh in den Laden und kauf für dich und deine Schwester etwas fürs Abendessen.“ Meine Mutter war davon überzeugt, dass zehn Dollar die Antwort auf fast alles war, was mich bedrückte – egal, was es war. Mit Robby war sie nie so umgegangen. Mein älterer Bruder musste nie babysitten. Er war allerdings auch nie lange genug zu Hause, dass wir auf diese Idee hätten kommen können. „Ich möchte aber nicht die ganze Nacht hier sein, Mama.“ „Du hast keine andere Wahl, Missy. Ich muss jetzt Schluss machen.“ Ich hörte gerade noch die ersten Akkorde der Band, bevor meine Mutter auflegte. Vielleicht würde sie heute Abend im Restaurant wenigstens viel Trinkgeld bekommen. Resigniert wandte ich mich meiner Schwester zu. „Zum Abendessen sind wir wieder nur zu zweit, Crystal. Zieh deine Schuhe an. Wir müssen etwas zu essen einkaufen.“ Sie kämpfte mit der Schnalle an ihren Sandalen, bis ich mich schließlich hinhockte und ihre Hände zur Seite schob. Diese Dinge waren immer einfach, wenn ich sie selber machte. Meine Schwester war noch zu klein, um mir bei irgendwas zu helfen, und ich war mir sicher, dass sie auch in der nächsten Zeit nicht wachsen würde. Sie war schon seit einem Jahr nicht mehr gewachsen. Wahrscheinlich wäre jeder Arzt darüber entsetzt, wenn wir uns einen leisten könnten. Schließlich war sie erst sieben. „Falscher Weg“, sagte ich leise. Schnell zog ich sie an der Hand in die andere Richtung, sodass wir den Gulf Drive entlanggingen und nicht die Straße durch unser Wohnviertel. Ich war mir sicher, dass Tanya Maldonado uns sofort durch eins der Fenster ihres klimatisierten Hauses entdecken würde. Ich hatte Tanya seit der Mittelstufe nicht mehr gesehen, ziemlich genau seit der Zeit, als meine Mutter mit uns ihrem Freund Dough in die grauen Berge von Pennsylvania hinterhergezogen war. Obwohl wir uns drei Jahre nicht gesehen hatten, wusste ich doch, dass sie auf mich warten würde, als wäre ich keinen Tag weg gewesen. In der Mittelstufe fand sie alles, was ich tat, unglaublich faszinierend. Wenn ich meine Haare einmal anders frisierte, konnte sie sich eine ganze Woche lang darüber lustig machen. „Meinst du wirklich, dass du mit dieser Frisur hübsch aussiehst?“, fragte sie mich dann mit zusammengezogenen Augenbrauen. Wenn ich mir tatsächlich mal neue Klamotten gekauft hatte, wollte sie jedes noch so kleine Detail darüber hören. „Ist das T-Shirt neu? Ich habe genau so eins schon mal gesehen … wo war das nur? Ja, genau, das ist ein Jungen-T-Shirt, habe ich recht?“ Manchmal schaffte ich es, ihr ein paar Tage aus dem Weg zu gehen, indem ich mich in einer Toilette einschloss und erst in den Klassenraum rannte, wenn es schon geklingelt hatte. Das hatte sogar ein paar Wochen lang geklappt, bis zu jenem Tag gegen Ende der siebten Klasse. Ich saß auf der Toilette und hielt die Luft an, als Tanya mit ihren Freundinnen hereinkam, um vor dem trüben, alten Spiegel einen ganzen Schönheitssalon aufzubauen. Zwischen dem Schnappen der Make-up-Dosen und dem Klicken der Lippenstifte hörte ich, wie sie ihren willigen Gefolgsleuten die Marschbefehle erteilte. „Frag die Messy mal, ob sie Sam King mag. Die ist ja so in den verknallt. Als würde Sam sich je mit der sehen lassen!“ Dass fast jeder meinen Namen mit „Messy“ (übersetzt: Schlampe, Chaotin) abkürzte, daran hatte ich mich schon lange gewöhnt. Ich hörte, wie die ganze Gruppe mit den Lippen schmatzte, um die neue Schicht Glitzer-Lipgloss gleichmäßig zu verteilen. „Mir fällt es schon schwer, im Unterricht neben ihr zu sitzen. Ständig habe ich Angst, dass sie Flöhe oder Läuse hat, die ich dann auch kriege.“ Die Mädchen kicherten begeistert bei diesen Worten, als hätten sie sich gerade eine neue Choreographie für einen Tanz ausgedacht. Dann verließen alle gemeinsam die Toiletten. Jetzt wussten sie ja, was sie zu tun hatten. Tanya Maldonado hatte ihnen eine Aufgabe übertragen und bis zum Ende des Schultags würde jede Einzelne von ihnen alles daransetzen, um herauszufinden, ob an diesem unglaublichen Gerücht etwas dran war. Hatte sich Melissa „Messy“ Keiser am Ende tatsächlich in einen der besten Sportler unserer Schule verguckt? Ganz ehrlich – ich hatte niemandem, wirklich niemandem erzählt, dass ich für Sam King schwärmte. Doch eines Tages beim Mittagessen in der Cafeteria konnte Tanya in einem einzigen Augenblick alles in meinem Gesicht lesen, was ich zu verbergen versuchte. Sie saß an dem Tisch in der Mitte der Cafeteria, das beliebteste von allen beliebten Mädchen in der Schule. Von diesem Thron in unserem sozialen Universum regierte sie praktisch die gesamte Mittelstufe. Als Sam an meinem Stuhl vorbeikam, um in ihre Nähe zu kommen, war ich ganz kurz rot geworden – wirklich nur für einen Augenblick. Doch ich wusste, dass Tanyas Adleraugen auf mich gerichtet waren. Und diesen Augen entging nichts. Mehr Bestätigung brauchte sie gar nicht und sofort packte sie die Gelegenheit beim Schopf. Es dauerte nur wenige Minuten, bis die eine Hälfte der Mädchen an ihrem Tisch mich aus den Augenwinkeln anstarrte und sich die andere Hälfte vor Lachen fast krümmte. Die meisten hatten ihre Augenbrauen so stark hochgezogen, dass man sie unter ihren Ponys kaum noch sah. Anscheinend konnten sie noch gar nicht fassen, was sie gerade gehört hatten. Sie schauten mich an, als wäre ich endgültig verrückt geworden. Sam war wie wir in der siebten Klasse, aber er hatte auch Freunde in der neunten und selbst die Trainer der Oberstufe kannten schon seinen Namen. Seit das Gerücht gestreut worden war, mied er jeden Blickkontakt mit mir. Ein paar seiner Freunde waren ihm natürlich sofort zur Seite gesprungen, um seinen Ruf zu schützen. „Du weißt schon, dass du total hässlich bist, Messy?“, sagte einer von ihnen zu mir, als er auf dem Flur an mir vorbeiging. Ich tat so, als hätte ich ihn gar nicht gehört. Ganz vielleicht, hoffentlich, hatte ich ihn tatsächlich falsch verstanden. Und dann, in Chemie, so laut, dass ich es auch ein paar Reihen hinter den Jungen noch gut verstehen konnte: „Die ist so hässlich, dass sich die Schweine beißen.“ Mit diesen Worten begann ein neues Begrüßungsritual für mich, dem ich fortan jedes Mal ausgesetzt war, wenn ich die Klasse betrat. Die Jungen fingen sofort an zu grunzen wie die Schweine, um dann in haltloses Gelächter auszubrechen, wenn ich an ihnen vorbeiging. Erst nach der Episode mit Ian Owens hörte es wieder auf. Der zweite Schulsprecher unserer gesamten Schule, Ian Owen, saß in der ersten Reihe. Eines Tages drehte er sich zu mir um, sah mich an und griff sich dann erschrocken mit beiden Händen an den Kopf, als hätte er gerade ein Gespenst gesehen. Das konnte man nicht missverstehen: Ich sah so fürchterlich aus wie ein Gespenst. Der Lehrer ließ Owen an diesem Tag nachsitzen und danach schien das Ganze seinen Reiz verloren zu haben. So eine Sache war schwer zu übertrumpfen. Doch am Ende dieser Tortur war ich dreißig Schultage hintereinander beschimpft worden. Von fast allen Schülern. Selbst von Mike Lewis, als er auf dem leeren Flur an mir vorbeiging. Ohne dass es jemand sehen konnte, rammte er mir einfach meine Bücher in die Brust. Einige Monate später zog meine Familie schließlich weg, kurz vor dem Ende des ersten Halbjahrs der achten Klasse. Ich habe die Mittelstufe in einer anderen Stadt beendet und bin in die Oberstufe gewechselt, wo mich keiner „Schlampe“ nannte und mich auch keiner kannte. Ich erzähle das alles nur, damit Ihr versteht, was für mich auf dem Spiel stand, als ich drei Jahre später zurück auf die Insel kam. Jetzt musste ich hier wieder in die Schule und würde all die Leute wiedersehen, mit denen ich früher schon in eine Klasse gegangen war. Ich hoffte inständig, dass Schimpfnamen und Grunzgeräusche es nicht durch die Türen der Oberstufe geschafft hatten. Doch ich wusste auch, dass ich niemals das Stigma loswerden würde – die Erinnerung daran, wie es war, „Messy“ Keiser zu sein. Für mich gab es nur einen Vorteil dabei, wieder nach Florida zu ziehen: Jetzt konnte ich wieder jeden Tag und zu jeder Jahreszeit schwimmen. Außerdem wusste ich, dass meine Freundin Julie Peterson auf mich wartete. Schon damals schien sie immun gegen die Schande und die Beschimpfungen zu sein, die nun einmal dazugehörten, wenn man meine beste Freundin war. Mir war von Anfang an klar, dass es nur eine Strategie gab, wie ich auf die Insel zurückkommen konnte. Verstecken. Als Denise endlich von der Arbeit nach Hause kam, war es nach Mitternacht. Ich lag im Bett und tat so, als würde ich schon schlafen. Zuerst hörte ich, wie sie die Schlüssel klirrend auf den Glastisch warf. Dann wurde die Tür zu Crystals Zimmer kurz geöffnet und meine Mutter sah nach, ob bei ihr alles in Ordnung war. Schließlich ging sie an meiner abgeschlossenen Schlafzimmertür vorbei zu ihrem eigenen Zimmer. Vor meiner Tür hörte ich sie plötzlich kichern. Kurz danach hörte ich das tiefere Lachen eines Mannes, den ich ganz bestimmt auch wieder nicht kannte. Regungslos verharrte ich noch fünf Minuten, bevor ich eine weitere Schicht Lipgloss auftrug, das Fliegengitter aufzog und das schwere Fenster so weit wie möglich nach oben schob. Glücklicherweise war unser Mietshaus groß genug, dass wir alle eigene Zimmer hatten, obwohl Robbys eigentlich nur ein Wintergarten war. Ich rannte über den Rasen und zertrat die hohen Grashalme, die mal wieder gemäht werden mussten. Danach lief ich weiter durch die nicht eingezäunten Gärten unserer Nachbarn, bis ich zur Straße kam. Fast spürte ich, wie sich die Erde unter mir drehte, als wollte sie mir bei meiner Flucht helfen, selbst wenn es keine richtige Flucht war. Als ich endlich bei Julies Haus fünf Straßen weiter ankam, konnte ich die Musik schon auf dem Bürgersteig hören. Vor dem Haus standen ein Auto und ein Pick-up, die beide keinem aus Julies Familie gehörten. „Ich hab schon gedacht, du würdest gar nicht mehr kommen!“ Ungläubig schüttelte Julie den Kopf und starrte auf meine Haare, die ich schnell zusammengedreht hatte. „Ich fasse es einfach nicht, dass du samstagabends auf deine Schwester aufpassen musst!“ „Ich habe meinen Badeanzug schon an, falls deine Eltern uns erlauben, schwimmen zu gehen. Wo sind sie eigentlich? Und wem gehören die beiden Autos draußen?“ Mit einem schiefen Grinsen zog sie mich weiter ins Haus. „Meine Eltern sind ausgegangen und noch nicht wieder da.“ Ich versuchte, ihren Gesichtsausdruck zu lesen. Immer, wenn sie so schief grinste, wusste ich, dass das noch nicht die ganze Wahrheit war. „Und?“, hakte ich nach. „Nun … komm erst einmal mit.“ Wir gingen durchs Wohnzimmer an den vielen Urlaubsfotos von Julies Familie vorbei. Die ganze Wand war voll davon. Überall hingen teure Bilderrahmen, auf denen mich ihr überheblicher Vater und ihre perfekt gestylte und gebräunte Mutter von irgendeinem Kreuzfahrtschiff oder vor irgendeinem tollen Hotel auf einer karibischen Insel anstrahlten. Sie gehörten zu einer bestimmten Art von Floridabewohnern – nämlich denen, die auf einer Insel wohnen und auch auf Inseln Urlaub machen. Sie wussten genau, was ihnen gefiel, warum also sollten sie nicht auch genau das machen? Ich konnte mich noch daran erinnern, dass sie zu der Sorte Eltern gehörten, die sich beschwerten, wenn ihre Kinder nicht oft genug auf Partys herumhingen. Wahrscheinlich war das der Grund, warum Julie und ich uns so gut verstanden. Wir hatten beide gelernt, viele Entscheidungen in unserem Leben von dem Alkoholpegel unserer eigenen Mutter nach fünf Uhr abzuschätzen. Als wir auf die hintere Veranda traten, spielten dort zwei Jungs mit einem Feuerzeug. Sie hielten ihre Handflächen so lange über die Flamme, bis es einer von ihnen nicht mehr aushielt und die Hand zurückzog. Ich blieb stocksteif stehen und starrte die beiden an, bis Julie mir ihre Hand in den Rücken rammte. Langsam setzte ich mich auf einen der Stühle auf der Veranda. Ich wusste genau, wer die beiden waren, und fürchtete mich vor dem Moment, in dem sie mich erkennen würden. Doch sie waren so sehr in ihr Spiel vertieft, dass das vielleicht noch ein bisschen dauern würde. Auf der anderen Seite der Veranda erkannte ich Julies andere beste Freundin. „Hallo, Leigh.“ Ich winkte ihr kurz zu, als sie ihren Blick kurz von der orange züngelnden Flamme zwischen Brett Smiths Fingern abwandte und mich ansah. Sofort sah ich, dass Leigh Doherty ihre langen, gewellten blonden Haare hatte wachsen lassen. Damit war sie ganz offiziell das schönste Mädchen hier draußen. „Ich dachte, du würdest heute nicht kommen. Julie hat gesagt, dass du babysitten musst.“ Sie sagte das so lässig, als würde sie damit eine Unterhaltung von heute Morgen wieder aufnehmen, obwohl wir uns doch schon seit mindestens drei Jahren nicht mehr gesehen hatten. „Ja, meine Mutter musste eine Doppelschicht arbeiten, deshalb konnte ich jetzt erst weg.“ „Das ist bescheuert.“ Leigh zuckte mit den Schultern. „Du hättest vorhin am Hafen dabei sein sollen. Alle waren da. Übrigens, herzlich willkommen.“ „Hey“, sagte Brett dazwischen. Er ließ sein Feuerzeug zuschnappen und schaute mich das erste Mal an. „Dich kenne ich doch, oder?“ „Hey“, erwiderte ich. Ich wusste zumindest, wer er war. Er war ein Freund von Ian Owens und Mike Lewis und einer der Anführer der Gruppe, die mein Leben damals zur Hölle gemacht hatten. So war das nun einmal, wenn sich die Welt um mich herum in zwei Lager spaltete. Jeder Junge, den ich kannte, war entweder Teil der Gruppe, die mich nicht ausstehen konnte, oder ein Mitglied der Gruppe, die mich nicht kannte. Und jetzt hatte Leigh offensichtlich die Grenze überschritten und ging mit einem der Jungs aus der ersten Gruppe aus. Nachdenklich zog Brett die Augenbrauen zusammen, als könnte er mich noch nicht richtig einordnen. „Haben sie dich nicht immer Messy genannt?“ Er grinste selbstgefällig, als wäre es eine tolle Leistung von ihm, dass er sich an etwas erinnerte, das schon Ewigkeiten zurücklag. Wahrscheinlich war es für ihn sowieso nur eine verschwommene Erinnerung an einen Scherz aus der siebten Klasse. „Halt die Klappe“, mischte sich jetzt Julie ein. „Sie heißt Missy.“ „Jetzt erinnere ich mich an dich, Messy.“ Trotzig grinste er in die Runde, bis Julie ihm eine Frisbee an den Kopf warf. „War wirklich nur ein Scherz.“ „Missy ist gerade erst von Pennsylvania wieder hierhergezogen.“ „Das ist cool“, sagte Brett. Er nickte kurz und ließ sich dann auf seinen Stuhl fallen, als fände er das Thema schon jetzt langweilig. „Und wie haben sie dich in der siebten Klasse immer genannt?“ Julie lächelte ihn herausfordernd an. „Den Großen. Den König. Den Begehrenswertesten. Du kannst dir einen aussuchen.“ „Begehrenswert?“ Erstaunt hob Leigh die Augenbrauen, bis Brett seinen Kopf auf ihre Schulter legte, als wolle er sich bei ihr entschuldigen. Julie rollte mit den Augen. „Keiner nennt sie Messy. Das war in der siebten. Jetzt sind wir in der Oberstufe, mein Freund.“ „Ja, das stimmt. Sie sieht auch anders aus.“ Er ließ seinen Blick von meinem Gesicht nach unten gleiten, als würde er mich begutachten. Ich senkte die Augen, weil ich nicht wusste, was seine Worte bedeuten sollten. Außerdem hatte ich Angst, dass ihm nicht gefiel, was er sah. „Mir ist langweilig. Ich geh rein und schau mal, was es im Fernsehen gibt.“ Mit einem dramatischen Seufzer erhob sich Leigh von ihrem Stuhl. Sie strich sich über ihre blonden Locken und streckte sich beim Aufstehen, sodass ihr schöner Körper richtig zur Geltung kam. Sofort war Brett an ihrer Seite und folgte ihr ins Haus, als wäre er an einer Leine. Kurz darauf verschwanden die beiden in einem leeren Zimmer im Seitenflügel des Hauses. „Mach dir nichts aus ihm. Er hat seine Pillen heute noch nicht geschluckt.“ Ich zuckte nur mit den Schultern. Julie versuchte Bretts Worte herunterzuspielen, aber mir tat es jetzt schon leid, dass ich gekommen war. „Ist auch egal.“ Sie schüttelte den Kopf und drehte ihren Stuhl zur anderen Seite der Veranda, als könnte sie so noch einmal von vorn anfangen. „Du erinnerst dich noch an JP, oder?“ Der einzige andere Junge auf der Veranda schob sich seine sonnengebleichten, zotteligen Haare aus dem Gesicht und sah mich mit einem abwesenden Lächeln an. Doch schon nach wenigen Sekunden hingen seine Augen wieder bewundernd an Julie. Ich fragte mich, ob sie merkte, dass er sich für sie interessierte. Das Schweigen zwischen den beiden war so schwer, dass die Veranda eigentlich unter der Last hätte einstürzen müssen. Ich erinnerte mich noch gut an JP und dass er immer cooler als alle anderen wirkte, weil er fast nie etwas sagte. Außerdem schien er mit den Gedanken ständig irgendwo anders zu sein. So konnten die Mädchen, die ihn umschwärmten, immer glauben, dass er die ganze Zeit nur an sie dachte und sich still und leise nach ihnen verzehrte. Am Anfang der Mittelstufe wurden wir alle das erste Mal mit Bussen von Anna Maria über die zwei Brücken bis Bradenton auf dem Festland gebracht. Dort sollten wir andere Schüler treffen, die in Stadtteilen lebten, deren Namen wie fremde Ozeane klangen und wo so Sachen wie ungepflegte Vorgärten und Wäscheleinen auf der Veranda verboten waren. Endlich stiegen wir an der Schule in der Stadt aus. Aus unseren Rucksäcken rieselte der Sand und wir kämpften noch gegen den Husten der „roten Flut“. Doch gerade weil wir wegen der giftigen Algen, die manchmal unsere Strände verseuchen, mit diesem Husten zu kämpfen hatten, wurden wir nur noch interessanter für die Schüler vom Festland – es war, als würden wir unter Brücken leben und unser Essen noch über einem Lagerfeuer kochen. Und als die Mädchen vom Festland von dem gebräunten Surfer erfuhren, der viel zu cool war, um viele Worte zu machen, und der von allen nur JP gerufen wurde, war es um sie geschehen. Doch JPs Gedanken kreisten die meiste Zeit um Wellen. Ich wusste das, denn jedes Mal, wenn der Bus uns am Nachmittag endlich zur Insel zurückbrachte, hörten wir alle auf zu reden und beobachteten seine Reaktion, wenn wir am Strand vorbeifuhren. Es gab einen Platz auf der linken Seite des Busses, von dem aus JP gerade noch so die Hütte der Strandwache sehen konnte. Auf der Hütte wehte die Fahne, die den Wellengang anzeigte und signalisierte, wie gefährlich das Schwimmen war. Wenn die Fahne eine andere Farbe hatte als Grün, verwandelte sich JP in ein kleines, aufgeregtes Kind. Sofort sprang er auf und bahnte sich einen Weg zur Bustür, damit er als Erster aus dem Bus stürzen konnte. Eine andere Farbe als grün bedeutete, dass die Wellen für Schwimmer zu hoch waren. Aber es bedeutete auch, dass sie vielleicht hoch genug zum Surfen waren. Denn manchmal zeigte der sonst so stille und ruhige Golf von Mexiko seine ganze Macht und dann machte JP das Surfen Spaß. Das waren die einzigen Zeiten, in denen er sich dafür interessierte, was um ihn herum passierte. Bis jetzt. Julie biss sich auf die Unterlippe, um von der zarten Röte abzulenken, die sich auf ihren Wangen ausbreitete. Plötzlich war es nicht mehr das einzige Highlight der Winterferien, dass ihre verlorene beste Freundin endlich wieder nach Hause zurückgekehrt war. Meine einzige wirkliche Freundin auf der Insel merkte gerade, dass sich jemand für sie interessierte. Ich verkrampfte meinen Bauch, um die Gefühle unter Kontrolle zu bringen, die mich mitzureißen drohten. Auf keinen Fall wollte ich eifersüchtig werden, nicht auf Julie. Eigentlich wäre es doch eine tolle Sache, wenn sie einen Freund hätte. Und mir reichte es völlig, auch dabei zu sein und so zu tun, als wäre ich auch erwünscht – sozusagen als Anhängsel – bei den breitschultrigen Jungs, die in ihren Trucks herumfuhren und auch bei heftigem Sturm keine Angst hatten zu surfen. „Ich bin ziemlich müde. Ich sehe euch dann alle morgen.“ „Du willst schon gehen?“ Julie konnte ihren Blick nicht von JPs Lächeln losreißen. „Ja, gute Nacht.“ Ich war Jahre weg gewesen, doch Brett hatte mir deutlich gezeigt, dass sich noch alle an mich erinnerten: an das Mädchen, das jeden Tag mit den gleichen Klamotten in die Schule kam, das Mädchen, deren Mutter nie zu einem Elternabend gekommen war. Das komische Gefühl im Bauch wurde wieder stärker, als ich daran dachte, dass ich mit genau diesen Leuten wieder in die Schule gehen musste. Es war, als wäre ich nie weg gewesen. Trotz der vielen Zentimeter, die ich gewachsen war, war ich in ihren Augen immer noch das ungeschickte, dreizehnjährige Mädchen, das ich so hasste. Dieses Mädchen würde mich immer begleiten und seinen schrecklichen Schatten über alles werfen, was ich tat und wo ich war. Schon jetzt wünschte ich mir, dass das Schuljahr vorbei war, obwohl das zweite Halbjahr noch nicht einmal angefangen hatte. Doch wenn es um die Schule geht, gibt es keinen Notausgang. Als ich in die Nähe unseres Hauses kam, schlich ich mich durch die Nachbarsgärten und blieb vor Mrs Durhams Haus stehen. Sie wohnte direkt neben uns. Hier konnte ich mich immer verstecken. Vorsichtig schob ich meinen Zeigefinger durch ein Loch in ihrer Gartentür und kämpfte kurz mit dem Schloss, bis die Tür endlich aufging und ich die vertrauten Delfinfiguren und Topfpflanzen sehen konnte. An diesem Ort hatte sich in den letzten Jahren kaum etwas verändert. Ich war mit meiner Familie in dasselbe alte Mietshaus zurückgezogen, in dem wir schon früher gewohnt hatten, und ich wusste immer noch ganz genau, welche Häuser in unserer Nachbarschaft wann und wie lange leer standen. Gerade war keine Saison, deshalb würde es auch noch einige Wochen dauern, bis Mrs Durham und all die anderen Großmütter aus Michigan für den Winter wieder auf die Insel kamen. Vor mir konnte ich ihren dunklen, glitzernden Pool erkennen, der nur auf mich zu warten schien. Und natürlich hatte Mrs Durham dafür gesorgt, dass der Hausmeister sich regelmäßig um das Haus und um die Solarzellen kümmerte, damit bei ihrer Rückkehr alles in einem perfekten Zustand war. Langsam glitt ich ins Wasser und schwamm mit langen Zügen bis zum tiefen Ende des Beckens. Dort ließ ich mich einfach auf den stillen, dunklen Boden des Pools sinken. Die dicken Strähnen meiner dunkelbraunen Haare wanden sich wie Bänder über meinem Kopf. Im Wasser lag für mich eine unglaubliche Freiheit, eine große Stille. Hier war ich ganz allein, mitten in der Nacht in einem fremden Pool, in dem ich eigentlich gar nicht sein durfte. Umso deutlicher spürte ich jede Bewegung des Wassers auf meiner Haut. An diesem Ort nannte mich keiner „Messy“ und meine Mutter würde hier nie nach mir suchen. Ich ließ mich auf dem Rücken durch das Wasser treiben und versuchte mir einzureden, dass diesmal alles anders sein würde, dass ich diesmal hier in diesem Paradies glücklich sein würde. Und das, was ich brauchte, war so einfach und doch so weit weg, dass es mich fast kaputt machte. Wenn ich es benennen sollte … wenn ich es auf den absoluten Kern beschränken sollte … wenn ich wirklich ehrlich wäre … Ich wollte nur, dass mich jemand hübsch fand. Nur ein Junge musste sagen, dass ich schön war. Damit wäre alles, was die anderen je über mich gesagt haben, ausgeglichen und aufgehoben. Doch langsam wurden meine Augenlider immer schwerer und ich zitterte in der kalten Nachtluft. Deshalb zwang ich mich, aus dem Pool zu klettern, suchte meine Sachen zusammen und ließ das Wasser aus meinem Badeanzug tropfen. Danach schlich ich mich mit tropfenden Haaren und mit nach Chlor riechender Haut zu meinem Zimmerfenster und kletterte hinein, denn meine Tür war ja immer noch abgeschlossen. Ich war froh darüber, dass sich manche Dinge nicht verändert hatten, vor allem nicht Mrs Durhams Pool. Als ich gerade meine Rollos herunterlassen wollte, leuchtete ein heller Lichtstrahl aus Mrs Durhams Garten direkt auf unser Haus und tauchte mein Zimmer in ein grelles Licht. Er kam wie ein Blitz aus einem ihrer Schlafzimmer und verschwand so schnell, wie er gekommen war. Nebenan war jemand zu Hause. Ich sprang vom Fenster weg und ließ das Rollo dabei mit einem heftigen Ruck nach unten fallen. Vorsichtig spähte ich zum Nachbarhaus, doch ich konnte keine weiteren Bewegungen erkennen. Mir blieb nichts anderes übrig, als ins Bett zu gehen und mir zu überlegen, warum ich Mrs Durhams Rückkehr nicht bemerkt hatte.
Kapitel 1
Wenn die Leute wissen wollen, was am Anfang meines Abschlussjahres in der Schule passiert ist, dann stellen sie immer nur eine einzige Frage. Sie fragen immer nur, was seine letzten Worte waren. Irgendwie müssen es bedeutungsvolle Worte gewesen sein, das stellen sie sich jedenfalls vor. Die Art von letzten Worten, die ein Mädchen selbst Jahre nach dem Schulabschluss nicht vergisst. Atemlos warten sie auf den Teil in der Geschichte, wo ich beschreibe, wie er vom Boot gesprungen ist, mitten hinein in das vom Mondlicht beschienene dunkle Wasser. Nur das Weiße seiner Haut war danach noch für einen kurzen Moment im Wasser zu sehen."Er wollte sich bestimmt umbringen", sagen sie bei diesem Teil der Geschichte immer. "Warum wäre er sonst ins Wasser gesprungen, er hat doch gewusst, dass ihn keiner retten konnte?"Und dann erzähle ich weiter, genau so, wie sie es von mir erwarten. Ich erzähle davon, wie ich verzweifelt die Wasseroberfläche absuche in der Hoffnung, seinen Kopf irgendwo zu entdecken. Wie ich selbst ins Wasser springe und zehn Meter schwimme, bevor mir bewusst wird, dass ich das Boot hinter mir kaum noch sehen kann - das Einzige, das mich vor der dunklen, lockenden Tiefe retten kann. Sie wollen hören, wie schwer es war, sich zum Boot zurückzukämpfen, und wie heftig der Sturm bereits tobte, als ich es endlich erreicht hatte. Sie wollen hören, wie ich panisch die Schränke nach einem Funkgerät durchwühlte und keines fand. Wie ich nach einer Leuchtpistole suchte, aber auch damit keinen Erfolg hatte.
Und wenn ich ihnen all das erzähle, dann fragen sie nie - und ich erwähne es auch nicht -, dass sich das alles in vollkommener Stille abspielte.
Um ehrlich zu sein: Er hat nichts gesagt, bevor er gesprungen ist. Und ich habe nicht einmal seinen Namen gerufen. Ich wusste sofort, dass er untergetaucht war, damit ich ihn nicht finden konnte.
Als der Sheriff sein Boot neben meins steuerte und festmachte, waren Stunden vergangen. Stunden, in denen ich nicht weiter hörte als die Natur um mich herum und die Stille. Der Sheriff zog mich aus meinem Versteck unter dem Steuer, wo ich mich in meiner Verzweiflung hingekauert und gewartet hatte. Um uns herum und in unserem ganzen Staat tobte in dieser Nacht der Hurrikan Paul.
In dieser Geschichte geht es nicht um Selbstmord. Aber als ich siebzehn war, nahm sich der einzige Junge, der mich je bei meinem ganzen Namen genannt hatte, das Leben. Es war das erste Mal, dass ich mit einem Fehler konfrontiert wurde, den man nicht wieder rückgängig machen konnte - weder mit Tipp-Ex noch mit Nachsitzen nach der Schule. Egal, was ich den Rest meines Lebens tun werde - diese Tatsache werde ich niemals ändern können.
Eigentlich geht es in dieser Geschichte um drei Jungs. Um einen, der mich geliebt hat. Um einen, der das nicht konnte. Und um einen, der nicht wusste, wie.
Mein Name ist Melissa Keiser und ich bin auf der Insel Anna Maria in Florida aufgewachsen.
Die beste Beschreibung für diesen Ort ist seine Temperatur: 26° C. Natürlich sind es nicht immer 26°?C auf der Insel. Doch die Schwüle in der Luft, verbunden mit dem schwachen, aber widerlich süßen Geruch der Orangensaftfabrik, führt dazu, dass sich alles anfühlt, als wäre es in eine warme Decke gehüllt. Eine Decke, die gerade warm und weich genug ist, dass man schläfrig wird und sich sicher fühlt, die aber jede deiner Bewegungen unendlich langsam und anstrengend macht. Trotzdem ist es die schönste Stadt am Strand, die ich je gesehen habe. Doch dann kommt Wind auf und du merkst, dass du dich vor dem wahren Leben hinter einer Sanddüne versteckst.
Die Insel, über die ich schreibe, kann man nicht vergleichen mit der Insel, die man im Internet findet. Dort gibt es nur die Bilder, die die Yankees oder die grauhaarigen Touristen aus Kanada gepostet haben. Diese Besucher lieben die Insel, wie man nur einen Ort lieben kann, an dem man noch nie gelitten hat. Auf solchen Bildern sieht man Dinge wie Seestern
| Erscheint lt. Verlag | 9.6.2015 |
|---|---|
| Übersetzer | Sabine Weißenborn |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Like moonlight at low tide |
| Maße | 135 x 205 mm |
| Gewicht | 363 g |
| Einbandart | Paperback |
| Themenwelt | Kinder- / Jugendbuch ► Jugendbücher ab 12 Jahre |
| Schlagworte | Christlicher Glaube • Erwachsenwerden • Jugendroman • •Jugendroman •Liebesgeschichte •Erwachsenwerden •Selbstmord •Mobbing •Christlicher Glaube • Liebesgeschichte • Mobbing • Selbstmord |
| ISBN-10 | 3-86827-542-8 / 3868275428 |
| ISBN-13 | 978-3-86827-542-1 / 9783868275421 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich