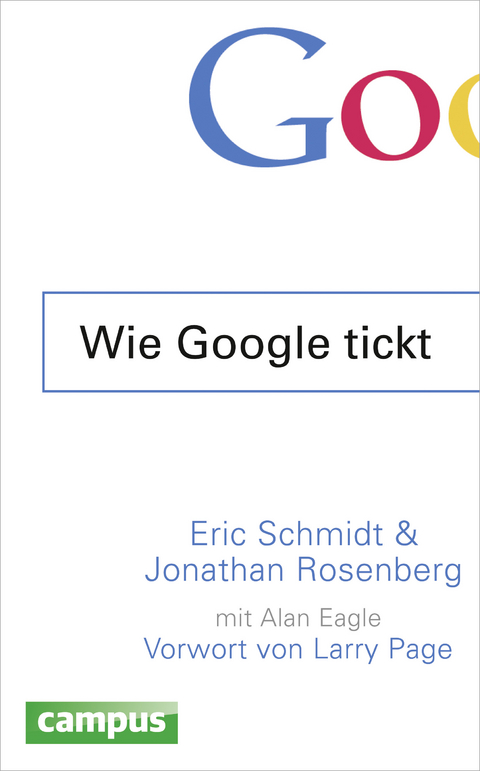Wie wird aus einem Garagen-Start-up ein weltbekanntes Imperium?
Das Geheimnis um Google, eine der wertvollsten Marken der Welt,ist gelüftet. Von niemand Geringerem als Google-CEO Eric Schmidt, Gründer Larry Page und Senior Vice President Jonathan Rosenberg.
Und so wie Google längst mehr als eine Suchmaschine ist, ist »Wie Google tickt« weit mehr als eine Unternehmensgeschichte.
Es ist spannende Inspirationsquelle und kluger Wegweiser. Wie baut man eine fruchtbare Unternehmenskultur auf? Wie entwickelt man wegweisende Strategien? Wie entsteht Innovation?
Die drei Google-Insider sind angetreten, ihr Wissen in die Welt zu bringen.
Eric Schmidt ist Informatiker und war langjähriger CEO von Google. Seit April ist er Executive Chairman von Google. Schmidt lehrt an der Stanford University und gehört seit 2009 zum Beraterteam von Barack Obama.
Jonathan Rosenberg, Senior Vice President von Google, war vor allem für die innovative Produktentwicklung verantwortlich. Zusammen sind sie echte Google-Insider.
Inhalt
Vorwort 13
Einleitung - Erfahrungen aus erster Hand 17
"Sprecht einfach mit den Ingenieuren!" 19
Der Finnland-Plan 23
Wenn das Erstaunliche normal ist 25
Tempo 26
Die "smarte Kreative" 29
Es könnte uns beiden Spaß machen 33
Ungebaute Pyramiden 36
Firmenkultur - Glaub an deine Slogans 39
Steckt sie zusammen 45
Zusammen arbeiten, essen und leben 47
Ihre Eltern haben sich geirrt: Unordnung ist eine Tugend 48
Hör nicht auf die HiPPOs 50
Die Siebenerregel 52
Jede Badewanne hat (nicht) ihren eigenen Sockel 53
Erledigen Sie Reorganisationen immer an einem Tag 54
Bezos' Zwei-Pizzen-Regel 55
Organisieren Sie die Firma um die Leute herum, die am meisten bewegen 56
Werfen Sie die Knappen raus, aber kämpfen Sie um die Diven 58
Auf gute Art überarbeitet 60
Etablieren Sie eine Kultur des Ja-Sagens 61
Spaß, nicht Fun 63
Ändern Sie den Dresscode 69
Ah'cha'rye 71
Tu nichts Böses 72
Die Strategie - Ihr Plan ist falsch 75
Setzen Sie auf technische Erkenntnisse, nicht auf Marktforschung 76
Gewinnen Sie Erkenntnisse 81
Suchen Sie nicht nach schnelleren Pferden 83
Optimieren für Wachstum 84
Coase und die Natur der Firma 87
Spezialisieren Sie sich 89
Voreinstellung "offen", nicht "geschlossen" 90
Voreinstellung "offen", es sei denn … 93
Laufen Sie nicht der Konkurrenz hinterher 94
Talente - Personalbeschaffung als wichtigste Aufgabe 99
Der Herdeneffekt 102
Menschen mit Leidenschaft reden nicht darüber 104
Stellen Sie lernbesessene Mitarbeiter ein 105
Der LAX-Test 108
Sichtweisen, die man nicht lehren kann 110
Öffnen Sie die Blende 111
Jeder kennt einen herausragenden Menschen 115
Das Einstellungsgespräch führen: die wichtigste Fähigkeit 116
Setzen Sie eine halbe Stunde für ein Interview an 120
Vertreten Sie eine Meinung 122
Freunde lassen Freunde keine Freunde einstellen (oder fördern) 123
Die Dringlichkeit, eine Stelle zu besetzen, rechtfertigt keine Kompromisse bei der Qualität der Personalbeschaffung 127
Unverhältnismäßige Vergütung 128
Geben Sie die Schokolade ab und behalten Sie die Rosinen 129
Wenn Sie sie lieben, lassen Sie sie gehen (aber erst nach den folgenden Schritten) 131
Mitarbeiter zu entlassen, kostet Nerven 133
Entscheidungen - Die wahre Bedeutung von Konsens 145
Entscheiden auf der Basis von Daten 152
Vorsicht vor dem Ja des Wackelkopfs 153
Wissen, wann man die Glocke läuten muss 155
Treffen Sie weniger Entscheidungen 157
Treffen Sie sich täglich 159
"Sie haben beide recht" 161
Jedes Meeting braucht einen Moderator 162
Horseback Law 164
Verwenden Sie 80 Prozent Ihrer Zeit für 80 Prozent Ihrer Umsätze 166
Befassen Sie sich mit der Nachfolgeplanung 167
Kommunikation - Seien Sie ein exzellenter Router 171
Voreinstellung "offen" 173
Kennen Sie die Details 175
Man muss gefahrlos die Wahrheit sagen können 177
Kommen Sie ins Gespräch 179
Wiederholung schadet dem Gebet nicht 181
Wie war's in London? 185
Prüfen Sie sich selbst 186
E-Mail-Weisheiten 187
Nutzen Sie ein Handbuch 189
Beziehungen, keine Hierarchien 195
Innovation - Wie die Ursuppe entsteht 197
Was ist Innovation? 201
Das Umfeld zählt 202
Der CEO muss der CIO sein 203
Den Nutzer im Blick behalten 206
Think big - visionär denken 210
Hoch gesteckte Ziele 213
70/20/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
"20 percent time" 219
Ideen entstehen überall 224
Erst liefern, dann verbessern 226
Richtig scheitern 229
Es geht nicht ums Geld 232
Schluss - Denken Sie das Undenkbare 235
Von Downtown Abbey zu Diapers.com 236
Wer gewinnt und wer scheitert in einer Welt der Plattformen? 237
Die Entstehung des Social Web (und eines Start-ups namens Facebook) 239
Stellen Sie die schwierigen Fragen 241
Die Aufgabe der Regierung 245
Große Probleme sind Informationsprobleme 246
Die Zukunft ist schön … 249
Die nächste smarte Kreative 251
Danksagung 253
Glossar 259
Anmerkungen 263
Die Autoren 289
Register 291
"Der Verlag hat für eine sehr gute Übersetzung gesorgt. 'Wie Google tickt' ist spannend bis zu letzten Seite. Über weite Strecken präsentiert es ganz konkrete Handlungsanleitungen ... Dieses Buch ist eine unglaublich gute Gelegenheit, die Gründe für Googles Erfolg nachzuvollziehen." Andreas Matz, Hamburger Abendblatt, 10.01.2015"Lesenswert", Acquisa, 01.02.2015»... dieses Buch [ist] weit mehr als eine Unternehmensgeschichte. Es ist spannende Inspirationsquelleund kluger Wegweiser, der über weite Strecken ganz konkrete Handlungsanleitungen präsentiert.«, Erfurter Hefte, 20.01.2016"Das Geheimnis um Google, eine der wertvollsten Marken der Welt, ist gelüftet.", Wirtschaftsblatt, 30.01.2015Die Autoren legen locker geschrieben vieles offen, was Google und seine Erfolge ausmacht.Insbesondere die große Schar der oftmals rechtlich unbedarft erscheinenden Google-Kritiker sollte das Buch aufmerksam lesen., FAZ, 07.04.2015http://www.abendblatt.de/wirtschaft/karriere/article136220677/Blick-in-Googles-Firmenkultur.html, Hamburger Abendblatt Online, 10.01.2015"Pflichtlektüre für junge Manager und Gründer.", www.Management-Journal.de, 01.05.2015
"Der Verlag hat für eine sehr gute Übersetzung gesorgt. 'Wie Google tickt' ist spannend bis zu letzten Seite. Über weite Strecken präsentiert es ganz konkrete Handlungsanleitungen ... Dieses Buch ist eine unglaublich gute Gelegenheit, die Gründe für Googles Erfolg nachzuvollziehen." Andreas Matz, Hamburger Abendblatt, 10.01.2015
"Lesenswert", Acquisa, 01.02.2015
»... dieses Buch [ist] weit mehr als eine Unternehmensgeschichte. Es ist spannende Inspirationsquelle
und kluger Wegweiser, der über weite Strecken ganz konkrete Handlungsanleitungen präsentiert.«, Erfurter Hefte, 20.01.2016
"Das Geheimnis um Google, eine der wertvollsten Marken der Welt, ist gelüftet.", Wirtschaftsblatt, 30.01.2015
Die Autoren legen locker geschrieben vieles offen, was Google und seine Erfolge ausmacht.
Insbesondere die große Schar der oftmals rechtlich unbedarft erscheinenden Google-Kritiker sollte das Buch aufmerksam lesen., FAZ, 07.04.2015
http://www.abendblatt.de/wirtschaft/karriere/article136220677/Blick-in-Googles-Firmenkultur.html, Hamburger Abendblatt Online, 10.01.2015
"Pflichtlektüre für junge Manager und Gründer.", www.Management-Journal.de, 01.05.2015
Vorwort von Larry Page, Mitbegründer und CEO von Google Als ich jünger war und anfing, mir Gedanken über meine Zukunft zu machen, beschloss ich, entweder Professor zu werden oder eine Firma zu gründen. Ich glaubte, beides gäbe mir viel Autonomie - die Freiheit, von Grund auf neu zu denken, ausgehend von den Anforderungen der realen Welt, anstatt vorherrschende "Weisheiten" nachzubeten. Wie Eric und Jonathan in diesem Band erläutern, haben wir versucht, diese Freiheit des Denkens auf fast alles bei Google anzuwenden. Sie war die treibende Kraft bei unseren größten Erfolgen und einigen beeindruckenden Fehlschlägen. Das Prinzip, immer von Grund auf neu zu denken, brachte Google ins Rollen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich wachte auf und dachte: Was wäre, wenn du das gesamte Web herunterladen und nur die Links behalten könntest? Ich nahm einen Stift und skizzierte die Details, um herauszufinden, ob das tatsächlich möglich wäre. Die Idee, eine Suchmaschine zu bauen, hatte ich damals noch gar nicht. Erst später begriffen Sergey und ich, dass man deutlich bessere Suchergebnisse erzielen würde, wenn man die Webseiten nach ihren Links hierarchisierte. Auch Gmail begann als Hirngespinst. Und als Andy Rubin vor einem Jahrzehnt Android ins Leben rief, hielten die meisten Leute es für völlig verrückt, die gesamte Handybranche auf ein quelloffenes Betriebssystem auszurichten. Mit der Zeit habe ich gelernt, dass es überraschend schwierig ist, ein Team zu Höchstleistungen zu bewegen. Die meisten Menschen werden nicht zu jenem mutigen innovativen Denken erzogen, das wir "Moonshot Thinking" nennen. Sie meinen schnell, dass bestimmte Dinge unmöglich sind, anstatt zu gucken, was vorhanden und was damit möglich ist. Deshalb verwenden wir bei Google so viel Energie darauf, unabhängige Den- ker zu gewinnen und uns hohe Ziele zu stecken. Wenn du die richtigen Leute beschäftigst und deine Träume groß genug sind, wirst du sie in der Regel erreichen. Und sogar wenn du scheiterst, hast du wahrscheinlich etwas Wichtiges gelernt. Viele Firmen machen gern, was sie immer getan haben, mit nur geringfügigen Veränderungen. Diese Schritt-für-Schritt-Strategie führt mit der Zeit zur Bedeutungslosigkeit, besonders im Bereich der Technik, wo Veränderungen meist revolutionär sind, nicht evolutionär. Man muss sich also zwingen, Risiken einzugehen. Darum investieren wir in Bereiche, die sehr spekulativ wirken: etwa selbstfahrende Autos oder Internetversorgung durch gasgefüllte Ballons. Als wir mit Google Maps anfingen, dachten die Leute auch, es sei unmöglich, die ganze Welt zu kartieren und jede einzelne Straße zu fotografieren. Daraus kann man nur den Schluss ziehen, dass die großen Visionen von heute schon in wenigen Jahren viel weniger wild wirken werden. Das sind einige der Prinzipien, die ich für wichtig halte. Auf den nächsten Seiten folgen noch mehr. Ich hoffe, dass Sie diese Ideen verwenden können, um Ihre eigene, erstaunliche Geschichte daraus zu entwickeln! Einleitung - Erfahrungen aus erster Hand Im Juli 2003 war Eric Schmidt seit zwei Jahren CEO von Google Inc., als er von Mike Moritz, Partner bei Sequoia Capital und Vorstandsmitglied sowie Investor der Firma, eine E-Mail mit folgendem Vorschlag erhielt: "Könnten Sie sich vielleicht ein Zeitfenster von drei Stunden Mitte August vorstellen, in dem das Management dem Vorstand unseren Plan zum Wettbewerb mit Finnland vorlegen kann? (Ich glaube nicht, dass wir bis zum Meeting im September warten sollten. Das Thema ist viel zu wichtig und wir wissen alle, wie kurz ein Jahr ist, wenn es um die Konkurrenz mit Finnland geht.)" Wenn man nicht weiß, worum es geht, klingt das recht verwirrend. Warum sollte Google, ein fünf Jahre altes Internet-Start-up-Unternehmen mit ein paar Hundert Mitarbeitern aus Mountain View, Kalifornien, mit Finnland konkurrieren, einem Land mit 5 Millionen Einwohnern, das mehr als 8 000 Kilometer entfernt liegt und im Allgemeinen als freundlich und friedlich gilt? Die Finnland-E-Mail traf ein, als Eric sich gerade einigermaßen bei Google eingelebt hatte. Er war zuvor CEO bei Novell gewesen und hatte für Sun Microsystems und Bell Labs gearbeitet. Er war in Nord-Virginia aufgewachsen, hatte seinen Abschluss als Elektroingenieur in Princeton gemacht und besaß einen Master sowie einen Doktortitel in Informatik von der University of California in Berkeley. Das heißt, er war nicht nur die Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Informatikern gewöhnt, er war selbst einer. Doch als er zu Google kam, lernte er eine ganz neue Welt kennen. Das begann gleich am ersten Tag. Als er sein Büro betrat, das für einen Spitzen-CEO schon ziemlich bescheiden war, stellte er fest, dass es bereits von mehreren Softwareentwicklern benutzt wurde. Anstatt sie hinauszuwerfen, zog er ins Büro nebenan, das mehr einer Besenkammer mit Fenster glich. Ein paar Wochen später kam es dann noch schlimmer. Eines Morgens, als er den Flur zu seiner Besenkammer entlangging, bemerkte er, dass sei-ne Assistentin Pam Shore ein besorgtes Gesicht machte.1 Schon bald fand er heraus, warum: Er hatte einen neuen Bürokollegen. Es war einer der Ingenieure, die an der Suchmaschine arbeiteten, Amit Patel. Er erklärte Eric, in seinem Büro säßen bereits fünf Mitarbeiter und ein weiterer käme noch hinzu. Seine Idee, einen der Schreibtische durchzusägen, um Platz zu gewinnen, habe nicht funktioniert. Verglichen mit dem Platz, der ihm im Moment zur Verfügung stand, erschien Erics Kammer recht geräumig. Also zog Amit ein. (Die zuständigen Mitarbeiter hatten es abgelehnt, Amits Sachen in Erics Büro zu transportieren; daher hatte er es selbst gemacht.) Amit und Eric teilten sich das Büro mehrere Monate. Ganz offensichtlich ging es in dieser Welt nicht darum, die Bedeutung eines Mitarbeiters durch die Quadratmeterzahl seines Büros deutlich zu machen. Abgesehen von der etwas ungewöhnlichen Unterbringung ging Erics Wechsel zu Google problemlos vonstatten. Sein Verhältnis zu den beiden Gründern Larry Page und Sergey Brin wurde mit jedem Tag besser. Die Werbeplattform der Firma, AdWords, begann erhebliche Einnahmen zu erzielen. Beim Börsengang der Firma 2004 waren die meisten Beobachter von den Zahlen positiv überrascht. Und auch wenn das Verb "google" (deutsch "googeln") erst drei Jahre später ins Oxford English Dictionary aufgenommen werden sollte2, gehörte die Suche mit Google schon jetzt für Millionen Nutzer zum täglichen Leben. Und die Firma wuchs. Jeden Monat kamen Dutzende neuer Angestellter hinzu, darunter im Februar 2002 der neue Produktchef Jonathan Rosenberg. Er kam von Excite@ Home und Apple zu Google, um das Produktmanagementteam der Firma zu verstärken und Erics Mitarbeiterstab abzurunden. Mikes E-Mail zeigte bereits: Es gab einen großen Konkurrenten in der Ferne und das waren nicht unsere nordischen Freunde auf der anderen Seite des Atlantiks. "Finnland" war unser interner Deckname für Microsoft,3 der damals wichtigsten Computertechnikfirma auf Erden.4 Eric wusste, dass ein Großteil des Datenverkehrs bei Google von Menschen verursacht wurde, die den Internet Explorer von Microsoft verwendeten. Wie alle bei Google glaubte er daran, dass das Internet die technologische Plattform der Zukunft und die Suche eine besonders nützliche Anwendung sei. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis sich unsere Freunde aus Redmond ernsthaft dafür interessieren würden, was wir machten. Und wenn Microsoft sich ernsthaft dafür zu interessieren begann, was eine Start-up-Firma machte, dann wurde es wirklich interessant.5 Die Zukunft der Firma stand auf dem Spiel und es war nicht klar, was man tun sollte. Die Notiz von Moritz war eine Aufforderung zum Handeln. Er bat Eric, das Team zusammenzurufen und einen Plan zu entwickeln, der klare Anforderungen an alle Bereiche der Firma formulierte: Produktentwicklung, Verkauf, Marketing, Finanzierung und Unternehmensentwicklung. Alle Aspekte der Unternehmensführung von Google sollten auf den Tisch kommen. Es wurde sogar darüber gesprochen, die eigenwillige Start-up-Struktur der Firma zugunsten von traditionellen Geschäftsbereichen aufzugeben, um leichter neue Einnahmequellen zu erschließen (darum sollte es in dem neuen Plan auch gehen). Vor allen Dingen sollte der Plan Ziele festlegen sowie eine Strategie, welche Produkte auf den Markt gebracht werden sollten und wann. Kurz gesagt wollte Moritz das, was jedes normale Vorstandsmitglied sich wünscht: einen umfassenden Businessplan. Seine Notiz schloss er schwungvoll mit: "Warum nicht einen Abend Mitte August festlegen, an dem die Pläne für die größte Kampagne, die wir alle je erleben werden, fertig sein sollen." Da die Produkte das Schlüsselelement des Plans sein würden, übergab Eric das Projekt Jonathan. Seine Anweisung: "Wiedervorlage in zwei Wochen". Es gab jedoch ein Problem, einmal abgesehen davon, dass wir mit einer riesigen Firma konkurrieren würden. Einerseits hatte Moritz recht: Um gegen den größten Gorilla im Dschungel anzutreten, brauchten wir einen Plan. Aber andererseits hatte er auch unrecht. Um zu verstehen, warum er falsch lag und warum er uns unbeabsichtigt in eine schwierige Lage brachte, muss man verstehen, was für eine Firma Google war. "Sprecht einfach mit den Ingenieuren!" Als Sergey und Larry 1998 Google gründeten, hatten sie keinerlei betriebswirtschaftliche Ausbildung oder Erfahrung. Sie hielten das für einen Vorteil. Die Firma zog mehrmals um, vom Studentenwohnheim in Stanford in Susan Wojcickis Garage6 in Menlo Park, dann in Büros in Palo Alto und schließlich nach Mountain View. Die beiden Gründer handelten nach wenigen einfachen Prinzipien. Das erste und wichtigste lautete, immer den Nutzer im Fokus zu haben. Sie glaubten, wenn sie Top-Dienstleistungen lieferten, würde sich das Finanzielle von allein regeln. Sie mussten einfach nur die beste Suchmaschine der Welt bauen. Dann würden sie auch Erfolg haben.7 Ihr Plan für die Entwicklung der Top-Suchmaschine und all der anderen tollen Dienste war ähnlich einfach: Engagiere so viele begabte Softwareentwickler wie möglich und lass ihnen alle Freiheiten der Welt. Das passte zu einer Firma, die im Informatiklabor einer Uni entstanden war, denn in der akademischen Welt ist das wichtigste Kapital der Intellekt (auch wenn es an manchen amerikanischen Universitäten scheinbar die Fähigkeit ist, einen Football 50 Meter weit zu werfen). Doch während die meisten Firmen nur behaupten, ihre Mitarbeiter wären für sie das Wichtigste, war es in Larrys und Sergeys Firma tatsächlich so. Dabei war ihr Verhalten weder eine Unternehmensbotschaft noch Altruismus. Sie waren einfach überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit den besten Ingenieuren der einzige Weg sei, Google zum Erfolg zu führen und die hochgesteckten Erwartungen zu erfüllen. Und sie meinten wirklich Ingenieure: So stoppten die Gründer Eric bei seinem ersten Versuch, Sheryl Sandberg einzustellen, heute Geschäftsführerin von Facebook, weil sie keine Ingenieurin war. (Später arbeitete Sheryl über sechs Jahre höchst erfolgreich bei Google.) Als die Firma größer wurde, sahen sie das nicht mehr ganz so eng. Aber noch heute gilt die Regel, dass mindestens die Hälfte der Angestellten bei Google (der "Googler") Ingenieure sein sollten. Die Managementstrategien, nach denen die Gründer die Firma führten, waren ebenfalls recht simpel. Wie die Professoren in den Informatiklaboren in Stanford, die ihren Studenten nicht die Themen ihrer Arbeiten vorschrieben, sondern nur Hilfe und Vorschläge anboten, gaben Larry und Sergey ihren Angestellten jede Menge Freiheit und förderten die Kommunikation, damit sich alle in etwa in die gleiche Richtung bewegten. Sie waren absolut überzeugt von der enormen Bedeutung des Internets und den Möglichkeiten der Suche. Dies kommunizierten sie bei informellen Treffen mit den kleinen Teams aus Ingenieuren, die in den Büros von Google arbeiteten, sowie bei den firmenweiten "TGIF"-Meetings jeden Freitag- nachmittag. Was die Abläufe anging, nahmen es die Gründer recht locker. Jahrelang war das wichtigste Werkzeug des Finanzmanagements bei Google eine Tabelle mit den 100 wichtigsten Projekten der Firma, in die jeder Einsicht nehmen konnte und die zweimal im Vierteljahr diskutiert wurde. Diese Meetings dienten teils dem Status-Update, teils der Zuweisung von Geldern und teils dem Brainstorming. Das System war nicht besonders kompliziert: Den meisten Projekten wurde eine Priorität zwischen 1 und 5 zugewiesen. Manche wurden aber auch als "neu/irre" oder "geheim" eingestuft. (Heute wissen wir den Unterschied nicht mehr so genau, aber damals ergab das alles Sinn. So ungefähr jedenfalls.) Eine Planung auf längere Sicht war weder vorgesehen noch erwünscht. Sollte sich etwas Wichtigeres ergeben, würden die Ingenieure das schon merken und die Liste entsprechend anpassen. Dieser Fokus auf die Arbeit der Ingenieure wurde auch beibehalten, als die Firma ihr Managementteam erweiterte. Die beiden Gründer stellten Eric nicht wegen seines Geschäftssinns ein, sondern wegen seiner Erfolge und Erfahrungen als technischer Entwickler (Eric war Unix-Experte und hatte an der Entwicklung von Java mitgewirkt) und seines Rufs als Computerfreak von Bell Labs. Jonathan engagierten sie trotz seiner Abschlüsse in Volks- und Betriebswirtschaftslehre, weil er sich bei Apple und Excite@ Home als innovativer und engagierter Produktmanager bewiesen hatte. Dass wir Betriebswirtschaftler waren, schadete uns nicht direkt, aber es war auch kein Vorteil, zumindest nicht nach Sergeys und Larrys Meinung. Nicht lange nach seinem Eintritt in die Firma erlebte Jonathan, wie stark die Gründer traditionellen Geschäftsabläufen gegenüber abgeneigt waren. Als gestandener Produktmanager besaß er reichlich Erfahrung bei der Entwicklung von Produkten nach dem "Stage-Gate-Modell". Dazu gehört eine Reihe genau definierter Phasen mit Zielsetzungen ("Gates"), deren Einhaltung immer wieder von der Führungsebene überprüft wird. Dieses Vorgehen dient dazu, Finanzmittel sparsam einzusetzen und Informationen aus den verschiedenen Entwicklungsbereichen zu einem kleinen Entscheiderteam zu kanalisieren. Jonathan ging davon aus, dass es diese Art von Disziplin war, die er Google beibringen sollte, und er war sehr zuversichtlich, dass er genau der Richtige dafür war. Wenige Monate später legte Jonathan Larry Page einen Produktplan vor, der streng dem Gate-basierten Ansatz folgte. Es gab Zielsetzungen und Kontrollen, Prioritäten und einen Zweijahresplan, welche Produkte Google wann herausbringen würde - ein Meisterwerk wie aus dem Lehrbuch. Es fehlte nur noch der stürmische Beifall für Jonathan, oder ein kräftiger Schlag auf die Schulter. Doch dazu sollte es nicht kommen: Larry hasste das Ganze. "Hast du schon mal einen Plan gesehen, der vom Team über- erfüllt wurde?", fragte er. Eigentlich nicht. "Haben deine Teams schon mal bessere Produkte geliefert, als im Plan vorgesehen?" Wieder nein. "Was soll dann der Plan? Er hält uns nur auf. Es muss einen besseren Weg geben. Sprich einfach mit den Ingenieuren." Noch während Larry redete, begann Jonathan zu verstehen, dass die Ingenieure, von denen die Rede war, nicht Ingenieure im traditionellen Sinne waren. Sicher, sie waren brillante Programmierer und Systementwickler, aber daneben waren viele von ihnen auch recht geschäftstüchtig und kreativ. Da sie alle Akademiker waren, räumten Larry und Sergey ihnen ungewöhnlich viel Freiheit und Macht ein. Sie mit traditionellen Planungsstrukturen zu konfrontieren, würde nicht funktionieren. Sie würden sie vielleicht leiten, aber auch einschränken. "Und warum willst du das tun?", fragte Larry Jonathan. "Das wäre doch dumm." Als uns Mike Moritz und der Vorstand baten, einen traditionellen Businessplan zu erstellen, wollten wir aber nicht dumm dastehen. Wir wussten, der Patient Google würde einen nach BWL-Maßstäben korrekten, festgelegten Plan abstoßen wie ein fremdes Organ, das seinem Körper eingepflanzt werden sollte - was er ja in vieler Hinsicht auch wäre. Als Betriebswirte waren wir mit der Vorstellung zu Google gekommen, einen chaotischen Haufen "zu beaufsichtigen". Aber im Sommer 2003 waren wir bereits lange genug bei der Firma, um zu wissen, dass sie anders geführt wurde als die meisten. Die Angestellten hatten besondere Freiheiten und arbeiteten in einer neuen, sich schnell entwickelnden Branche. Wir kannten die Dynamik dieser Branche mittlerweile gut und wussten, dass der einzige Weg, sich gegen Microsoft durchzusetzen, darin bestand, weiterhin exzellente Produkte zu liefern. Gleichzeitig hatten wir mitgekriegt, dass Höchstleistungen nicht durch einen vorgegebenen Businessplan er- reicht werden konnten. Es ging vielmehr darum, die besten Ingenieure zu engagieren, die wir finden konnten, und sie einfach machen zu lassen. Unsere Gründer hatten intuitiv verstanden, wie man ein Unternehmen dieser neuen Branche führt, aber sie wussten nicht - das hatten sie selbst gesagt -, wie sie ihre Firma ausbauen sollten, um ihre ehrgeizige Vision zu verwirklichen. Sie waren großartige Führer von Informatikern, aber für eine große Firma brauchte es mehr als Informatiker. Wir hatten auch verstanden, dass die Regeln, die uns leiten sollten, noch nicht geschrieben waren. Sie bestanden sicherlich nicht in einem traditionellen Businessplan, wie Mike Moritz ihn sich wünschte. Also saßen wir fest in diesem kritischen Moment der Firmengeschichte. Wir konnten tun, was Moritz wollte, und einen Businessplan aufstellen. Dann wäre der Vorstand glücklich. Aber so würden wir die Mitarbeiter nicht motivieren und auch keine neuen Talente in die Firma holen, die wir so dringend brauchten. Außerdem würde ein traditioneller Businessplan der Dynamik dieser brandneuen Branche nicht gerecht werden. Vor allen Dingen aber: Die Firmengründer würden ihn killen, ehe er überhaupt das Licht der Welt erblickt hätte. Und womöglich uns beide gleich mit hinauswerfen. Der Finnland-Plan Der Plan, den wir dem Vorstand schließlich vorlegten, ähnelte einem traditionellen Businessplan genug, um die Vorstandsmitglieder zufriedenzustellen. Sie verließen das Meeting mit dem Gefühl: Ja, wir haben einen Businessplan! Im Rückblick ist es überraschend, wie richtig er in vielerlei Hinsicht war. Er war komplett darauf ausgerichtet, wie Google sich auf seine Nutzer konzentrieren und exzellente Plattformen und Produkte schaffen würde. Es hieß darin, Google würde immer Dienstleistungen von höchster Qualität anbieten und diese Dienstleistungen leicht zugänglich machen. Die Basis der Firma sollten die Nutzer sein, und mehr Nutzer würden mehr Anzeigenkunden mitbringen. Er enthielt auch ein paar tak- tische Überlegungen, wie wir uns gegen Konkurrenten zur Wehr setzen könnten, aber im Prinzip würden wir Microsoft entgegentreten, indem wir hervorragende Produkte entwickelten. Und das, so sollte sich zeigen, war genau die richtige Strategie. Microsoft forderte uns massiv heraus und gab angeblich fast elf Milliarden Dollar8 aus, um Google seine Führungsposition bei Suche und Werbung im Internet streitig zu machen. Programme von Microsoft wie MSN Search, Windows Live und Bing sowie Ankäufe wie aQuantive wurden nicht wirklich populär. Das lag nicht daran, dass sie schlecht waren, sondern daran, dass Google gut darauf vorbereitet war. Wir arbeiteten permanent an der Optimierung der Suche. Wir fügten Bilder hinzu, Bücher, YouTube, Shopping-Daten und alle möglichen anderen Informationspools, die wir finden konnten. Wir entwickelten eigene webbasierte Anwendungen wie Gmail und Docs. Wir verbesserten unsere Infrastruktur rasant, sodass wir die exponentiell anwachsenden Onlinedaten und Inhalte schneller indizieren konnten.9 Wir machten die Suche schneller und stellten sie in weiteren Sprachen zur Verfügung. Außerdem verbesserten wir unsere Benutzeroberfläche, um die Bedienung zu erleichtern. Wir fügten Karten hinzu und verbesserten die regionalen Ergebnisse. Wir arbeiteten mit Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass wir für unsere Nutzer immer leicht erreichbar waren. Wir expandierten sogar in Bereiche, in denen Microsoft führend war, etwa mit Google Chrome, dem von Anfang an schnellsten und sichersten Browser am Markt. Und wir finanzierten all das mit einem höchst effizienten und effektiven Werbesystem. Eric warnte sein Team immer wieder, Microsoft würde "über uns herfallen, Schlag auf Schlag." Sie taten es und tun es immer noch. Trotzdem übertraf der Businessplan alle unsere Erwartungen. Heute ist Google eine 50 Milliarden Dollar schwere Firma mit fast 50 000 Angestellten in mehr als 40 Ländern. Unsere Aktivitäten sind sehr breit gestreut: von der Internetsuche und der Suchmaschinenwerbung bis hin zu Videos und anderen Formen des digitalen Marketing. Wir haben den Übergang von einer PC-zentrierten Welt zu einer mobilfunkorientierten geschafft, haben erfolgreich eine Reihe von Hardwareprodukten auf den Markt gebracht und technische Entwicklungsarbeit geleistet - mit neuen Projekten, die zum Beispiel in Aussicht stellen, allen Menschen Internetzugang zu bringen, und selbstfahrende Autos zu bauen. Einer der Hauptgründe für unseren Erfolg ist jedoch, dass der Plan, den wir dem Vorstand an jenem Tag im Jahr 2003 vorlegten, kein echter Businessplan war. Er enthielt keine Finanzprognosen oder eine Auflistung der Einnahmequellen. Es gab keine Marktanalyse hinsichtlich der Wünsche von Nutzern, Anzeigenkunden oder Partnern, kein Konzept zur Marktsegmentierung und keinen Plan, welche Anzeigenkunden wir zuerst ins Visier nehmen sollten. Es gab keine Multi-Channel-Strategie und keine Strategie für den Verkauf unserer Werbeprodukte. Wir hatten keinen Organisationsplan, der vorgeschrieben hätte, dass der Verkauf dieses tat, die Produktentwicklung jenes und die Ingenieure wieder etwas anderes. Es gab keine Produkt-Roadmap, die im Einzelnen festlegte, was wir wann bauen würden. Es gab keinen Finanzplan. Es gab keine Zielvorgaben oder Eckdaten, anhand derer Vorstand und Führungskräfte unsere Fortschritte hätten überprüfen können. Und es gab auch keine Strategie, wie wir die Firma ausbauen würden beziehungsweise wie wir dem "Sprecht-doch-einfach-mit-den-Ingenieuren"- Ethos von Larry und Sergey treu bleiben könnten, während wir gleichzeitig ein Unternehmen schufen, das es mit dem mächtigsten Technologiehersteller der Welt aufnehmen konnte. Es fehlte auch eine Strategie, wie wir unser kühnes Ziel erreichen könnten, das Leben von Milliarden Menschen zu verändern. Wir ließen das aus, einfach weil wir es nicht wussten. Was Managementstrategien anging, konnten wir damals nur sicher sagen, dass vieles von dem, was wir beide im 20. Jahrhundert gelernt hatten, falsch, und dass es Zeit für einen Neuanfang war. Wenn das Erstaunliche normal ist Heute leben und arbeiten wir alle in einer neuen Ära, dem Jahrhundert des Internets. Technologische Fortschritte beunruhigen die Wirtschaft und das Tempo der Veränderungen nimmt zu. Das stellt alle Unternehmensführer vor besondere Herausforderungen. Um diese zu verstehen, ist es nützlich, sich diese erstaunliche Entwicklung einmal vor Augen zu führen. Drei machtvolle Technologietrends haben die Bedingungen in den meisten Branchen grundsätzlich verändert. Erstens sind mit dem Internet Informationen frei verfügbar geworden, in großer Menge und überall. Zweitens ist durch mobile Endgeräte und Netzwerke die Welt näher zusammengerückt und ständig vernetzt. Und drittens stehen mit dem Cloud- Computing10 praktisch unendliche Rechner- und Speicherkapazitäten sowie eine Unmenge komplexer Tools und Anwendungen zur Verfügung - für jedermann, auf preiswerter Pay-As-You-Go-Basis. Ein Großteil der Weltbevölkerung hat noch keinen Zugang zu diesen Technologien, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sich das ändert und die nächsten 5 Milliarden Menschen online sind.
Vorwort von Larry Page, Mitbegründer und CEO von Google Als ich jünger war und anfing, mir Gedanken über meine Zukunft zu machen, beschloss ich, entweder Professor zu werden oder eine Firma zu gründen. Ich glaubte, beides gäbe mir viel Autonomie - die Freiheit, von Grund auf neu zu denken, ausgehend von den Anforderungen der realen Welt, anstatt vorherrschende "Weisheiten" nachzubeten. Wie Eric und Jonathan in diesem Band erläutern, haben wir versucht, diese Freiheit des Denkens auf fast alles bei Google anzuwenden. Sie war die treibende Kraft bei unseren größten Erfolgen und einigen beeindruckenden Fehlschlägen. Das Prinzip, immer von Grund auf neu zu denken, brachte Google ins Rollen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich wachte auf und dachte: Was wäre, wenn du das gesamte Web herunterladen und nur die Links behalten könntest? Ich nahm einen Stift und skizzierte die Details, um herauszufinden, ob das tatsächlich möglich wäre. Die Idee, eine Suchmaschine zu bauen, hatte ich damals noch gar nicht. Erst später begriffen Sergey und ich, dass man deutlich bessere Suchergebnisse erzielen würde, wenn man die Webseiten nach ihren Links hierarchisierte. Auch Gmail begann als Hirngespinst. Und als Andy Rubin vor einem Jahrzehnt Android ins Leben rief, hielten die meisten Leute es für völlig verrückt, die gesamte Handybranche auf ein quelloffenes Betriebssystem auszurichten. Mit der Zeit habe ich gelernt, dass es überraschend schwierig ist, ein Team zu Höchstleistungen zu bewegen. Die meisten Menschen werden nicht zu jenem mutigen innovativen Denken erzogen, das wir "Moonshot Thinking" nennen. Sie meinen schnell, dass bestimmte Dinge unmöglich sind, anstatt zu gucken, was vorhanden und was damit möglich ist. Deshalb verwenden wir bei Google so viel Energie darauf, unabhängige Den- ker zu gewinnen und uns hohe Ziele zu stecken. Wenn du die richtigen Leute beschäftigst und deine Träume groß genug sind, wirst du sie in der Regel erreichen. Und sogar wenn du scheiterst, hast du wahrscheinlich etwas Wichtiges gelernt. Viele Firmen machen gern, was sie immer getan haben, mit nur geringfügigen Veränderungen. Diese Schritt-für-Schritt-Strategie führt mit der Zeit zur Bedeutungslosigkeit, besonders im Bereich der Technik, wo Veränderungen meist revolutionär sind, nicht evolutionär. Man muss sich also zwingen, Risiken einzugehen. Darum investieren wir in Bereiche, die sehr spekulativ wirken: etwa selbstfahrende Autos oder Internetversorgung durch gasgefüllte Ballons. Als wir mit Google Maps anfingen, dachten die Leute auch, es sei unmöglich, die ganze Welt zu kartieren und jede einzelne Straße zu fotografieren. Daraus kann man nur den Schluss ziehen, dass die großen Visionen von heute schon in wenigen Jahren viel weniger wild wirken werden. Das sind einige der Prinzipien, die ich für wichtig halte. Auf den nächsten Seiten folgen noch mehr. Ich hoffe, dass Sie diese Ideen verwenden können, um Ihre eigene, erstaunliche Geschichte daraus zu entwickeln! Einleitung - Erfahrungen aus erster Hand Im Juli 2003 war Eric Schmidt seit zwei Jahren CEO von Google Inc., als er von Mike Moritz, Partner bei Sequoia Capital und Vorstandsmitglied sowie Investor der Firma, eine E-Mail mit folgendem Vorschlag erhielt: "Könnten Sie sich vielleicht ein Zeitfenster von drei Stunden Mitte August vorstellen, in dem das Management dem Vorstand unseren Plan zum Wettbewerb mit Finnland vorlegen kann? (Ich glaube nicht, dass wir bis zum Meeting im September warten sollten. Das Thema ist viel zu wichtig und wir wissen alle, wie kurz ein Jahr ist, wenn es um die Konkurrenz mit Finnland geht.)" Wenn man nicht weiß, worum es geht, klingt das recht verwirrend. Warum sollte Google, ein fünf Jahre altes Internet-Start-up-Unternehmen mit ein paar Hundert Mitarbeitern aus Mountain View, Kalifornien, mit Finnland konkurrieren, einem Land mit 5 Millionen Einwohnern, das mehr als 8 000 Kilometer entfernt liegt und im Allgemeinen als freundlich und friedlich gilt? Die Finnland-E-Mail traf ein, als Eric sich gerade einigermaßen bei Google eingelebt hatte. Er war zuvor CEO bei Novell gewesen und hatte für Sun Microsystems und Bell Labs gearbeitet. Er war in Nord-Virginia aufgewachsen, hatte seinen Abschluss als Elektroingenieur in Princeton gemacht und besaß einen Master sowie einen Doktortitel in Informatik von der University of California in Berkeley. Das heißt, er war nicht nur die Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Informatikern gewöhnt, er war selbst einer. Doch als er zu Google kam, lernte er eine ganz neue Welt kennen. Das begann gleich am ersten Tag. Als er sein Büro betrat, das für einen Spitzen-CEO schon ziemlich bescheiden war, stellte er fest, dass es bereits von mehreren Softwareentwicklern benutzt wurde. Anstatt sie hinauszuwerfen, zog er ins Büro nebenan, das mehr einer Besenkammer mit Fenster glich. Ein paar Wochen später kam es dann noch schlimmer. Eines Morgens, als er den Flur zu seiner Besenkammer entlangging, bemerkte er, dass sei-ne Assistentin Pam Shore ein besorgtes Gesicht machte.1 Schon bald fand er heraus, warum: Er hatte einen neuen Bürokollegen. Es war einer der Ingenieure, die an der Suchmaschine arbeiteten, Amit Patel. Er erklärte Eric, in seinem Büro säßen bereits fünf Mitarbeiter und ein weiterer käme noch hinzu. Seine Idee, einen der Schreibtische durchzusägen, um Platz zu gewinnen, habe nicht funktioniert. Verglichen mit dem Platz, der ihm im Moment zur Verfügung stand, erschien Erics Kammer recht geräumig. Also zog Amit ein. (Die zuständigen Mitarbeiter hatten es abgelehnt, Amits Sachen in Erics Büro zu transportieren; daher hatte er es selbst gemacht.) Amit und Eric teilten sich das Büro mehrere Monate. Ganz offensichtlich ging es in dieser Welt nicht darum, die Bedeutung eines Mitarbeiters durch die Quadratmeterzahl seines Büros deutlich zu machen. Abgesehen von der etwas ungewöhnlichen Unterbringung ging Erics Wechsel zu Google problemlos vonstatten. Sein Verhältnis zu den beiden Gründern Larry Page und Sergey Brin wurde mit jedem Tag besser. Die Werbeplattform der Firma, AdWords, begann erhebliche Einnahmen zu erzielen. Beim Börsengang der Firma 2004 waren die meisten Beobachter von den Zahlen positiv überrascht. Und auch wenn das Verb "google" (deutsch "googeln") erst drei Jahre später ins Oxford English Dictionary aufgenommen werden sollte2, gehörte die Suche mit Google schon jetzt für Millionen Nutzer zum täglichen Leben. Und die Firma wuchs. Jeden Monat kamen Dutzende neuer Angestellter hinzu, darunter im Februar 2002 der neue Produktchef Jonathan Rosenberg. Er kam von Excite@ Home und Apple zu Google, um das Produktmanagementteam der Firma zu verstärken und Erics Mitarbeiterstab abzurunden. Mikes E-Mail zeigte bereits: Es gab einen großen Konkurrenten in der Ferne und das waren nicht unsere nordischen Freunde auf der anderen Seite des Atlantiks. "Finnland" war unser interner Deckname für Microsoft,3 der damals wichtigsten Computertechnikfirma auf Erden.4 Eric wusste, dass ein Großteil des Datenverkehrs bei Google von Menschen verursacht wurde, die den Internet Explorer von Microsoft verwendeten. Wie alle bei Google glaubte er daran, dass das Internet die technologische Plattform der Zukunft und die Suche eine besonders nützliche Anwendung sei. Daher war es nur eine Frage der Zeit, bis sich unsere Freunde aus Redmond ernsthaft dafür interessieren würden, was wir machten. Und wenn Microsoft sich ernsthaft dafür zu interessieren begann, was eine Start-up-Firma machte, dann wurde es wirklich interessant.5 Die Zukunft der Firma stand auf dem Spiel und es war nicht klar, was man tun sollte. Die Notiz von Moritz war eine Aufforderung zum Handeln. Er bat Eric, das Team zusammenzurufen und einen Plan zu entwickeln, der klare Anforderungen an alle Bereiche der Firma formulierte: Produktentwicklung, Verkauf, Marketing, Finanzierung und Unternehmensentwicklung. Alle Aspekte der Unternehmensführung von Google sollten auf den Tisch kommen. Es wurde sogar darüber gesprochen, die eigenwillige Start-up-Struktur der Firma zugunsten von traditionellen Geschäftsbereichen aufzugeben, um leichter neue Einnahmequellen zu erschließen (darum sollte es in dem neuen Plan auch gehen). Vor allen Dingen sollte der Plan Ziele festlegen sowie eine Strategie, welche Produkte auf den Markt gebracht werden sollten und wann. Kurz gesagt wollte Moritz das, was jedes normale Vorstandsmitglied sich wünscht: einen umfassenden Businessplan. Seine Notiz schloss er schwungvoll mit: "Warum nicht einen Abend Mitte August festlegen, an dem die Pläne für die größte Kampagne, die wir alle je erleben werden, fertig sein sollen." Da die Produkte das Schlüsselelement des Plans sein würden, übergab Eric das Projekt Jonathan. Seine Anweisung: "Wiedervorlage in zwei Wochen". Es gab jedoch ein Problem, einmal abgesehen davon, dass wir mit einer riesigen Firma konkurrieren würden. Einerseits hatte Moritz recht: Um gegen den größten Gorilla im Dschungel anzutreten, brauchten wir einen Plan. Aber andererseits hatte er auch unrecht. Um zu verstehen, warum er falsch lag und warum er uns unbeabsichtigt in eine schwierige Lage brachte, muss man verstehen, was für eine Firma Google war. "Sprecht einfach mit den Ingenieuren!" Als Sergey und Larry 1998 Google gründeten, hatten sie keinerlei betriebswirtschaftliche Ausbildung oder Erfahrung. Sie hielten das für einen Vorteil. Die Firma zog mehrmals um, vom Studentenwohnheim in Stanford in Susan Wojcickis Garage6 in Menlo Park, dann in Büros in Palo Alto und schließlich nach Mountain View. Die beiden Gründer handelten nach wenigen einfachen Prinzipien. Das erste und wichtigste lautete, immer den Nutzer im Fokus zu haben. Sie glaubten, wenn sie Top-Dienstleistungen lieferten, würde sich das Finanzielle von allein regeln. Sie mussten einfach nur die beste Suchmaschine der Welt bauen. Dann würden sie auch Erfolg haben.7 Ihr Plan für die Entwicklung der Top-Suchmaschine und all der anderen tollen Dienste war ähnlich einfach: Engagiere so viele begabte Softwareentwickler wie möglich und lass ihnen alle Freiheiten der Welt. Das passte zu einer Firma, die im Informatiklabor einer Uni entstanden war, denn in der akademischen Welt ist das wichtigste Kapital der Intellekt (auch wenn es an manchen amerikanischen Universitäten scheinbar die Fähigkeit ist, einen Football 50 Meter weit zu werfen). Doch während die meisten Firmen nur behaupten, ihre Mitarbeiter wären für sie das Wichtigste, war es in Larrys und Sergeys Firma tatsächlich so. Dabei war ihr Verhalten weder eine Unternehmensbotschaft noch Altruismus. Sie waren einfach überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit den besten Ingenieuren der einzige Weg sei, Google zum Erfolg zu führen und die hochgesteckten Erwartungen zu erfüllen. Und sie meinten wirklich Ingenieure: So stoppten die Gründer Eric bei seinem ersten Versuch, Sheryl Sandberg einzustellen, heute Geschäftsführerin von Facebook, weil sie keine Ingenieurin war. (Später arbeitete Sheryl über sechs Jahre höchst erfolgreich bei Google.) Als die Firma größer wurde, sahen sie das nicht mehr ganz so eng. Aber noch heute gilt die Regel, dass mindestens die Hälfte der Angestellten bei Google (der "Googler") Ingenieure sein sollten. Die Managementstrategien, nach denen die Gründer die Firma führten, waren ebenfalls recht simpel. Wie die Professoren in den Informatiklaboren in Stanford, die ihren Studenten nicht die Themen ihrer Arbeiten vorschrieben, sondern nur Hilfe und Vorschläge anboten, gaben Larry und Sergey ihren Angestellten jede Menge Freiheit und förderten die Kommunikation, damit sich alle in etwa in die gleiche Richtung bewegten. Sie waren absolut überzeugt von der enormen Bedeutung des Internets und den Möglichkeiten der Suche. Dies kommunizierten sie bei informellen Treffen mit den kleinen Teams aus Ingenieuren, die in den Büros von Google arbeiteten, sowie bei den firmenweiten "TGIF"-Meetings jeden Freitag- nachmittag. Was die Abläufe anging, nahmen es die Gründer recht locker. Jahrelang war das wichtigste Werkzeug des Finanzmanagements bei Google eine Tabelle mit den 100 wichtigsten Projekten der Firma, in die jeder Einsicht nehmen konnte und die zweimal im Vierteljahr diskutiert wurde. Diese Meetings dienten teils dem Status-Update, teils der Zuweisung von Geldern und teils dem Brainstorming. Das System war nicht besonders kompliziert: Den meisten Projekten wurde eine Priorität zwischen 1 und 5 zugewiesen. Manche wurden aber auch als "neu/irre" oder "geheim" eingestuft. (Heute wissen wir den Unterschied nicht mehr so genau, aber damals ergab das alles Sinn. So ungefähr jedenfalls.) Eine Planung auf längere Sicht war weder vorgesehen noch erwünscht. Sollte sich etwas Wichtigeres ergeben, würden die Ingenieure das schon merken und die Liste entsprechend anpassen. Dieser Fokus auf die Arbeit der Ingenieure wurde auch beibehalten, als die Firma ihr Managementteam erweiterte. Die beiden Gründer stellten Eric nicht wegen seines Geschäftssinns ein, sondern wegen seiner Erfolge und Erfahrungen als technischer Entwickler (Eric war Unix-Experte und hatte an der Entwicklung von Java mitgewirkt) und seines Rufs als Computerfreak von Bell Labs. Jonathan engagierten sie trotz seiner Abschlüsse in Volks- und Betriebswirtschaftslehre, weil er sich bei Apple und Excite@ Home als innovativer und engagierter Produktmanager bewiesen hatte. Dass wir Betriebswirtschaftler waren, schadete uns nicht direkt, aber es war auch kein Vorteil, zumindest nicht nach Sergeys und Larrys Meinung. Nicht lange nach seinem Eintritt in die Firma erlebte Jonathan, wie stark die Gründer traditionellen Geschäftsabläufen gegenüber abgeneigt waren. Als gestandener Produktmanager besaß er reichlich Erfahrung bei der Entwicklung von Produkten nach dem "Stage-Gate-Modell". Dazu gehört eine Reihe genau definierter Phasen mit Zielsetzungen ("Gates"), deren Einhaltung immer wieder von der Führungsebene überprüft wird. Dieses Vorgehen dient dazu, Finanzmittel sparsam einzusetzen und Informationen aus den verschiedenen Entwicklungsbereichen zu einem kleinen Entscheiderteam zu kanalisieren. Jonathan ging davon aus, dass es diese Art von Disziplin war, die er Google beibringen sollte, und er war sehr zuversichtlich, dass er genau der Richtige dafür war. Wenige Monate später legte Jonathan Larry Page einen Produktplan vor, der streng dem Gate-basierten Ansatz folgte. Es gab Zielsetzungen und Kontrollen, Prioritäten und einen Zweijahresplan, welche Produkte Google wann herausbringen würde - ein Meisterwerk wie aus dem Lehrbuch. Es fehlte nur noch der stürmische Beifall für Jonathan, oder ein kräftiger Schlag auf die Schulter. Doch dazu sollte es nicht kommen: Larry hasste das Ganze. "Hast du schon mal einen Plan gesehen, der vom Team über- erfüllt wurde?", fragte er. Eigentlich nicht. "Haben deine Teams schon mal bessere Produkte geliefert, als im Plan vorgesehen?" Wieder nein. "Was soll dann der Plan? Er hält uns nur auf. Es muss einen besseren Weg geben. Sprich einfach mit den Ingenieuren." Noch während Larry redete, begann Jonathan zu verstehen, dass die Ingenieure, von denen die Rede war, nicht Ingenieure im traditionellen Sinne waren. Sicher, sie waren brillante Programmierer und Systementwickler, aber daneben waren viele von ihnen auch recht geschäftstüchtig und kreativ. Da sie alle Akademiker waren, räumten Larry und Sergey ihnen ungewöhnlich viel Freiheit und Macht ein. Sie mit traditionellen Planungsstrukturen zu konfrontieren, würde nicht funktionieren. Sie würden sie vielleicht leiten, aber auch einschränken. "Und warum willst du das tun?", fragte Larry Jonathan. "Das wäre doch dumm." Als uns Mike Moritz und der Vorstand baten, einen traditionellen Businessplan zu erstellen, wollten wir aber nicht dumm dastehen. Wir wussten, der Patient Google würde einen nach BWL-Maßstäben korrekten, festgelegten Plan abstoßen wie ein fremdes Organ, das seinem Körper eingepflanzt werden sollte - was er ja in vieler Hinsicht auch wäre. Als Betriebswirte waren wir mit der Vorstellung zu Google gekommen, einen chaotischen Haufen "zu beaufsichtigen". Aber im Sommer 2003 waren wir bereits lange genug bei der Firma, um zu wissen, dass sie anders geführt wurde als die meisten. Die Angestellten hatten besondere Freiheiten und arbeiteten in einer neuen, sich schnell entwickelnden Branche. Wir kannten die Dynamik dieser Branche mittlerweile gut und wussten, dass der einzige Weg, sich gegen Microsoft durchzusetzen, darin bestand, weiterhin exzellente Produkte zu liefern. Gleichzeitig hatten wir mitgekriegt, dass Höchstleistungen nicht durch einen vorgegebenen Businessplan er- reicht werden konnten. Es ging vielmehr darum, die besten Ingenieure zu engagieren, die wir finden konnten, und sie einfach machen zu lassen. Unsere Gründer hatten intuitiv verstanden, wie man ein Unternehmen dieser neuen Branche führt, aber sie wussten nicht - das hatten sie selbst gesagt -, wie sie ihre Firma ausbauen sollten, um ihre ehrgeizige Vision zu verwirklichen. Sie waren großartige Führer von Informatikern, aber für eine große Firma brauchte es mehr als Informatiker. Wir hatten auch verstanden, dass die Regeln, die uns leiten sollten, noch nicht geschrieben waren. Sie bestanden sicherlich nicht in einem traditionellen Businessplan, wie Mike Moritz ihn sich wünschte. Also saßen wir fest in diesem kritischen Moment der Firmengeschichte. Wir konnten tun, was Moritz wollte, und einen Businessplan aufstellen. Dann wäre der Vorstand glücklich. Aber so würden wir die Mitarbeiter nicht motivieren und auch keine neuen Talente in die Firma holen, die wir so dringend brauchten. Außerdem würde ein traditioneller Businessplan der Dynamik dieser brandneuen Branche nicht gerecht werden. Vor allen Dingen aber: Die Firmengründer würden ihn killen, ehe er überhaupt das Licht der Welt erblickt hätte. Und womöglich uns beide gleich mit hinauswerfen. Der Finnland-Plan Der Plan, den wir dem Vorstand schließlich vorlegten, ähnelte einem traditionellen Businessplan genug, um die Vorstandsmitglieder zufriedenzustellen. Sie verließen das Meeting mit dem Gefühl: Ja, wir haben einen Businessplan! Im Rückblick ist es überraschend, wie richtig er in vielerlei Hinsicht war. Er war komplett darauf ausgerichtet, wie Google sich auf seine Nutzer konzentrieren und exzellente Plattformen und Produkte schaffen würde. Es hieß darin, Google würde immer Dienstleistungen von höchster Qualität anbieten und diese Dienstleistungen leicht zugänglich machen. Die Basis der Firma sollten die Nutzer sein, und mehr Nutzer würden mehr Anzeigenkunden mitbringen. Er enthielt auch ein paar tak- tische Überlegungen, wie wir uns gegen Konkurrenten zur Wehr setzen könnten, aber im Prinzip würden wir Microsoft entgegentreten, indem wir hervorragende Produkte entwickelten. Und das, so sollte sich zeigen, war genau die richtige Strategie. Microsoft forderte uns massiv heraus und gab angeblich fast elf Milliarden Dollar8 aus, um Google seine Führungsposition bei Suche und Werbung im Internet streitig zu machen. Programme von Microsoft wie MSN Search, Windows Live und Bing sowie Ankäufe wie aQuantive wurden nicht wirklich populär. Das lag nicht daran, dass sie schlecht waren, sondern daran, dass Google gut darauf vorbereitet war. Wir arbeiteten permanent an der Optimierung der Suche. Wir fügten Bilder hinzu, Bücher, YouTube, Shopping-Daten und alle möglichen anderen Informationspools, die wir finden konnten. Wir entwickelten eigene webbasierte Anwendungen wie Gmail und Docs. Wir verbesserten unsere Infrastruktur rasant, sodass wir die exponentiell anwachsenden Onlinedaten und Inhalte schneller indizieren konnten.9 Wir machten die Suche schneller und stellten sie in weiteren Sprachen zur Verfügung. Außerdem verbesserten wir unsere Benutzeroberfläche, um die Bedienung zu erleichtern. Wir fügten Karten hinzu und verbesserten die regionalen Ergebnisse. Wir arbeiteten mit Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass wir für unsere Nutzer immer leicht erreichbar waren. Wir expandierten sogar in Bereiche, in denen Microsoft führend war, etwa mit Google Chrome, dem von Anfang an schnellsten und sichersten Browser am Markt. Und wir finanzierten all das mit einem höchst effizienten und effektiven Werbesystem. Eric warnte sein Team immer wieder, Microsoft würde "über uns herfallen, Schlag auf Schlag." Sie taten es und tun es immer noch. Trotzdem übertraf der Businessplan alle unsere Erwartungen. Heute ist Google eine 50 Milliarden Dollar schwere Firma mit fast 50 000 Angestellten in mehr als 40 Ländern. Unsere Aktivitäten sind sehr breit gestreut: von der Internetsuche und der Suchmaschinenwerbung bis hin zu Videos und anderen Formen des digitalen Marketing. Wir haben den Übergang von einer PC-zentrierten Welt zu einer mobilfunkorientierten geschafft, haben erfolgreich eine Reihe von Hardwareprodukten auf den Markt gebracht und technische Entwicklungsarbeit geleistet - mit neuen Projekten, die zum Beispiel in Aussicht stellen, allen Menschen Internetzugang zu bringen, und selbstfahrende Autos zu bauen. Einer der Hauptgründe für unseren Erfolg ist jedoch, dass der Plan, den wir dem Vorstand an jenem Tag im Jahr 2003 vorlegten, kein echter Businessplan war. Er enthielt keine Finanzprognosen oder eine Auflistung der Einnahmequellen. Es gab keine Marktanalyse hinsichtlich der Wünsche von Nutzern, Anzeigenkunden oder Partnern, kein Konzept zur Marktsegmentierung und keinen Plan, welche Anzeigenkunden wir zuerst ins Visier nehmen sollten. Es gab keine Multi-Channel-Strategie und keine Strategie für den Verkauf unserer Werbeprodukte. Wir hatten keinen Organisationsplan, der vorgeschrieben hätte, dass der Verkauf dieses tat, die Produktentwicklung jenes und die Ingenieure wieder etwas anderes. Es gab keine Produkt-Roadmap, die im Einzelnen festlegte, was wir wann bauen würden. Es gab keinen Finanzplan. Es gab keine Zielvorgaben oder Eckdaten, anhand derer Vorstand und Führungskräfte unsere Fortschritte hätten überprüfen können. Und es gab auch keine Strategie, wie wir die Firma ausbauen würden beziehungsweise wie wir dem "Sprecht-doch-einfach-mit-den-Ingenieuren"- Ethos von Larry und Sergey treu bleiben könnten, während wir gleichzeitig ein Unternehmen schufen, das es mit dem mächtigsten Technologiehersteller der Welt aufnehmen konnte. Es fehlte auch eine Strategie, wie wir unser kühnes Ziel erreichen könnten, das Leben von Milliarden Menschen zu verändern. Wir ließen das aus, einfach weil wir es nicht wussten. Was Managementstrategien anging, konnten wir damals nur sicher sagen, dass vieles von dem, was wir beide im 20. Jahrhundert gelernt hatten, falsch, und dass es Zeit für einen Neuanfang war. Wenn das Erstaunliche normal ist Heute leben und arbeiten wir alle in einer neuen Ära, dem Jahrhundert des Internets. Technologische Fortschritte beunruhigen die Wirtschaft und das Tempo der Veränderungen nimmt zu. Das stellt alle Unternehmensführer vor besondere Herausforderungen. Um diese zu verstehen, ist es nützlich, sich diese erstaunliche Entwicklung einmal vor Augen zu führen. Drei machtvolle Technologietrends haben die Bedingungen in den meisten Branchen grundsätzlich verändert. Erstens sind mit dem Internet Informationen frei verfügbar geworden, in großer Menge und überall. Zweitens ist durch mobile Endgeräte und Netzwerke die Welt näher zusammengerückt und ständig vernetzt. Und drittens stehen mit dem Cloud- Computing10 praktisch unendliche Rechner- und Speicherkapazitäten sowie eine Unmenge komplexer Tools und Anwendungen zur Verfügung - für jedermann, auf preiswerter Pay-As-You-Go-Basis. Ein Großteil der Weltbevölkerung hat noch keinen Zugang zu diesen Technologien, aber es wird nicht mehr lange dauern, bis sich das ändert und die nächsten 5 Milliarden Menschen online sind.
Firmenkultur – Glaub an deine Slogans [Bild vergrößern] An einem Freitagnachmittag im Mai 2002 spielte Larry Page auf der Webseite von Google herum. Er tippte Suchbegriffe ein und schaute, was für Resultate und Anzeigen er bekam. Und er war nicht zufrieden damit, was er sah. Während Google eine Menge relevante und passende Ergebnisse lieferte, standen manche Anzeigen in gar keinem Bezug zum Suchbegriff.22 Wenn er etwa nach »Kawasaki H1B« suchte, bekam er jede Menge Anzeigen von Rechtsanwälten, die Einwanderern ihre Hilfe bei der Beschaffung von H-1B US-Visa anboten, aber keine einzige für den Motorrad-Oldtimer, auf den sich seine Suchanfrage bezog. Die Suche nach »französischer Höhlenmalerei« brachte reichlich Anzeigen, in denen es hieß »Kauf französische Höhlenmalerei bei …«, verbunden mit dem Namen eines Online-Händlers, der ganz offensichtlich nicht mit französischer Höhlenmalerei (oder Faksimiles davon) handelte. Larry war entsetzt, was für nutzlose Informationen die AdWords-Maschine, die die passendsten Anzeigen zu einer Suche finden soll, unseren Nutzern bisweilen zumutete. Damals dachte Eric immer noch, Google sei ein normales Start-up-Unternehmen. Aber was in den nächsten 72 Stunden passierte, veränderte seine Einschätzung nachhaltig. In einer normalen Firma würde der CEO, der ein schlechtes Produkt entdeckt hat, die Person anrufen, die für das Produkt zuständig ist. Es würde ein Meeting einberufen werden, vielleicht auch zwei oder drei, um das Problem zu diskutieren, mögliche Lösungen durchzuspielen und sich für einen Weg zu entscheiden. Dann würde ein Plan zur Umsetzung erstellt werden, und nach einer hinreichenden Menge von Tests zur Qualitätssicherung würde die Lösung schließlich implementiert werden. In einer normalen Firma dauert das mehrere Wochen. Larry aber ging anders vor. Er druckte die Seiten mit den Ergebnissen aus, die ihm nicht gefielen, markierte die unpassenden Anzeigen, heftete das Ganze ans schwarze Brett in der Küche neben dem Billardtisch und schrieb in großen Buchstaben oben drüber: these ads suck (»Diese Anzeigen sind Mist«). Dann ging er nach Hause. Er rief niemanden an und schickte niemandem eine E-Mail. Er berief keine Krisensitzung ein und erwähnte das Thema gegenüber keinem von uns. Um 5:05 Uhr am folgenden Montag verschickte einer unserer Suchmaschinen-Ingenieure, Jeff Dean, eine E-Mail. Er und ein paar Kollegen (darunter Georges Harik, Ben Gomes, Noam Shazeer und Olcan Sercinoglu) hatten Larrys Notiz am Schwarzen Brett gesehen und fanden ebenfalls, dass die Anzeigen nicht besonders gut passten. Doch in Jeffs E-Mail ging es nicht bloß darum, dem Gründer zuzustimmen und ihm zuzusichern, man würde sich um die Sache kümmern. Stattdessen enthielt sie eine detaillierte Analyse, warum das Problem aufgetreten war, sowie eine mögliche Lösung. Des Weiteren lieferte sie einen Link zur testweisen Umsetzung dieser Lösung, die die Fünf über das Wochenende programmiert hatten. Und sie enthielt Beispielergebnisse, die zeigten, inwiefern der neue Prototyp dem aktuellen System überlegen war. Die Details des Lösungsansatzes waren äußerst komplex (unser Lieblingsausdruck in der Mail war: »Anfrage-Ausschnitts-Termvektor«). Aber im Großen und Ganzen ging es wohl darum, einen »Relevanzwert« für jede Anzeige zu berechnen, der über ihre Qualität in Hinblick auf die Suchanfrage entscheiden würde, um danach zu bestimmen, ob und wo diese Anzeige auf der Seite platziert werden sollte. Diese grundsätzliche Einsicht – dass Anzeigen nach ihrer Relevanz platziert werden sollten, nicht ausschließlich danach, wie viel der Anzeigenkunde bereit war zu zahlen, oder nach der Anzahl der Klicks, die sie erhielten – wurde zum grundlegenden Prinzip für das AdWords-System von Google und für ein Milliardengeschäft. Und der Clou der Geschichte? Jeff und sein Team gehörten noch nicht einmal zum Anzeigenteam. Sie waren einfach an jenem Freitagnachmittag im Büro gewesen und hatten Larrys Notiz gelesen. Sie hatten verstanden: Wenn deine Mission darin besteht, sämtliche Informationen weltweit zu organisieren und universell zugänglich und nutzbar zu machen, ist es ein Problem, wenn es Anzeigen gibt (die auch Informationen sind), die Mist sind. Daher beschlossen sie, das Problem zu lösen. Übers Wochenende. Der Grund, warum eine Handvoll Angestellter – die nicht unmittelbar für die Anzeigen zuständig waren oder für ihre schlechte Qualität zur Verantwortung gezogen werden konnten – ihr Wochenende damit verbrachten, das Problem von anderen zu lösen, liegt in der Firmenkultur. Jeff und seine Leute kannten die Prioritäten der Firma genau und wussten, dass sie die Freiheit hatten, jedes Problem zu lösen, das dem Erfolg im Weg stand. Wären sie gescheitert, hätte ihnen das niemand vorgeworfen, und im Erfolgsfall würde niemand – auch nicht das Anzeigenteam – darauf neidisch sein. Aber es war nicht Googles Firmenkultur, die aus den fünf Ingenieuren problemlösende Ninjas machte, die der Firmenstrategie übers Wochenende eine neue Richtung gaben. Es war die Firmenkultur, die überhaupt dafür gesorgt hatte, dass die Ninjas bei der Firma arbeiteten. Viele Leute, die über einen neuen Job nachdenken, machen sich vor allem Gedanken über ihre neue Funktion und Verantwortung, die Erfolgsbilanz der Firma, die Branche und die Vergütung. Weiter unten auf der Liste, möglicherweise irgendwo zwischen »Länge des Anfahrtsweges« und »Qualität des Kaffees in der Kantine«, kommt die Firmenkultur. Für smarte Kreative steht die Firmenkultur jedoch ganz oben: Damit sie effektiv arbeiten können, müssen sie ihren Arbeitsplatz mögen. Darum ist die Firmenkultur das Wichtigste, wenn man eine neue Firma gründet oder eine neue Initiative startet. In den meisten Firmen entsteht die Firmenkultur irgendwie von selbst – niemand plant sie. Das kann funktionieren. Aber damit überlässt man eine entscheidende Komponente des Erfolgs dem Zufall. An anderer Stelle in diesem Buch predigen wir den Wert des Experimentierens und die Tugend des Scheiterns, aber die Firmenkultur ist vielleicht die eine Ausnahme. Hier können gescheiterte Experimente wirklich wehtun. Wenn sie einmal etabliert ist, lässt sich die Firmenkultur kaum noch verändern. Denn schon früh im Leben der Firma setzt eine Tendenz der Selbstselektion ein. Menschen, die an das glauben, was eine Firma tut, fühlen sich von ihr angezogen, während Menschen, die nicht daran glauben, dort gar nicht erst auftauchen.23 Wenn eine Firma eine Kultur vertritt, in der jeder sagen kann, was er denkt, und Entscheidungen von Gremien statt von Einzelnen gefällt werden, arbeiten dort auch Angestellte mit ähnlichen Vorstellungen. Wenn aber diese Firma versucht, einen eher autokratischen Führungsstil einzuführen, wird sie große Schwierigkeiten haben, ihre Mitarbeiter zur Kooperation zu bewegen. Eine solche Veränderung würde sich nicht nur gegen das richten, wofür die Firma steht, sondern auch gegen die persönlichen Überzeugungen ihrer Mitarbeiter. Und das ist ein sehr steiniger Weg. Der smarte Ansatz besteht darin, sich bereits bei der Firmengründung zu überlegen und zu definieren, was für eine Art von Firmenkultur man haben möchte. Man tut das am besten, indem man die smarten Kreativen befragt, die Ihr Kernteam bilden, diejenigen, die die Botschaft kennen und daran genauso glauben wie die Gründer der Firma. Die Firmenkultur wird vom Gründer geprägt. Doch am besten wird sie von dem Team der ersten Stunde widergespiegelt. Man sollte also genau dieses Team fragen: Was ist uns wichtig? Woran glauben wir? Wer wollen wir sein? Wie soll unsere Firma handeln und Entscheidungen treffen? Höchstwahrscheinlich werden die Antworten die Werte der Gründer beinhalten, sie aber um Einsichten aus den verschiedenen Blickwinkeln und Erfahrungen des Teams ergänzen. Die meisten Firmen tun das nicht. Sie haben Erfolg und beschließen dann, ihre Firmenkultur zu dokumentieren. Diese Aufgabe fällt meist jemandem in der Personal- oder der PR-Abteilung zu, der möglicherweise kein Mitglied des Gründerteams war. Trotzdem wird von ihm erwartet, ein Leitbild zu formulieren, das das Wesen der Firma beschreibt. Das Ergebnis ist in der Regel eine Ansammlung von Phrasen über »begeisterte« Kunden, »maximalen« Shareholder Value und »innovative« Angestellte. Der Unterschied zwischen erfolgreichen Firmen und weniger erfolgreichen Firmen besteht aber darin, ob die Angestellten diese Worte glauben. Hier ein kleines Gedankenexperiment: Denken Sie an einen Job, den Sie einmal hatten. Jetzt versuchen Sie, die Firmenphilosophie von damals wiederzugeben. Gelingt Ihnen das? Und wenn ja, glauben Sie daran? Halten Sie das Leitbild für authentisch? Spiegelt es die Handlungsweisen und die Kultur der Firma und ihrer Angestellten wider? Oder hört es sich nach etwas an, das ein paar Leute aus der Marketing- und Kommunikationsabteilung eines Abends mit einem Sixpack und einem Wörterbuch zusammengestoppelt haben? Etwas wie: »Unsere Mission besteht darin, einzigartige Partnerschaften mit und Werte für unsere Kunden aufzubauen, durch das Wissen, die Kreativität und die Hingabe unserer Mitarbeiter, was zu herausragenden Ergebnissen für unsere Aktionäre führt.«24 Da ist wirklich alles drin: Kunden – abgehakt, Angestellte – abgehakt, Aktionäre – abgehakt. Dieses Leitbild ist das von Lehman Brothers – oder war es bis zu ihrem Konkurs 2008. Sicher stand auch Lehman für irgendetwas, aber was es war, lässt sich diesen Worten nicht entnehmen. Im Gegensatz zu den Geschäftsführern von Lehman Brothers nahm David Packard, der als einer der Ersten in...
| Erscheint lt. Verlag | 8.1.2015 |
|---|---|
| Mitarbeit |
Sonstige Mitarbeit: Alan Eagle |
| Übersetzer | Meike Grow, Ute Mareik, Gregor Runge |
| Vorwort | Larry Page |
| Zusatzinfo | mit zahlreichen Abbildungen |
| Verlagsort | Frankfurt |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | How Google Works |
| Maße | 142 x 228 mm |
| Gewicht | 600 g |
| Einbandart | gebunden |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Beruf / Finanzen / Recht / Wirtschaft ► Wirtschaft |
| Informatik ► Web / Internet ► Suchmaschinen / Web Analytics | |
| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Unternehmensführung / Management | |
| Schlagworte | Betrieb • betriebliche Innovation • Betriebsführung • Company • Corporate Culture • Corporate Identity • Development of a company • Dispositiver Faktor • Enterprise • Erfolg • Erfolgsgeschichte • Erfolgspotenzial • Erfolgsrezept • Erfolgsstrategie • Firm • Firma • Führung • Führungskraft • General Management • Geschäftsleitung • Gewerbebetrieb • Gewerbliche Wirtschaft • Google • Google (Firma) • Google (Unternehmen) • Idee • Ideen • Innovation • Leadership • Leitbild des Betriebs • Leitung • Management • Management-by-Prinzip • Managementphilosophie • Managementtheorie • Mitarbeiterführung • Neuheit • Organisational Culture • Organisationskultur • Organizational Culture • Organizational identity • Personalbetreuung • Personalführung • Profi • Search Engine • Silicon Valley • Sinnesorgan • Steuerung • Success • Suchmaschine • Suchmaschinenanbieter • Suchmaschinentechnik • Teamführung • Unternehmen • Unternehmensbereich • Unternehmensentwicklung • Unternehmensführung • Unternehmensgeschichte • Unternehmensidentität • Unternehmenskultur • Unternehmensleitbild • Unternehmensleitung • Unternehmensmission • Unternehmensphilosophie • Unternehmensstrategie • Unternehmung • Vision • Wirtschaft (Gewerbliche Wirtschaft) • Wirtschaftsunternehmen |
| ISBN-10 | 3-593-50216-X / 359350216X |
| ISBN-13 | 978-3-593-50216-8 / 9783593502168 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich