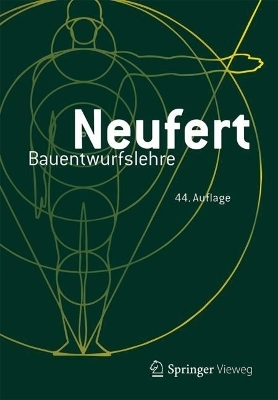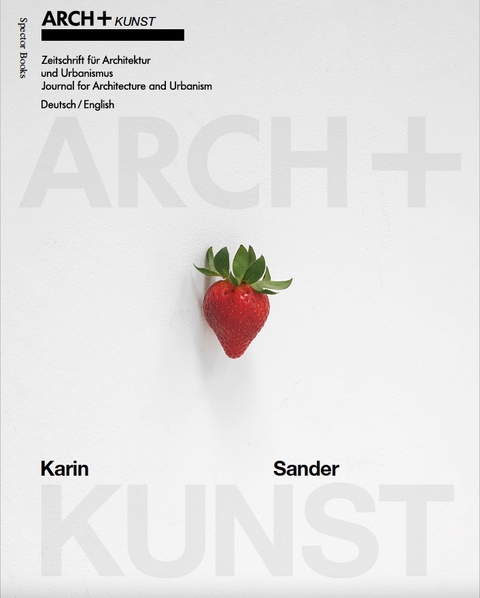
ARCH+KUNST
Arch+ (Verlag)
978-3-931435-82-0 (ISBN)
den Heftseiten und der Wand als konstitutivem künstlerischem und raumbildendem Element. Hierbei spielt Karin Sanders Werkgruppe „kitchen pieces“ (ab 2012) eine zentrale Rolle und wird in diesem Zusammenhang erstmalig umfangreich publiziert. Daneben reflektiert die Monografie ihren gemeinsam mit Philip Ursprung konzipierten Beitrag „Neighbours“ für den Schweizer Pavillon auf der Architekturbiennale in Venedig 2023, der die trennende Mauer zum Nachbarpavillon buchstäblich auflöste. Als Ausblick fragt die Publikation nach dem Statuswandel der Wand, die sich in der 3D-Scan-basierten Arbeitsweise und Forschung der Künstlerin und ihres Lehrstuhls an der ETH Zürich in Daten verwandelt.
Einige Antworten auf eine Frage, die niemals beantwortet werden sollte Karin Sander und Anh-Linh Ngo im Gespräch mit Beatriz Colomina und Mark Wigley über das Verhältnis von Kunst und Architektur Anh-Linh Ngo: Wir haben heute zwei alte Freund*innen von ARCH+, Beatriz Colomina und Mark Wigley, eingeladen, um mit ihnen über die neue Ausgabe zu sprechen, die die Künstlerin Karin Sander für uns konzipiert hat: ARCH+KUNST. Wie sich aus dem Titel bereits ergibt, geht es darum, das komplexe Verhältnis zwischen den beiden verwandten Disziplinen der Architektur und Kunst zu beleuchten. Ich kann mir eigentlich keine bessere Partnerin als Karin für diese Aufgabe vorstellen, da viele ihrer Arbeiten in einer ontologischen Beziehung zu dem Raum stehen, in dem sie ausgestellt werden, und zwar in einem Maße, dass die jeweiligen Wände und Decken selbst zum Gegenstand der Arbeit werden. Dies ist beispielsweise bei ihren berühmten Wandstücken (1986) der Fall, für die Karin rechteckige Wandabschnitte poliert hat, bis sie glänzten. Oder auch Untitled (1993), eine Arbeit, die für die Art Cologne realisiert wurde, bei der sie ein rechteckiges Stück der Raufasertapete, mit der die Wände der Galerie tapeziert waren, herausgeschnitten und gerahmt hat, um sie anschließend an derselben Stelle wieder aufzuhängen. Ein wesentlicher Aspekt von Karins Arbeit ist die Beobachtung von Systemen und Formen der Interaktion. So haben sich Karin Sander und Philip Ursprung 2023 für ihren Beitrag zur 18. Architekturbiennale in Venedig mit der komplexen Beziehung zwischen zwei benachbarten Gebäuden beschäftigt: dem von Bruno Giacometti 1951/1952 entworfenen Schweizer Pavillon und dem Venezolanischen Pavillon nach dem Entwurf von Carlo Scarpa 1954/1956. Ich finde, sie sind so etwas wie falsche Freunde: Nach außen halten sie eine Fassade trauter Zweisamkeit aufrecht, während sich in Wahrheit zwischen den beiden Ländern, die sie vertreten, in geografischer, politischer und ökonomischer Hinsicht Welten auftun. Eines der zentralen Elemente ihrer Intervention war die Entfernung eines Teils der Umfassungsmauer des Schweizer Pavillons, so dass sich die Besucher*innen zwischen den beiden Länderpavillons ungehindert bewegen konnten. Ich möchte mit unserem Gespräch gerne an diesem Punkt anknüpfen und fragen: Was verrät uns diese Intervention einer Künstlerin, die an der Architekturbiennale teilnimmt? Beatriz Colomina: Architekt*innen haben erst spät die Bühne der Biennalen betreten. Die Biennalen waren gewöhnlich das Terrain von Künstler*innen. Sehr viele anerkannte Architekt*innen sind außerordentlich erfolgreich, ohne jemals von einer Galerie vertreten worden zu sein. Das Auftauchen von Architektur im Raum der Galerie als Gegenstand der Ausstellung und nicht als ihr bloßer räumlicher Kontext, ist ein relativ junges Phänomen; ein postmodernes Phänomen. Es war kein Zufall, dass die erste, von Paolo Portoghesi kuratierte Architekturbiennale in Venedig „Die Gegenwart der Vergangenheit“, 1980 auf dem Höhepunkt der Postmoderne stattfand, beinahe ein Jahrhundert nachdem die erste Biennale von Venedig ins Leben gerufen worden war. Seitdem ist eine immer größere Freizügigkeit unter Architekt*innen zu beobachten, das breite Spektrum zwischen Kunst und Kuratieren auszuloten. Doch obwohl das gepflegte Erscheinungsbild der Kulturjetsetter auch hier vorherrscht, ist die Architekturbiennale von Venedig im wahrsten Sinne des Wortes arm dran, da sie nicht annähernd so viel Kapital bewegt wie ihr Pendant für die Kunst. Der Unterschied ist krass. Die Budgets, die Architekt*innen für ihre Installationen zur Verfügung stehen, sind im Vergleich zu denen der Künstler*innen mager. Eine Teilnahme von Künstler*innen an der Biennale steht zweifelsfrei für Erfolg. Kunsthändler*innen und Galerien haben ein großes wirtschaftliches Interesse daran, ihre Künstler*innen finanziell zu unterstützen. Architekt*innen sind hingegen meistens auf sich allein gestellt. Nicht selten bedeutet die Teilnahme in Venedig für sie den finanziellen Bankrott. Mark Wigley: Der späte Auftritt der Architektur in Venedig liegt teilweise darin begründet, dass die Biennale selbst Architektur ist. Ich meine dies in einem wörtlichen Sinne: Die Biennale von Venedig besteht aus einer Reihe von Gebäuden und Gärten, die speziell für das Ausstellen von Kunst errichtet wurden. Die Architektur hat einst die Kunst beherbergt. Nun beherbergt sie auch sich selbst. Architektur bietet Architektur einen Raum. Was geschieht, wenn Architektur nicht länger die Hülle ist, sondern das ausgestellte Sujet? Noch interessanter ist die Frage, was mit einer Architektur geschieht, die sich selbst beherbergen muss. Ausgehend von der schwindelerregenden Denkfigur einer Architektur, die die Kunst beherbergt, die die Architektur beherbergt, könnte man Karins Intervention als Teil eines endlosen Spiels zwischen den beiden Disziplinen betrachten, wobei sie lediglich eine von vielen Schichten der Interaktion abgetragen hat, die sich jeweils innerhalb irgendeiner Architektur abspielen. Anh-Linh Ngo: Architektur, die Kunst beherbergt, die Architektur beherbergt ist ein guter Ausgangspunkt, um sich Karins vieldeutiger Position zu nähern. Mir kommt dabei unwillkürlich der berühmte Begriff der Anarchitektur in den Sinn, den Gordon Matta-Clark einst für seine Arbeit geprägt hat. Mark, du bist ein Experte für Gordon Matta-Clark, der sich auch nicht eindeutig der Kunst oder der Architektur zuordnen lässt. Wenn Karin eine Backsteinmauer des Schweizer Pavillons teilweise entfernt, agiert sie dann als Künstlerin oder als Architektin? Wo kann man ihre Praxis verorten? Mark Wigley: Das ist eine schwierige Frage. Hoffentlich nähern wir uns einer Antwort, wenn wir unser Gespräch noch eine Weile fortgesetzt und mal der einen oder anderen Zuordnung den Vorzug gegeben haben. Vielleicht beginnen wir mit einer sehr grundlegenden Feststellung: Mauern sind mitunter eine knifflige Angelegenheit. Jede Mauer hat gleichermaßen das Potenzial zu trennen und zu verbinden. Mauern markieren den Unterschied zwischen Innen und Außen. Allerdings ist die andere Seite der Mauer, von mir aus betrachtet, immer noch das Außen meines Innen und damit ein Teil meines Innen. Die Mauer des Schweizer Pavillons zu entfernen, ist ein komplexer Vorgang, denn gerade durch die Beseitigung der Mauer hat Karin diese erst sichtbar gemacht. Durch das Entfernen der Mauer wird eine Verbindung zwischen zwei Pavillons hergestellt und zugleich die Existenz dieser Trennmauer überhaupt ins Bewusstsein gerufen sowie dieses Wissen bekräftigt. Karin Sander: Der Gedanke, dass wir durch die Beseitigung der Mauer das Wissen um ihre Existenz bekräftigt haben, ist sehr interessant. Tatsächlich wurde durch das Entfernen der Mauer plötzlich eine andere Mauer sichtbar, die die Venezolaner in den frühen 1980er-Jahren direkt hinter einem lange zuvor von den Schweizern installierten Metallgitter errichtet haben. Die Venezolaner wollten offenkundig ihre eigene Mauer haben, womit sie auf ihre Art wohl sagen wollten: „Wenn das Außen eures Gitters noch Teil eures Innen ist, dann ist dies unsere Mauer, die das Ende unseres Innen markiert.“ Mark Wigley: Wie spannend. Das hat was von einer Tatortbegehung. Ich frage mich nun, wenn man Mauern erst durch ihre Beseitigung sichtbar machen kann, heißt das im Umkehrschluss, dass Mauern normalerweise unsichtbar sind? Karin Sander: Ja, in vielerlei Hinsicht sind sie es, weil man sie oft nicht sieht, oder um genauer zu sein, weil man sie nicht gezielt anschaut. Vielmehr blickt man auf das, was von Mauern bzw. Wänden umgeben ist oder auf die an ihnen aufgehängten Kunstwerke, aber nur selten auf die Mauern und Wände selbst. Anh-Linh Ngo: Das gilt nicht nur für die Mauern bzw. Wände, sondern auch für Böden und Decken. Für eine andere Installation, die 2011 im Neuen Berliner Kunstverein (n.b.k.) realisiert wurde, hat Karin Löcher in die Decke des Ausstellungsraumes gebohrt und damit eine direkte Verbindung zu den Büroräumen der Galerie im Obergeschoss hergestellt. Die Löcher befanden sich genau an der Stelle, wo normalerweise die Papierkörbe gestanden hätten, nämlich neben den Tischen der Mitarbeiter-*innen der Galerie. Durch diese Maßnahme konnten die Mitarbeiter*innen den Papiermüll in den Löchern entsorgen, der damit direkt im Galerieraum landete und sich dort zu kleinen Müllbergen anhäufte. Durch die Beseitigung eines Teils der Decke hat Karin nicht nur buchstäblich einen Schnitt durch das Gebäude gelegt, sondern auch durch die Institution und damit den Besucher*innen ein Blick hinter die Kulissen eröffnet. Karin Sander: Gleichzeitig fängt man natürlich an, darüber nachzudenken, was man wegwirft, wenn der Papiermüll auf diese Weise ausgestellt wird. Einige der entsorgten Dokumente waren auf die ein oder andere Weise bearbeitet worden, um sicherzustellen, dass niemand ihren vertraulichen Inhalt lesen konnte. Andere befanden sich noch – oder wieder – in einem Umschlag oder waren sorgfältig geschreddert worden. Und solche, von denen die Mitarbeiter*innen wollten, dass sie öffentlich zu sehen wären, wurden vollständig aufgefaltet, bevor man sie in den Galerieraum fallen ließ. Diese kleinen Entscheidungen darüber, was durch die Löcher entsorgt wird und was nicht und in welchem Zustand es hindurchgeworfen wird, verraten, wie jemand mit dem Wissen um Sichtbarkeit und Transparenz umgeht. Diese Strategien der Sichtbarmachung sind wahrscheinlich auch wesentlich für eure Arbeit als Architekturhistoriker*innen oder? Beatriz Colomina: Ja, absolut. An der Idee, Löcher durch die Decke des Galerieraumes zu bohren, finde ich besonders den Aspekt spannend, dass Decken ohnehin immer durch alle möglichen Leitungen miteinander verbunden sind. In den Decken wird eine Vielzahl von Dingen transportiert, allerdings ist die Architektur gewöhnlich darum bemüht, diese Verbindungen zu verbergen. Architekt*innen verstecken alles hinter glatten, weiß verputzten Wänden, um die Illusion zu erzeugen, dass jeder Raum eine für sich abgeschlossene Einheit ist. Wenn uns ständig bewusst wäre, dass wir physisch mit den Körperflüssigkeiten anderer verbunden sind, wäre das ja ziemlich furchtbar! So betreten wir aber unsere Wohnung und tun so, als würden wir in völliger Isolation leben. Deine Intervention im n.b.k. führt den Besucher*innen vor Augen, dass es auch in dem aseptischen Raum der Galerie Infrastrukturen gibt, die uns verbinden, ob sie nun materiell sind oder nicht. Die Institution wird sichtbar, und zwar nicht nur durch die Briefe und Dokumente, die durch die Löcher fallen gelassen werden, sondern vor allem durch die Erkenntnis, dass nicht alle Dokumente auf diese Weise entsorgt werden. Was du also mit deiner Arbeit sichtbar gemacht hast, ist nicht so sehr der Inhalt der Dokumente, sondern die Tatsache, dass hinter den Kulissen sorgfältig abgewogen wird, was die Öffentlichkeit zu sehen bekommt und was nicht. Insofern hast du mit dieser Maßnahme verdeutlicht, dass sich hinter den vermeintlich neutralen, weißen Wänden der Galerie Vorgänge abspielen, die den Betrachter*innen bewusst vorenthalten werden. In diesem Sinne gibt es, wie ich finde, viele Überschneidungen mit unserer Arbeit. Karin Sander: Da wir gerade über Papierkörbe sprechen, muss ich an eine witzige Passage aus deinem Buch X-Ray Architecture denken. Edith Farnsworth beklagt sich hier darüber, dass sie ihren Mülleimer verstecken muss, damit die Leute ihn nicht durch die Glasfassade von Farnsworth House sehen können: „Der Mülleimer würde den Anblick des ganzen Hauses verschandeln“, so sagt sie, „daher verstecke ich ihn, etwas entfernt von der Spüle, in einem Schrank. Mies spricht von ‚freiem Raum‘: aber sein Raum ist sehr festgelegt […] jedes Aufstellen von Möbeln wird zu einem Riesenproblem, da man durch das Haus, wie bei einem Röntgenbild, hindurchschauen kann.“1 Ist es nicht erstaunlich, wie eine kleine unschuldige Bemerkung ausreicht, um das gesamte modernistische Dogma der Transparenz zu demontieren? Mark Wigley: Allerdings. Aber lass uns an diesem Punkt des Gesprächs noch einmal innehalten. Ausgehend von dem, was wir bisher gesagt haben, könnte man behaupten, dass Architekt*innen Dinge verstecken, während Künstler*innen sie offenlegen: Architekt*innen vermitteln ein Bild von Transparenz, verstecken dann aber die Eingeweide des Gebäudes hinter weiß verputzten Wänden, während Karin eben diese Oberfläche aufbricht, um die verborgenen Prozesse sichtbar zu machen, die sich hinter den Kulissen des Galerieraumes abspielen. Beatriz Colomina: Das ist eine mögliche Betrachtungsweise, aber natürlich sind Unterscheidungen nie so eindeutig. Mitunter agieren Architekt*innen genauso wie Künstler*innen. Beispielsweise waren die ersten architektonischen Experimente mit Transparenz laut des architekturhistorischen Kanons der Moderne gerade für Ausstellungssituationen und nicht als reale Bauaufgabe konzipiert, wie Bruno Tauts Pavillon für die Ausstellung des Deutschen Werkbundes 1914 in Köln, oder Ludwig Mies van der Rohes visionärer Entwurf für ein gläsernes Hochhaus an der Friedrichstraße in Berlin. Wären diese Projekte im Auftrag eines Bauherrn oder einer Bauherrin und mit strengeren Budgetvorgaben entwickelt wurden, wären sie sicherlich ganz anders oder zumindest nicht annähernd so innovativ ausgefallen. Ihre Radikalität ist untrennbar mit der Tatsache verbunden, dass sie in Räumen an der Schnittstelle zwischen Kunst und Architektur entstanden sind, wo die Architekt*innen von den Restriktionen der Funktion befreit waren. Vor diesem Hintergrund könnte man sagen, dass diese Projekte eher der Kunst als der Architektur zuzuordnen sind. Man denke nur an den Barcelona-Pavillon, der keine Funktion außerhalb seiner selbst hatte. Als Mies gefragt wurde, was im Inneren des Pavillons ausgestellt werden würde, soll er geantwortet haben: „Nichts wird darin ausgestellt, der Pavillon selbst ist das Exponat.“2 Mark Wigley: Gab es im Barcelona-Pavillon Rohrleitungen? Beatriz Colomina: Nein, es gab keine Rohrleitungen! Und das ist genau der Punkt. Wie Matta-Clark sagen würde, „der Unterschied zwischen Architektur und Skulptur besteht darin, ob es Rohre gibt oder nicht.“3 Gemäß dieser Logik ließe sich behaupten, dass der Barcelona-Pavillon faktisch keine Architektur ist, sondern eine Skulptur. Anh-Linh Ngo: Bedeutet dies, dass die Befreiung der Architektur von der Funktion sie automatisch zu Kunst macht? Und hat Kunst per definitionem keine Funktion? Mark Wigley: Ich möchte versuchen diese Fragen mit einer Überspitzung zu beantworten: Architektur ist nichts als Verdrängung. Es ist nicht nur der Umstand, dass Architekt*innen Dinge verstecken; Architektur ist letztlich nichts anderes als das Ergebnis eines Verbergens, ein pathologisches Symptom der Verdrängung. Genau das ist ihre eigentliche Aufgabe. Bekanntermaßen stehen Architekt*innen mit der Funktion auf Kriegsfuß, ihre Stärke liegt vielmehr auf der formalen Ebene, wenn sie mit Formen Dinge verbergen, einschließlich der Beschaffenheit der Form selbst. Wenn man sich ein trockenes und warmes Haus wünscht, sollte man auf keinen Fall eine Architektin oder einen Architekten beauftragen. Architektur gibt der Verdrängung ein Gesicht, das, was man sieht, wenn man die Dinge nicht sieht – daher die unheimliche weiße Oberfläche, die alles verbirgt. Wenn die Kunst enthüllt und die Architektur verschleiert, kann das Wechselspiel zwischen ihnen niemals eindeutig sein. Kunst, die traditionell als Kunst gilt, weil sie nicht zweckgebunden ist, könnte eine stärkere Zweckorientierung haben, als wir gemeinhin glauben, während die Architektur vielleicht nichts mit der Zweckgebundenheit zu tun hat, die wir ihr immer andichten. Ich sehe in der Kunst nicht nur einen Zweck, sie funktioniert häufig auch auf eine Art und Weise, die der ähnelt, wie wir sie von der Architektur erwarten würden: Sie bietet Komfort, Erinnerung, Ordnung und Raum für Interaktion und Wünsche. Um also auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wo Karins Arbeit anzusiedeln ist, frage ich mich, ob wir vielleicht einfach nur der Antwort auf eine Frage hinterherjagen, die niemals beantwortet werden sollte, denn genau darin liegt die Stärke ihrer Arbeit: dass sie sich nicht bequem auf eine der beiden Seiten von Kunst und Architektur verorten lässt, sondern vielmehr in deren Komplikationen verweilt. Warum sollten wir an einer Künstlerin interessiert sein, deren Werk eindeutig der Sphäre der Kunst angehört? Vermutlich sind Beatriz und ich deshalb so von Karins Arbeit fasziniert, weil sie viel mehr Architektin ist als wir selbst. Beatriz Colomina: Na, dann ist die Sache ja einfach, denn wir sind ja nicht wirklich Architekt*innen! Karin Sander: Und wie sieht es mit der Funktion von Architektur im Verhältnis zur Kunst aus? Wir hatten einmal den Studierenden an der ETH Zürich eine hypothetische Aufgabe gestellt, in der sie gebeten wurden, eine virtuelle Architektur zu entwerfen und eine Kunstausstellung darin vorzuschlagen. Das ist keine leichte Aufgabe, denn ein virtueller Raum unterliegt keinen Beschränkungen. Man könnte nacheinander 30.000 Zeichnungen in einem unendlich langen Gang zeigen! Selbst wenn man es mit einer interessanteren Idee versuchen würde, wird es nicht funktionieren, da die Kunst Zwänge und Widerstand braucht, sie braucht die Reibung mit den Bindungen der Architektur. Die Architektur dient nicht nur als Rahmen der Kunst und das Kunstwerk ist nicht nur ein Objekt, dessen Status als Kunst von der weißen Wand definiert wird, an der es hängt. Kunst und Architektur befinden sich in einem ständigen Dialog. Immer dann, wenn es zu Reibungen zwischen ihnen kommt, wird es meistens erst richtig interessant. Kunst und Architektur existieren nicht in einem Vakuum. Beatriz Colomina: Diese Feststellung trifft auch auf die Architektur zu. Architekt*innen lieben es, Zwänge zu hassen. Sie klagen über knappe Budgets, Planungsvorschriften, schwierige Kontexte, aber meistens sind es gerade diese Bindungen, die ihre Arbeit interessant machen. Charles Eames kam zu dem Schluss, je größer die Hindernisse, desto besser die Arbeit.4 Große Künstler*innen sind in der Regel diejenigen, die sich auf einen herausfordernden Kontext einlassen und darauf reagieren, die die Beschränkungen als inspirierende Herausforderung und nicht als Hindernis betrachten. Manchmal beschweren sich Künstler*innen über den Raum, in dem sie ihre Arbeiten ausstellen sollen: „die Decken sind zu niedrig“, oder „es ist nicht neutral genug“. Aber was ist ein neutraler Raum überhaupt? Was ist Neutralität? Mark Wigley: Neutralität ist eine nicht-neutrale Eigenschaft. Die weißen Wände der Galerie sind niemals neutral, ebenso wenig wie Technologien. Digitale Technologien und die virtuellen Räume, von denen die Karin spricht, sind nicht neutral, auch wenn es so scheinen mag. Und da unser Gespräch nun in Richtung Neutralität und Technologie abgedriftet ist, möchte ich vorschlagen, dass wir zum Pavillon zurückkehren. Angenommen, es gäbe in Venezuela irgendeine Form von Korruption, dann würde das Geld doch sicherlich auf einem Schweizer Bankkonto liegen, oder? Auf der einen Seite haben wir also ein Land, das sich Effizienz und Neutralität auf seine Fahnen schreibt, und auf der anderen Seite eins, das weltweit als quasi-kommunistischer und von Öl abhängiger Staat wahrgenommen wird, und doch sind beide durch ein virtuelles Leitungssystem miteinander verbunden, durch welches Kapital fließt. Karins und Philips Intervention am Schweizer Pavillon öffnet eine Tür zu dieser weiter gefassten Sphäre, aber wie ist ihnen das gelungen? Indem sie eine Mauer beseitigt und einen riesigen Grundriss in der Mitte des Ausstellungsraumes platziert haben. Karin, du bist so besessen von Wänden und Grundrissen, dass wir annehmen müssen, dass du Architektin bist. Anh-Linh Ngo: Wir sollten besser keine voreiligen Schlüsse ziehen. Bevor wir zu einem endgültigen Urteil kommen, möchte ich gerne über eine weitere Arbeit sprechen, die in dieser ARCH+ Ausgabe ausführlich präsentiert wird: die Kitchen Pieces. Im Gegensatz zu den Darstellungen auf klassischen illusionistischen Stillleben, besteht Kitchen Pieces aus echtem Obst und Gemüse, welches sich in einem organischen Verfallsprozess befindet, der auf die makellos weiße Wand übergreift, an die es genagelt ist. Diese Arbeit führt uns zurück zum Gedanken der Architektur als Verdrängung und zu jenem Kanon der Moderne, dem zufolge Architektur angeblich neutral und frei von jeglicher Ornamentik sei. Wenn ich Karin vor mir sehe, wie sie einen Kohlkopf oder eine Erdbeere an die weißen Wände einer Galerie nagelt, sehe ich eine Parallele zu Beatriz’ Arbeit als Architekturhistorikerin, die Aspekte wie Sexualität, Verfall, Perversion und Krankheit in den Architekturdiskurs einbringt. Auf diese Weise offenbart sich die Geschichte der modernen Architektur nicht länger als eine der Rationalität, der Objektivität und ästhetischen Reinheit, sondern vielmehr als eine Geschichte, die mit eher hinterlistigen Strategien der Verschleierung und Vertuschung operiert. Beatriz, was sagen dir dieses Obst und Gemüse im Hinblick auf das Verhältnis von Kunst und Architektur der Moderne? Welche Lehre können wir daraus ziehen, um das Verhältnis zwischen Kunst und Architektur heute zu verstehen? Beatriz Colomina: Wenn ich dieses schöne Obst und Gemüse betrachte, das an der weißen Wand der Galerie verrottet, muss ich unwillkürlich an Edith Farnsworths Obsession mit dem Abfalleimer denken, die Karin vorhin erwähnt hat. Warum ist der Abfalleimer so wichtig für sie? Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Intimität ihres Schlafzimmers, ihr Bett durch die Glasfassade völlig ungeschützt und einsehbar ist. Ist das nicht komisch? Ich glaube, dass die Gründe für diese fixe Idee jenem tief verwurzelten Drang der modernen Architektur entspringen, jegliche Spur des Verfalls aus dem Haus zu tilgen. Organischer Verfall muss um jeden Preis versteckt und beseitigt werden. Die bloße Vorstellung, dass der Körper vergänglich ist, durfte in der neuen makellosen Architektur des 20. Jahrhunderts nicht vorkommen. Schon gar nicht staubige häusliche Interieurs des 19. Jahrhunderts, vollgestopft mit Textilien und Teppichen, Krimskrams und all jenen Dingen, von denen man glaubte, dass sie Keime und Krankheiten mit sich brächten. Die Architekt*innen der Moderne wollten das Bild eines geradezu klinischen Heims vermitteln. Aber diese Form von „antibiotischer Architektur“, die völlig steril und von der Außenwelt abgeschottet war, hat eine ganze Reihe neuer Gesundheitsprobleme hervorgebracht. Der Mangel an bakterieller Vielfalt in unserem Mikrobiom, den wir durch den extensiven Einsatz von Antibiotika, zwanghaftes Putzen, antiseptische Seifen usw. herbeigeführt haben, hat zum Auftreten vieler Krankheiten in unserer Zeit beigetragen. Im Architekturdiskurs werden zunehmend neue biologische Konzepte diskutiert, um Leben in die menschengemachte Umwelt zurückzubringen, daher hören wir plötzlich von all den großartigen Ideen über das Bauen mit Myzel oder Entwürfen für nicht-menschliche Spezies, für andere biologischen Entitäten, von denen wir mittlerweile wissen, dass sie für unser eigenes Überleben unerlässlich sind. Mark Wigley: Ist es nicht seltsam, wie die Kitchen Pieces meine Fixierung auf die Semantik weißer Wände und Beatriz’ Obsession mit dem Verhältnis von Architektur und Gesundheit auf so überzeugende Weise zusammenführen? Und zwar indem sie enorme Bakterienpopulationen an den Galeriewänden ausbrüten. Wenn ich dieses an die Wand genagelte Obst und Gemüse betrachte, sehe ich eigentlich nur Bakterien. Nicht nur an der Wand, sondern auch in der Raumluft. Ich denke an die Menschen, die deine Arbeit buchstäblich einatmen. Ich sehe, wie das Werk allmählich stirbt und alles um sich herum infiziert. Das ist eine hochinfektiöse Arbeit und deshalb äußerst spannend. Hast du überhaupt an Bakterien gedacht, Karin, als du diese Arbeit konzipiert hast? Karin Sander: Ich habe nicht speziell an Bakterien gedacht, aber wenn der Verfallsprozess relativ weit fortgeschritten ist und der Schimmel sich in allen möglichen Farben ausbreitet, dann sieht man mitunter auch Fruchtfliegen, die sich um die Arbeit herum ansammeln. Wie John Waters schrieb: „There's a Fungus Among us.“5 Dann ist der Zeitpunkt gekommen, in dem die Infektiosität der Arbeit zu offenkundig wird, um sie zu ignorieren. Manchmal tropft Saft auf dramatische Weise an der Wand herunter. Manchmal setzt das Obst und Gemüse Schimmel an, oder es wird runzlig oder trocknet einfach aus. Mark Wigley: Kann man die Arbeit riechen? Karin Sander: Selten. Die meisten Obst- und Gemüsesorten trocknen relativ schnell aus, danach bleibt ihre Schönheit „für immer“ erhalten. Mark Wigley: Ich liebe diese Arbeit. Wenn die Architektur der Moderne, wie Beatriz sagt, eine Verfallsphobie hatte, dann ist Karins Arbeit eine subtil-perverse Art, dieses Architekturverständnis herauszufordern. Beatriz Colomina: Das sehe ich genau so, vor allem, wenn man sich überlegt, was die Leute alles unternehmen, um solche Orte von Ungeziefer freizuhalten. Tag für Tag werden Unsummen für Reinigung, Desinfektion, Schädlingsbekämpfung ausgegeben. Stell dir die armen Galerist*innen vor, die geradezu manisch darum bemüht sind, den Raum makellos zu halten, und dann kommt Karin und nagelt einen Haufen Obst und Gemüse an die Wand, was dann alle möglichen Insekten und Bakterien anzieht. Ich liebe diese Arbeit auch. Ein Kunstwerk, das vor den Augen der Betrachtenden ungeniert verrottet und verfault, ungeachtet des enormen Aufwands unsichtbarer Heerscharen von Menschen, die diesen Ort makellos sauber zu halten versuchen. Es ist eine Subversion der Galeriewelt. Und natürlich geht es dabei nicht nur um das Werk selbst. Vielmehr auch um den Heldenmut, mit dem dieses an die Wand genagelte Märtyrerobst und -gemüse gegen die Vorstellung aufbegehrt, dass in diesen modernen Interieurs nichts Schlechtes vorkommen darf. Um hier Robert Musil zu zitieren: „Der moderne Mensch wird in der Klinik geboren und stirbt in der Klinik: also soll er auch wie in einer Klinik wohnen!“6 Verfall, Alterung, Krankheit, Tod sind aus dem häuslichen Umfeld und Räumen des Alltags eliminiert worden. Karin Sander: Diese Subversion wird noch durch die Verwandlung unterstrichen, die dieses Obst und Gemüse von dem Moment, in dem es an die Wand genagelt wird – so schön und perfekt, dass es fast künstlich erscheint, bis zu jenem Moment durchläuft, in dem man den Galerieraum betritt und Zeuge ihres Verfalls wird. Wenn die Leute den Raum betreten, gibt es immer diesen Moment der Ambivalenz. Sie sind zwischen der Formulierung eines ästhetischen Urteils und einer schlichten empirischen Beobachtung hin- und hergerissen: „Was genau sehe ich hier eigentlich? Ist es eine Frucht oder das dreidimensionale Bild einer Frucht?“ Mark Wigley: Herrlich. Ich vernehme hier einen Hauch von Duchamp. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf unsere ursprüngliche Frage zurückkommen, nämlich wo wir Karins Arbeit eigentlich verorten wollen. Mir scheint, dass es bei vielen ihrer Arbeiten nicht um die Werke an sich, sondern um die Galerie geht. Die Wandstücke zum Beispiel, für die sie ein Stück der Galeriewand so lange poliert, bis es spiegelglatt ist und glänzt, finde ich wirklich bezeichnend. Was ich mich allerdings frage, Karin, ist: Fügst du eigentlich etwas hinzu oder nimmst du etwas weg, wenn du die Wand auf diese Weise polierst? Karin Sander: Ich poliere einen Abschnitt der weißen Wand so lange, bis er stark glänzt. Manchmal lege ich ältere Farbschichten oder andere Farben frei, aber meistens ist es einfach nur Weiß auf Weiß. Abhängig von den Lichtverhältnissen ist die Arbeit meistens nur aus bestimmten Blickwinkeln gut zu sehen. Aus einer bestimmten Position heraus wirkt sie fast wie ein Fenster, während man aus anderen Blickwinkeln nur eine rechteckige, das Licht reflektierende Fläche sieht. Um also deine Frage zu beantworten, ich entferne etwas. Das ist so, als würde man ein Gemälde malen, indem man Farbe entfernt. Mark Wigley: Zugleich fügst du aber dem Raum etwas hinzu. Du fügst etwas hinzu, indem du etwas entfernst. Du fügst der Wand ein Bild hinzu, indem du Farbe entfernst. Beatriz Colomina: Es ist ein bisschen wie bei einer Restaurierungsarbeit: Man entfernt eine Schicht, um das darunter liegende Material freizulegen, und damit fügt man etwas völlig Neues hinzu. Karin Sander: Was ich entferne, ist weniger als ein Millimeter der Wandbeschichtung, also fast nichts. Mark Wigley: Okay, du nimmst also fast nichts weg, aber das Ergebnis ist weitreichend, da die Wand nun einem Spiegel gleicht. Die Wand offenbart, was vor ihr steht: den Betrachtenden. Auf der Grundlage der bislang gesammelten Beweise kann die Jury also getrost zu dem Schluss kommen, dass Karins Arbeit ein architektonisches Werk ist, bei dem sie den Raum von der repressiven Kraft der Funktion befreit und von sich selbst sprechen lässt. Karin Sander: Ja, das stimmt, aber gleichzeitig widersetzt sich die Arbeit dieser Form von binärem Denken. Denn die Wand ist in Wirklichkeit kein Spiegel, sondern immer noch eine Wand. Ich weiß nicht, ob das Kunst oder Architektur ist. Ich finde, die beste Antwort hast du bereits zu Beginn unseres Gesprächs gefunden, nämlich dass wir „der Antwort auf eine Frage hinterherjagen, die niemals beantwortet werden sollte.“
| Erscheinungsdatum | 10.04.2024 |
|---|---|
| Zusatzinfo | 200 farbige Abbildungen |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 235 x 297 mm |
| Gewicht | 850 g |
| Einbandart | geklebt |
| Themenwelt | Technik ► Architektur |
| Schlagworte | 3D-Scan-basierte Arbeiten • Architekturbiennale Venedig 2023 • ETH Zürich • Eva Menasse • Forschung und Lehre • Harald Welzer • Interventionen • Karin Sander • Kitchen Pieces • Künstlerin • Partizipation • Regina Schmeken • Schweizer Pavillon |
| ISBN-10 | 3-931435-82-2 / 3931435822 |
| ISBN-13 | 978-3-931435-82-0 / 9783931435820 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich