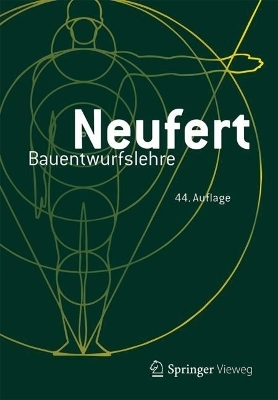Umbau – Maßstäbe der Transformation
Arch+ (Verlag)
978-3-931435-86-8 (ISBN)
Mit Architekturprojekten von BARarchitekten | dot architects | Esch Sintzel | 51N4E | Fall | Meyer Grohbrügge | Nalbach + Nalbach u.v.m.
1Editorial
Umbauwende
Victor Lortie, Melissa Makele, Anh-Linh Ngo
14Essay
Die zirkuläre Stadt – Bedeutung und Ressource obsoleter Systeme für die Bauwende
Stefan Rettich, Sabine Tastel
24Fotoessay
PRETTY VACANT
Andreas Gehrke
34Essay
Offene Architektur
Esra Akcan
48Mastab: Großstruktur
50Essay
Umbaustrategien für die Stadt von morgen
Niklas Maak
60Projekt
ZIN
51N4E, l’AUC und Jaspers-Eyers Architects
68Projekt
Peterbos 9
51N4E und Lacaton & Vassal
74Projekt
58 rue de Mouzaïa
Canal architecture – Patrick Rubin
82Projekt
Felix-Platter-Spital
ARGE Müller Sigrist Architekten / Rapp Architekten
88Projekt
Wohnen im ehemaligen Weinlager
Esch Sintzel Architekten
98Maßstab: Sozialstruktur
100Essay
Erweiterte Architekturpraxis – Ansätze der Transformation in der zeitgenössischen japanischen Architektur
Yuma Shinohara
108Projekt
Senju Motomachi Souko
Ishimura+Neichi
116Projekt
HOUSE 03
Studio GROSS
120Projekt
Holes in the House
Fuminori Nousaku & Mio Tsuneyama
128Projekt
Chidori Bunka
dot architects
138Projekt
Ebina Art Freeway
GROUP mit Arata Mino und Yui Kiyohara
144Projekt
Monte
studioser
150Projekt
Konsum karwe
Meyer-Grohbruegge und Studio Other Spaces
156Maßstab:
infrastruktur
158Essay
Aufstieg, Fall und Zukunft des Parkhauses
Jens Casper, Luise Rellensmann
168Projekt
Kantgaragen
Nalbach + Nalbach Architekten, Johanne Nalbach
174Projekt
Garagenhof
BARarchitekten
182Projekt
Garage house
fala
186Projekt
Bureaux Malevart
h2o architectes
194Projekt
Verbiest
AgwA und Evelia Macal
Umbauwende Text: Victor Lortie, Melissa Makele, Anh-Linh Ngo In diesem Jahr fokussiert ARCH+ mit zwei aufeinander aufbauenden Ausgaben auf das Thema des Umbaus als zentrale Alltagspraxis für eine sozialökologische Transformation in Europa. Das erste Heft (ARCH+ 256: Umbau – Ansätze der Transformation) präsentierte Projekte und Positionen sechs ausgewählter Architekturbüros, die über eine umfassende Umbau-Werkbiografie verfügen und beweisen, dass Umbau schon heute die nachhaltige Basis für eine zukunftsweisende Architekturpraxis bietet. Im vorliegenden zweiten Band verschiebt sich der Blick von der Herangehensweise einzelner Büros hin zur in ARCH+ 256 bereits angedeuteten gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, als die eine zeitgenössische Umbaukultur verstanden werden muss. Als Maßstäbe der Transformation werden hier folglich nicht nur die unterschiedlichen, sich gegenwärtig eröffnenden Handlungsfelder für eine Architekturpraxis der Transformation diskutiert, sondern auch die Umbauaufgabe, die sich der Gesellschaft als Ganzes stellt. Der Großteil des Gebäudebestands im Globalen Norden wurde in den Boom-Jahren der Nachkriegszeit errichtet. Allein 46 Prozent der Wohngebäude in Deutschland stammen aus den drei Jahrzehnten nach 1949. Ähnliches gilt für Gewerbe- und Infrastrukturbauten. Nun, nach 50 bis 70 Jahren, werden sie aufgrund ihrer in die Jahre gekommenen Bausubstanz, aber auch im Zuge gesellschaftlicher Umbrüche obsolet – ein Phänomen, das Stefan Rettich und Sabine Tastel in ihrem Beitrag in diesem Heft analysieren. Für diese nie dagewesene Menge auf einmal baufällig oder obsolet werdender Bauten bahnt sich eine Entscheidung an, deren Tragweite angesichts der gegenwärtigen, sozialökologischen Krisen gesellschaftlich vergleichsweise wenig Beachtung findet: abreißen und neu bauen oder erhalten und umbauen? Berechnungen zeigen, dass die sozialökologische Transformation sich nicht allein mit Umbau von ausgewählten, für ästhetisch erhaltenswert erachteten Gebäuden als Alternative zum Neubau realisieren lassen wird. Vielmehr werden wir uns in beträchtlichem Umfang mit dem oftmals unspektakulären, ordinären, bisweilen gar hässlichen Erbe vergangener Zeiten auseinandersetzen müssen. Strategien für diesen Umbruch zu entwickeln, wird eine der Hauptaufgaben der Architektur darstellen, die die soziale Gestaltungsfunktion der Disziplin zwangsläufig wieder stärker in den Mittelpunkt rückt. Entsprechend stellen wir viele realisierte Projekte vor, die unterschiedlichste Gebäudetypologien, Nutzungen, Kontexte und soziale Ausrichtungen repräsentieren. Das Heft ist in drei Kapitel gegliedert, die auf drei verschiedene Maßstäbe der Transformation – Großstruktur, Sozialstruktur, Infrastruktur – hinweisen und jeweils von einem theoretischen Essay eingeleitet werden. Maßstab: Großstruktur Der Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft und die Auslagerung der Produktion in Länder mit weniger regulierten Märkten machten großmaßstäbliche Produktionsstandorte im Globalen Norden in der Zeit nach den Ölkrisen zunehmend obsolet. Einen möglichen Umgang mit großen Fabrik- und Zechenanlagen zeigte etwa die IBA Emscher Park in den 1990er-Jahren auf. Heute stehen mit der Digitalisierung von Produktion und Dienstleistung erneut ähnliche Fragen im Raum: Wie gehen wir mit den vielen Kolossen der Arbeits- und Konsumwelt der Nachkriegszeit um? Welches neue Leben kann in die Bürokomplexe, Shoppingmalls sowie Kauf- und Warenhäuser einziehen, die rapide aus der Nutzung fallen? Was diese Typologien einst auszeichnete, ist heute ihr größtes Problem: schiere Größe. Dabei besteht in Zeiten der Knappheit an Raum für Wohnen, Kultur und Soziales gerade an diesen Orten die Möglichkeit, den Bestand umzunutzen und dringend benötigten Raum zu erlangen. Die bestehende Bausubstanz und die in ihr akkumulierte Energie klug weiter zu nutzen, erfordert präzise und oft kleinteilige Eingriffe; Entscheidungen darüber, was erhaltenswert ist und was nicht, sind weder rein nach ästhetischen noch ökonomischen Maßstäben zu fällen. Vielmehr zeigen die Projekte dieses Kapitels auf, dass nachhaltige Alternativen zum Abriss und Ersatzneubau vor allem in der Überwindung längst überholter Planungsdogmen und gesellschaftlicher Leitvorstellungen, wie etwa der funktionalen Stadt und der Kernfamilie, zu finden sind. In diesem Sinne steht Umbau für die Korrekturmöglichkeit der Moderne, deren gebaute Strukturen Räume für neue Gesellschaftsvorstellungen und Lebensformen bereithalten können. Veranschaulichen lässt sich diese Möglichkeit im (bisher fehlenden) Umgang mit der obsolet werdenden Typologie des Kaufhauses oder des Shoppingcenters. Eine Studie von Empirica aus dem Jahre 2023 hat ergeben, dass seit Ende der 1990er-Jahre über 130 Kaufhäuser in ganz Deutschland geschlossen wurden. Seit der Pleite des Immobilien- und Warenhauskonzerns Signa sind noch etliche hinzugekommen. In Berlin steht zum Beispiel die Nachnutzung von Jean Nouvels Galeries Lafayette in der Friedrichstraße als Zentral- und Landesbibliothek zur Diskussion oder die Umwandlung eines lange leerstehenden Kaufhauses in der Karl-Marx-Straße in das „Kalle Neukölln“ mit Kreativräumen, Büros und Gastronomie, der Umbau des ehemaligen Centrum Warenhauses in Friedrichshain sowie neue Nutzungen für das von der Signa-Pleite betroffene Karstadt-Kaufhaus am Hermannplatz oder das Ring-Center an der Frankfurter Allee. Damit verbunden sind zivilgesellschaftliche Initiativen, die mit Slogans wie „Shoppingmalls zu Sorgezentren“ und Warenhaus zu „Andershaus“ (Niloufar Tajeri / Initiative Hermannplatz) ihren Anspruch auf eine gemeinnützige Umprogrammierung der Gebäudetypologie im Sinne der „Sorgenden Stadt“ geltend machen. Hier werden die politischen Fragen sichtbar, die wir bereits in ARCH+ 256: Umbau – Ansätze der Transformation formuliert haben: „Warum und für wen wird umgebaut? Mit welchen Mitteln und zu welchem Preis? Umbau heißt: Transformation des Bestehenden – in materieller, ästhetischer wie auch sozialer Hinsicht. Entsprechend müssen, wie bei allen Transformationsprozessen, die Auswirkungen der Veränderung, muss der Preis der Transformation gesellschaftlich verhandelt werden. Wer profitiert, wer verliert? Wie lässt sich durch Umbau mehr Gerechtigkeit herstellen?“ Noch scheitert eine Umnutzung der Einkaufstempel von gestern oft an den Gewinnerwartungen der gegenwärtigen Eigentümer*innen und Investor*innen sowie an fehlenden Ideen für Eingriffe, die die tiefen, dunklen Volumen auf neue Nutzungen vorbereiten. Doch wie die Projekte in diesem Kapitel aufzeigen, mangelt es nicht an Vorschlägen, wie die Großstrukturen der Nachkriegsmoderne für eine zweite Lebenszeit umgerüstet werden können – es braucht nur den Mut, sie auf neue Typologien umzustellen. Maßstab: Sozialstruktur Während die meisten Gebäude mit einer prognostizierten Lebenserwartung von Jahrzehnten oder Jahrhunderten errichtet werden, verändern sich die Gesellschaften, die sie bauen, mitunter viel schneller. In Japan etwa sind die Folgen von Landflucht und alternder Bevölkerung schon heute eklatant; das Land durchlebt einen verschärften demografischen Wandel, der neue Raumbedarfe und -potenziale mit sich bringt, wie der japanische Kurator Yuma Shinohara in dieser Ausgabe beschreibt. Wurde in der Vergangenheit noch für wenige, klar umrissene Zielgruppen gebaut, bringt die stärkere Ausdifferenzierung von Gesellschaften neue Wünsche nach Teilhabe und adäquaten Räumen mit sich. Im Hinblick auf das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft hat die Planung heute mehr denn je den Auftrag, einer auch durch die konventionelle Raumproduktion der letzten Jahrzehnte massiv vorangetriebenen, weiteren Atomisierung in Partikularinteressen entgegenzuwirken, indem sie großzügige Angebote für Räume des gemeinschaftlichen Miteinanders und der kollektiven Nutzung bereitstellt. Im 21. Jahrhundert wird die Aushandlung dieser raumpolitischen Fragen und die Schaffung neuer Räume für neue Bedürfnisse nicht mehr auf der Tabula rasa – dem „leeren Reißbrett“ bzw. der „grünen Wiese“ – der Moderne stattfinden. Stattdessen wächst das Bewusstsein, dass der immense Gebäudebestand in der Stadt sowie in ländlichen Regionen ein enormes Transformationspotenzial bietet, das nicht top-down, sondern vielmehr gemeinsam mit den Menschen und Nachbarschaften vor Ort entwickelt werden muss. Dass diese Aushandlung kein geradliniger Prozess ist, sondern auf räumlicher Ebene ebenso behutsam und tastend verläuft wie auf der gesellschaftlichen, zeigt der Blick auf eine Reihe von Projekten in Japan sowie auf zwei Interventionen in Deutschland und der Schweiz, die aus den jeweiligen lokalen Kontexten heraus spezifische Antworten auf den demografischen Wandel zu finden versuchen, ohne Verallgemeinerbarkeit zu behaupten. Das Resultat ist eine Architektur, die weniger formalen Autonomieansprüchen folgt, als sich vielmehr auf ihre soziale Gestaltungsfunktion zurückbesinnt. Hier wird der Umbau von heute zu einer Gelegenheit, Flexibilität und Offenheit für die Gesellschaft von morgen zu imaginieren. Diesen Gedanken folgend legt Esra Akcan in ihrem Beitrag „Offene Architektur“ dar, wie die im zeitgenössischen Architekturdiskurs (und in der Praxis) vielproklamierte „Offenheit“ auch politisch im Sinne einer Demokratisierung als ein „ständig offener, nie endender Prozess“ gedacht werden sollte, der eine neue Ethik der Gastfreundschaft einschließt. Denn „[w]as wäre, wenn die Architektur als Disziplin und Beruf von einem Bewusstsein geprägt wäre, das Staatenlose und Nichtstaatsbürger*innen […] willkommen heißt, auch wenn sie keine zahlungskräftigen Bauherr*innen und Mieter*innen sind? Wenn wir uns auf vergangene Bemühungen um eine Architektur stützen würden, die auf Kollektivität und Zusammenarbeit, partizipatorischer und demokratischer Gestaltung und Bedeutungsvielfalt basieren, würden wir beginnen, die Umrisse einer wahrhaft offenen Architektur zu erkennen, die darauf beruht, eine marginalisierte Gruppe von Menschen in den Prozess der architektonischen Gestaltung einzubeziehen.“4 Maßstab: Infrastruktur Aufsehenerregende Maßnahmen in Städten wie Paris, wo Versuche einer Neujustierung des städtischen Verkehrs weg vom Auto und hin zu umweltfreundlichen Transportmitteln unternommen werden, täuschen darüber hinweg, dass eine ernsthafte, in die Breite wirkende Verkehrswende noch weit entfernt ist. Das Beispiel IBA Emscher Park zeigt, dass der Strukturwandel und das abrupte Verschwinden einst prägender Strukturen ein Vakuum hinterlassen, das die kollektive Vorstellungskraft nur langsam wieder zu füllen vermag. Neue Leitbilder sind gefragt. In diesem Sinne ist es notwendig, schon heute an die Stadt nach dem Auto zu denken, um besser auf die unweigerlich kommende Transformation reagieren zu können, wie Jens Casper und Luise Rellensmann in ihrem Beitrag „Aufstieg, Fall und Zukunft des Parkhauses“ für dieses Heft argumentieren. Während in Großstädten dringend Räume zur Nachverdichtung gesucht werden, stehen private Pkws zu über 95 Prozent der Zeit ungenutzt herum – auch in Parkhäusern, Innenhöfen und Garagen. Die Moderne produzierte einst euphorische Bilder eines harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Auto, wie Bertrand Goldbergs berühmtes Beispiel der Marina City in Chicago aus den 1960er-Jahren, deren Park- und Wohnetagen äußerlich kaum voneinander zu unterscheiden sind. Doch was, wenn die Mitbewohner aus Blech zunehmend aus dem Stadtraum verschwinden? Der Umbau von Garagen und Parkhäusern ist mit vielen technischen und räumlichen Problemen verbunden, weil eine vormals am Automobil ausgerichtete technische Funktion (und Funktionalität) in eine menschliche, das heißt an menschlichen Grundbedürfnissen ausgerichtete, Nutzungüberführt werden muss. Dies fordert die Planung hinsichtlich der Erschließung, der Belichtung und des Programms besonders heraus, kann aber gestalterisch lohnende Ergebnisse zeitigen, wie die versammelten Projekte dieses Kapitels beweisen. Soziale Imagination Die Beispiele zeigen, wie Architektur dabei helfen kann, das Vorstellungsvakuum durch überzeugende Bilder des Wandels hin zu einer postfossilen Gesellschaft aktiv zu füllen, indem sie die städtebaulichen Potenziale für die Gemeinschaft durch den individuellen Verzicht auf das Auto betonen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung gesellschaftlicher Akzeptanz und die Mobilisierung zur demokratischen Teilhabe an den weithin anstehenden großen gesellschaftlichen Transformationsprojekten wie – unter anderem – der Paradigmenwechsel von der autogerechten Stadt zur „Stadt nach dem Auto“. In diesem Sinne arbeitet der Architekturkritiker Niklas Maak in seinem Essay heraus, dass Umbau vor dem Hintergrund der Klimakrise nicht einseitig im Sinne quantitativer Nachhaltigkeit diskutiert werden sollte, sondern über den reinen Pragmatismus hinaus die gesellschaftlichen Chancen eines programmatischen Umbaus im Mittelpunkt stehen müssen: „Ein Umbaudiskurs, der mehr als eine technische Reduktion von Emissionen, also nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale und stadtpolitische Bauwende erreichen will, kann nicht ohne die Frage auskommen, mit welchem Ziel etwas in etwas anderes umgewandelt werden soll und wie über idyllische Einzelprojekte hinaus ein legislativer und politischer Rahmen für eine grundlegendere Umnutzung der in Zukunft etwa durch die Digitalisierungsfolgen freiwerdenden Stadträume aussehen könnte.“ So stehen in Berlin architektonische Großstrukturen wie das Internationale Congress Centrum (ICC Berlin) und deren Potenziale als städtische Commons seit Jahren zur Debatte, gerade weil es Typologien sind, die auf Urbanität und Gemeinschaftlichkeit angelegt waren und deren Raumstrukturen wir nun mit neuen Inhalten füllen könnten (siehe den Fotoessay von Andreas Gehrke). Wie es funktionieren kann, zeigen Projekte wie das genossenschaftlich organisierte Bündnis ZUsammenKUNFT in Berlin, das nicht nur den Abriss des Hauses der Statistik am Alexanderplatz verhinderte, sondern auch gleich eine neue kooperative Stadtentwicklungskultur in Gang setzte. Ähnliche Entwicklungen wie die oben aufgelisteten Beispiele aus dem Berliner Kontext können überall beobachtet werden. Auch wenn wir erst zaghafte Anfänge sehen und die Mehrheit der Bauwirtschaft und Stadtpolitik noch an den obsoleten Vorstellungen einer auf Wachstum angelegten Stadtentwicklung festhält, so verdichtet sich immer mehr die Erkenntnis, dass eine echte sozialökologische und stadtpolitische Bauwende ganz grundsätzlich von einer gelingenden Umbauwende abhängt. Denn eine auf reine Effizienz ausgerichtete Bauwende wird das Problem lediglich ins Technische verlagern. Die Energie- und Ressourcenfrage entscheidet sich aber zumindest im Globalen Norden in der bereits gebauten Umwelt. „Die Stadt von morgen“, wie die utopischen Stadtvisionen der Moderne häufig hießen, ist bereits gebaut, so sinngemäß einer der Kerngedanken der IBA’27 StadtRegion Stuttgart.7 Im doppelten Sinne sind „Umbaustrategien für die Stadt von morgen“ (Niklas Maak) gefordert. Die Obsoleszenz der historischen „Stadt von morgen“ birgt die Chance, sie für eine tatsächliche Zukunft zu ertüchtigen – eine Zukunft, die nicht nur im Hinblick auf das Klima, sondern auch sozialpolitisch nachhaltig ist. Das Vermögen von Architekt*innen, aktiv an diesen Bildern und ihrer Umsetzung in die Realität mitzuwirken, wird in den hier versammelten Projekten deutlich. Denn wie jede Revolution braucht auch die Umbauwende hin zu einer „wahrhaft offenen Architektur“ (Esra Akcan) soziale Imagination. Die kollektive Vorstellungskraft zu stärken, wie wir zusammenleben wollen, ist das Anliegen dieser Doppelausgabe von ARCH+. 1Siehe Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (Hg.): Langfristige Renovierungsstrategie der Bundesregierung, Berlin 2020, S. 24, www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/J-L/langfristige-renovierungsstrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (Stand: 1.8.2024) 2Vgl. Empirica: Nachnutzung von Kaufhäusern, Berlin 2023, zia-deutschland.de/ wp-content/uploads/2024/03/Studie-Nachnutzung-von-Kaufhausern-fur-Wohnen-empricia-im-Auftrag-des-ZIA.pdf (Stand: 1.8.2024) 3Anh-Linh Ngo: „Politiken und Ethiken des Umbaus“, Editorial, in: ARCH+ 256: Umbau – Ansätze der Transformation (Juli 2024), S. 1 ff. 4Esra Akcan: „Offene Architektur“, in diesem Heft S. 43 5Niklas Maak: „Umbaustrategien für die Stadt von morgen“, in diesem Heft S. 52 6Siehe „Haus der Materialisierung“, in: ARCH+ 252: Open for Maintenance – Wegen Umbau geöffnet (Mai 2023), S. 144 ff. 7Vgl. Andreas Hofer: „Die Stadt der Zukunft ist gebaut“, in: ARCH+ 248: Stuttgart – Die produktive Stadtregion und die Zukunft der Arbeit (Juni 2022), S. 138 f.
Umbaustrategien für die Stadt von Morgen Text: Niklas Maak Die digitale Revolution hat dramatische Auswirkungen auf die klassischen Infrastrukturen, Bautypologien und die öffentlichen Räume der Stadt. Obwohl die Analysen je nach untersuchter Region und beauftragenden Interessengruppen kaum eine einheitliche Prognostik erlauben, lässt sich in der Tendenz festhalten, dass die klassische Stadt durch den Wandel ökonomischer Produktions- und Konsumprozesse und eine massiv veränderte Nutzung urbaner Räume und Infrastrukturen auf ihren wohl grundlegendsten Wandel seit Beginn der Moderne zusteuert. Dies betrifft insbesondere die Bautypologien, in denen sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Dienstleistungsgesellschaft westlicher Industrienationen manifestierte. Wenn in Zukunft – trotz einiger gegenläufiger Tendenzen – immer mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, was wird dann mit den Bürovierteln im Zentrum der Stadt, in die bisher jeden Morgen Tausende von Angestellten pendelten? Was wird aus den darum herum entstandenen Infrastrukturen – den Restaurants, den Kantinen, den Supermärkten, in denen nach Dienstschluss noch die alltäglichen Besorgungen erledigt wurden? Was geschieht angesichts des wachsenden Onlinehandels mit den Einkaufspassagen und Shoppingmalls, die sich vor allem in den Vereinigten Staaten, aber zunehmend auch in Europa immer mehr in gigantische leerstehende Ruinen verwandeln? Was ist eine Stadt, was sind „Stadtzentren“ überhaupt noch, wenn dort genau die Mischung, die ihren Charakter ausmachen, nämlich die Produktion und der Austausch von Waren und Informationen, nicht mehr stattfindet? Aus welchen Gründen wird man sie besuchen oder sich dort aufhalten wollen? Der Wandel von Produktion und Konsum hat auch für bestimmte Wohntypologien und Lebenskonstellationen Folgen, die sich um die moderne Dienstleistungsgesellschaft herum entwickelt haben – für die zu Recht oft als reine Schlafstädte kritisierten Großsiedlungen, in denen die Angestellten sich notdürftig für den Arbeitseinsatz am kommenden Tag erholten, für die endlosen, um die Kernfamilie herum organisierten Einfamilienhaussiedlungen der Vorstädte, aus denen sie jeden Morgen zur Arbeit pendelten. Die architektonische Infrastruktur aus Bürohochhäusern, Parkhäusern und Shoppingmalls wurde schon seit den 1960er-Jahren aus linker wie aus konservativer Perspektive immer wieder und aus guten Gründen als sozial wie ökologisch verheerende Zerstörung gewachsener historischer Stadtstrukturen und -gesellschaften kritisiert. Damals wurden in den Innenstädten reihenweise Wohnviertel abgerissen, um Platz für Bürotürme und Einkaufszentren zu machen. Der Kapitalismus überformte die Stadt mit neuen Typologien, die vor allem von Gewinnerwartungen geprägt waren, und linke Theoretiker*innen träumten von einer Revolution, die diese Strukturen zerstören würde. Kurioserweise werden die Strukturen einer kapitalistischen Dienstleistungsgesellschaft jedoch nicht, wie von einigen Protagonist*innen eines kritischen Stadtdiskurses erträumt, durch eine antikapitalistische Revolution, sondern vom digitalen Kapitalismus selbst weggeräumt, weil dieser für sie keine Verwendung mehr hat. So entsteht ein komplexer, gigantischer Ruinenpark, ungenutzt, jedoch in Privatbesitz und daher nicht ohne Weiteres durch staatliche oder zivilgesellschaftliche Akteur*innen zu besiedeln oder umzuwandeln. Die in den vergangenen fünfzig Jahren immer schneller werdenden Zyklen von Abriss und Neubau werden zur Zeit gar nicht einmal aus Einsicht in die verheerenden Folgen einer Baupolitik verlangsamt, in der Betrieb, Abriss und Neubau von Gebäuden nach dem immer wieder zitierten Modell für 40 Prozent aller globalen klimaschädlichen Emissionen verantwortlich sind, sondern einfach weil alle Typologien außer spekulativem, hochpreisigem Wohnbau, die an die Stelle obsolet gewordener Bürobauten oder Einkaufspassagen treten könnten, selbst von der Strukturkrise des digitalen Stadtwandels betroffen sind. Trotzdem werden immer noch technisch leicht in Wohnraum umzuwandelnde Großstrukturen aus Stahlbeton abgerissen – selbst wenn sie, wie das Hochhaus An der Urania 4–10 aus den 1960er-Jahren in Berlin, Eigentum des Landes und stadtbildprägend von Berlins legendärem Senatsbaudirektor Werner Düttmann entworfen sind. Gegen alle Proteste bestand Berlin auf den Abriss und einen Neubau, wobei laut der Initiative andersurania.org etwa 13.000 Tonnen CO2 emittiert werden. „Das entspricht in etwa einer Menge von CO2, die der Tiergarten in 27 Jahren absorbieren kann – der Tiergarten wäre also 27 Jahre beschäftigt, nichts anderes mehr zu machen, als die Emissionen dieses einzelnen Abbruchs und Neubaus zu binden. Eine Sanierung des Gebäudes würde demnach nur 10 % dieser Emissionen verursachen.“ Die Dimension des Problems wird deutlich, wenn man dieses Einsparpotenzial auf die gut 14.000 Gebäude hochrechnet, die jedes Jahr in Deutschland offiziell abgerissen werden. Die dabei anfallenden Bauabfälle entsprechen dem Materialbedarf von mehr als 422.000 Wohnungen. Seit einigen Jahren haben Architekturverbände vermehrt einen Stopp der gängigen Abriss- und Neubaupolitik gefordert, etwa der BDA. Zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe e.V. und anderen Gruppierungen fordern sie, die 230 Millionen Tonnen Bau- und Abbruchabfälle zu reduzieren, die nicht weniger als 55 Prozent des gesamten deutschen Abfalls ausmachen. Oberstes Gebot sei „Erhalt, Sanierung, Umbau und Weiterbauen im Bestand. Jeder Abriss bedarf einer Genehmigung unter der Maßgabe des Gemeinwohls, also der Prüfung der sozialen und ökologischen Umweltwirkungen.“ Seltsam unscharf bleiben in vielen dieser Forderungen aber die Vorschläge, wie die legislativen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen für eine umbauzentrierte Baupraxis aussehen müssten. In der Realität sind Abriss und Neubau angesichts der heute geltenden Dämm-, Komfort- und Sicherheitsvorgaben oft eine deutlich günstigere Alternative. Wie man dies ändern könnte, hat die Bundesarchitektenkammer im vergangenen Jahr in ihrem Vorschlag für eine neue Musterbauordnung dargelegt – dazu gehört die Erleichterung von Aufstockungen und Nutzungsumwidmungen. Ein Beispiel für die Umnutzung eines Büroturms als Wohngebäude ist das Q45 in Bremen, ein ehemaliger Verwaltungsbau der Bundeswehr aus dem Jahr 1968, den das Bremer Wohnungsunternehmen Gewoba für etwa 40 Millionen Euro in einen Bau mit bezahlbaren Wohnungen, Büros und Gastronomie umwandelt. Laut Expert*innen gibt es mehr als 350 Millionen Quadratmeter Bürofläche, die sich allein in Deutschland für solche Umwandlungen anbieten, zumal Bürobauten bereits hohen Anforderungen bei Sanitäranlagen und Brandschutz entsprechen. Dennoch wäre eine weitreichende gesellschaftliche Verständigung vonnöten, welchen gesellschaftlichen Leitbildern ein Umbau folgen und welche Idee von Stadt in den leerstehenden Räumen einer in den virtuellen Raum abgewanderten Dienstleistungsgesellschaft realisiert werden soll. Verbunden damit ist auch die Frage, wie deren Umbau eine grundlegende Revision der Ziele und Rituale einer postindustriellen Gesellschaft befördern kann. Bisher häufen sich die Beispiele, in denen unter dem Motto „Umbau statt Abriss“ vor allem die Umwidmung obsoleter öffentlicher Infrastrukturgebäude in nostalgische Luxuswohnungen und Hotels vollzogen wird. So feiert die populäre Zeitschrift AD unter dem gleichlautenden Titel im Mai 2023 neben anderen Projekten die Umwandlung des Bahnhofs des spanischen Canfranc in ein Hotel mit „gehobene[r], nostalgische[r] Atmosphäre“. Andere Beispiele sind die Umnutzung alter und neuerer Fabrikhallen, etwa die gefeierte Umwandlung der Großhallen des New Yorker Brooklyn Navy Yard in einen Bau für über 500 Start-ups oder die Station F in Paris, die mit 34.000 Quadratmetern Fläche und Platz für mehr als 3.000 Arbeitsplätze, Restaurants, einem Markt, drei Bars und einem Auditorium mit 370 Sitzplätzen sowie einer eigenen Ansiedlung von Investor*innen der größte Start-up-Campus der Welt ist. Es ist auffällig, dass bei der Frage, wer vom Umbau von Großstrukturen profitieren und wer sie finanzieren könnte, „Start-ups“ die einzige Antwort sind – genauso wie das Vokabular der aktuellen urbanen Umbaukultur oft auf auffällige Weise mit der ideologischen Sprache der neuen Digitalindustrien übereinstimmt, in der alles auf Transformation und Konversion – hier verstanden als Prozess „der Umwandlung eines Interessenten in einen Kunden“ – abzielt. Auch die Gare Maritime in Brüssel wurde privatisiert und unter Verwendung geradezu wahnwitziger Mengen von Holz in einen Großraum voller kleiner, an einem halböffentlich zugänglichen inneren Boulevard aufgereihter Bürokabinen verwandelt; „zur Nutzerzielgruppe zählen Start-ups und renommierte Marken“. Umbau und Nachnutzung öffentlicher Großbauten folgen hier dem Prinzip der Ästhetisierung von Arbeit und Öffentlichkeit, wie man sie aus den Yuppie-Lofts in den verfallenen Lagerhäusern in den 1980er-Jahren kannte. Eine oft unproduktive Industrie, die mit Finanzprodukten, Termingeschäften oder Apps ihr Geld verdient, die der Ausspähung und Manipulation von Kund*innen dient, inszeniert sich in einer Romantisierung der Idee von Produktion in Bauten, die einmal dem öffentlichen Wohl dienten. Was aber wäre eine umbauorientierte Stadtvision, die sich nicht auf die tourismuskompatible Herrichtung der Zentren und die Ansiedlung von Start-ups in den leerstehenden Infrastrukturbauten beschränkt, die ihre Zivilgesellschaft nicht mit Transformationsästhetik im Kleinen auf Lokalebene abspeist, während die ökonomischen und politischen Freiräume und Partizipationsmöglichkeiten auf der Makroebene grundlegender Stadtgestaltung immer weiter eingeschränkt werden? Was bringen ein paar Blumenkübel auf ein paar Parkplätzen, wenn eine Stadt wie Berlin ihre Gestaltungshoheit auf Makroebene an Digitalkonzerne und Unternehmensberatungen abtritt und eine „Beteiligung“ als Ornament im Alltäglich-Kleinen unterstützt, die letztlich nur eine Entmachtung im Großen kaschiert? Ein Umbaudiskurs, der mehr als eine technische Reduktion von Emissionen, also nicht nur eine ökologische, sondern auch eine soziale und stadtpolitische Bauwende erreichen will, kann nicht ohne die Frage auskommen, mit welchem Ziel etwas in etwas anderes umgewandelt werden soll und wie über idyllische Einzelprojekte hinaus ein legislativer und politischer Rahmen für eine grundlegendere Umnutzung der in Zukunft etwa durch die Digitalisierungsfolgen freiwerdenden Stadträume aussehen könnte. Zur Klärung dessen, was die Herausforderungen und möglichen Lösungsansätze für eine umnutzungsorientierte Bauwende sein könnten, lohnt der Blick nach Rom. I. Von Rom lernen In kaum einer anderen Großstadt Europas ist das historische Zentrum so museal und so deutlich getrennt vom Raumbedarf der Dienstleistungsmoderne nach 1945 wie Rom. Um der wachsenden Verkehrsströme Herr zu werden und gleichzeitig den für den Tourismus so wichtigen historischen Charakter der Innenstadt Roms zu erhalten und nicht durch Bürotürme, Einkaufszentren, Schul- und Universitätsbauten, Fabriken, Wohnviertel und Autowaschanlagen zu gefährden, beschloss die Stadtregierung nach dem Zweiten Weltkrieg, im Abstand von sieben Meilen vom Kapitolshügel eine ringförmige Schnellstraße um die Stadt zu bauen, an der all diese Funktionen der modernen Stadt wie an einer Perlenkette aufgereiht würden. Der Grande Raccordo Anulare, kurz GRA, wurde von Eugenio Gra geplant, dem ersten Generaldirektor der nationalen Straßenbehörde Anas; die Übereinstimmung des Namens der Autobahn mit seinem Namen dürfte kein Zufall sein. Im Jahr 1948 begannen die Bauarbeiten für den GRA. In den kommenden Jahren wuchs hier ein modernes Anti-Rom aus allem, was eine moderne Stadt ausmacht, ohne jede Verantwortung für die alte Stadt und ohne den Alpdruck der Antike, den man noch in jedem Winkel der faschistischen Planstadt des EUR-Viertels spürt: ein neues Rom aus Autohäusern, Einkaufszentren, Universitäten, Bürohochhäusern, Freizeitparks und riesigen Wohnkomplexen, um den Büroalltag ihrer Einwohner*innen und um das Auto herumgebaut, das sie von zu Hause zur Arbeit brachte. Die Digitalisierung verwandelt dieses Band der Modernitäten in einen Ruinenpark. Um das Zentrum Roms mit seinen klassischen Ruinen legt sich jetzt ein Gürtel von Ruinen der Moderne: aufgegebene Tankstellen, leerstehende Einkaufszentren, nie fertiggebaute Bürokomplexe. Hier könnte die Stadt bald wie eine moderne Version des spätantiken Roms aussehen: bröckelnde Bürokomplexe, einstürzende Einkaufsarkaden, überwucherte Postämter. Rom – eine Stadt, die vor der neuen Verwandlung über 2.000 Jahre Erfahrung mit dem Umgang, der Besiedlung und Neuverwendung von Ruinen hat – wird zur Matrix für die zerfallende Moderne, zum Bild der globalen Bedingungen von Stadt. Im Quartier Torre Spaccata werden die Türme der modernen, nach 1945 errichteten Kirchen als Mobilfunk-Sendemasten genutzt. Unter der Autobahnbrücke an der Via Pier Vittorio Aldini 41 stehen ein paar Männer, die wie Angler aussehen, reglos eine Stange vor sich haltend. Die Stange ist aber die Fernbedienung der Spielzeugrennwagen, die bei Modellismo Gianni über eine kleine Miniaturrennstrecke rasen. Für ferngesteuerte Spielzeuggeländewagen gibt es einen Hindernisparcours. Oben staut sich der echte Verkehr, unten rasen verkleinerte Sportwagen, wie glückliche Sisyphosmaschinen, immer im Kreis. Das Architekturbüro Supervoid hat ein paar alte Scheunen und Lagerhallen zum „Borgo della Mistica“ umgebaut. Aus der Scheune ist ein Restaurant mit Pool geworden, die römische Jugend tanzt hier zu Industrial Techno. An der Via Orazio Raimondo, gleich am GRA, verfällt das Institut für lateinamerikanische Rechtswissenschaften. Am GRA wollte der Wohlfahrtsstaat auch eine Welt für Vergnügen und Bildung bauen – mit Schwimmbädern, Stadtteilbibliotheken und futuristischen kleinen Markthallen, wo man sich trifft und einkauft wie im Mercato di Torre Spaccata in der Via Filippo Tacconi. Das Dach der Markthalle besteht aus betonierten Trichtern, die das Regenwasser sammeln und zur Kühlung der Lebensmittel in den Keller leiten. Seit die großen Hypermärkte am GRA eröffneten, findet hier kein Markt mehr statt. Seit zwanzig Jahren ist der einstige Mercato di Torre Spaccata Bürgerzentrum, Schüler*innen werden hier unterrichtet, es werden Judokurse, Lesungen und Filmabende angeboten. Aber auch die Einkaufszentren, die einst das Ende der Märkte bedeuteten, sterben langsam vor sich hin. Die Fassade von La Romanina, die an eine giftgrüne Version eines Gehry-Baus erinnert, tut alles, um Kunden anzuziehen. Doch innen ist es still und leer, viele Läden sind dicht, nur ein paar vereinzelte Massagesessel und heimatlos herumlungernde Sofagarnituren warten auf Kundschaft. II. Formale Strategien des Umbaus: Einnistung, Aushöhlung, Superimposition Am GRA an der Peripherie Roms lassen sich die unterschiedlichsten Umnutzungsstrategien beobachten: Da ist zunächst die Umnutzung durch informelle, später tolerierte Besetzung: Eine der berühmtesten Hausbesetzungen begann in den 1990er-Jahren, als eine Gruppe von Aktivist*innen in der Nähe des GRA ein leerstehendes Hochhaus besetzte und dort alles einrichtete, was dem Neubauviertel an der Stadtautobahn fehlte: einen Saal für Konzerte, Theateraufführungen und Versammlungen, eine Bar mit Küche, ein Hacker-Lab und einen Kräutergarten; sogar ein Planetarium gibt es hier. Das als L38 Squat / Laurentinokkupato bekannt gewordene Projekt wurde zum Vorbild für viele weitere Hausbesetzungen wie der in der kürzlich geräumten Via Curtatone. Die Neubespielung von Raum durch simple Besetzung ist letztlich eine kritische Strategie der 1960er-Jahre; zu den ersten gehörte Urban Deadline, ein New Yorker Studentenkollektiv, das 1967 eine Abbruchparzelle in Harlem besetzte und sie in den 6th Street Park verwandelte, in dem sich Kinder wie Erwachsene treffen konnten. Neben der Besetzung von Raum, der informellen und teilweise illegalen Umdefinition, können als weitere formale Strategien für den Umbau die der Subtraktion oder Aushöhlung, der Umschreibung, Überbauung, Addition oder Einnistung ausgemacht werden. Ziel dieser Umnutzungen ist einerseits die Schaffung von günstigem Wohnraum, andererseits die Neudefinition der Räume und der sozialen Rituale, die eine postindustrielle Gesellschaft für neue Formen des Gemeinschaftslebens definiert – also die Frage, was in Zukunft ein öffentlicher Raum sein kann. Ein klassisches Beispiel der Subtraktion zur Schaffung neuen Wohnraums und neuer sozialer Räume ist die Umwandlung einer heruntergekommenen Reihenhauszeile in Liverpool durch das Kollektiv Assemble für das Granby Four Streets Projekt; eines der Reihenhäuser wurde komplett entkernt und zu einem Gemeinschaftsraum mit einem kollektiven Wintergarten umfunktioniert. So findet sich auch Raum für eine neue Art, miteinander Zeit zu verbringen. Wie aus alten Plattenbausiedlungen ebenfalls durch Subtraktionsstrategien qualitätsvoller Wohnraum geschaffen werden kann, zeigt ein noch unrealisiertes Projekt von AFEA (Association for Ecological Architecture): Sie schlugen der Wohnungsbau-Genossenschaft Altmark eG einen Umbau eines Plattenbau-Wohnkomplexes des Typs WBS 70 in Stendal vor. Einige der oberen Elemente der additiven Plattenbau-Struktur sollen abgenommen werden, damit eine abwechslungsreiche Dachlandschaft mit Gärten und Terrassen entstehen kann, die an die besten Beispiele sozialen Wohnungsbaus von Renée Gailhoustet und Jean Renaudie denken lässt. Kleine Wohneinheiten werden zu „Häusern im Haus“ kombiniert, die über zwei Stockwerke reichen. Erdgeschoss und erster Stock werden zu acht Reihenhäusern mit Garten, wären aber für größere Wohn- oder Alterswohngemeinschaften auch noch weiter zusammenschaltbar. Dadurch löst der Entwurf auch den die Wohnungspolitik bisher dominierenden normativen Fokus auf, der die Schaffung von Wohnraum automatisch als Schaffung von Wohnraum für Singles oder Kleinfamilien auffasst. Im Vergleich zu einer Einfamilienhaussiedlung, so die Architekt*innen, könnten so 60 Prozent mehr Wohnraum und 260 Prozent mehr öffentlicher Raum bei einer 26 Prozent geringeren Bodenversieglung geschaffen werden. Angesichts der Tatsache, dass zurzeit Zehntausende von Plattenbauten abgerissen werden, um durch Einfamilienhäuser ersetzt zu werden – allein in Stendal waren es seit 2000 über 6.000 Wohnungen –, bietet der Umbau eine nachhaltigere Alternative zu einer Abrisspolitik, die jedes Jahr rund 230 Millionen Tonnen Bauschutt und Müll verursacht. Beides, Granby Four Street und Stendal, sind Beispiele für Möglichkeiten, dringend benötigten Wohnraum durch Umbau von Bestandsbauten zu gestalten. In beiden Fällen kommt den Architekt*innen der relativ gesunkene Druck zum verdichteten Bauen zugute. Wenn durch die Verlagerung der Büroarbeit und des Konsums weg aus den Zentren dort der ökonomische Druck zur maximalen Ausnutzung von Flächen sinken sollte, wäre die subtraktive Umbaustrategie ein gangbarer Weg zur Schaffung neuer Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten, die jenseits eng gestapelter Arbeits- und Wohnzellen für die Kernfamilie sowohl andere Wohnformen beherbergt als auch Biodiversitätsfragen stärker berücksichtigt. Als „Großstruktur der Nachkriegsmoderne“ könnte man allerdings auch die suburbanen Ein-, Reihen- und Mehrfamilienhaus-Ensembles der 1950er- bis 1990er-Jahre betrachten, aus denen Tausende täglich in die Städte pendelten. Viele dieser Häuser stehen heute leer, werden aber in ihrem Umnutzungspotenzial kaum erkannt. Wie leicht sie sich umbauen lassen, um größere Familien, Freundeskreise oder Alters-WGs, aber auch Läden und Werkstätten zu beherbergen, zeigte sich etwa 2015, als in aufgelassenen Ortschaften wie Manheim nahe dem Hambacher Forst Hunderte von Geflüchteten untergebracht wurden: in einem Mehrfamilienhaus eine syrische Großfamilie mit 14 Mitgliedern, in einem Einfamilienbungalow sechs alleinstehende Geflüchtete. Hätte man ihnen erlaubt, wie von ihnen gewünscht, die stillgelegten Werkstätten und Läden des Dorfs zumindest provisorisch wieder zu eröffnen und die Sockelgeschosse als Läden umzuwidmen, hätte man ein spannendes Modell zur Erprobung neuer Räume für das soziale Zusammenleben in zuletzt nur als Schlafstädte genutzten Suburbs schaffen können. Diese experimentelle Umnutzung der vielfach kritisierten Vorstädte im Urban Sprawl als Wohn- und Arbeitsort, ihre soziale Verdichtung und Neubelebung ist bisher viel zu selten ein Thema der Umnutzungsdiskussion. Im Maßstab von gemeinschaftsstiftenden Großstrukturen war die Entkernung des Palasts der Republik in Berlin und seine Nutzung als experimentelle Großbühne und als Ausstellungsort ein gelungenes Beispiel für die Umschreibung von Narrativen durch die physische und metaphorische Entleerung eines kontaminierten Bestandsbaus. Bis zu seinem ideologisch motivierten Abriss war der bis auf den rohen Beton ausgeweidete Palast der Republik als sogenannter Volkspalast für die Kunstszene der Stadt, mit der das Stadtmarketing so gern Werbung macht, eine einmalige Bühne – und ein Beispiel für einen kritischen Subtraktionismus als architektonische Umwandlungspraxis. Der auf minimalinvasiven Einnistungen basierenden Neuaneignung bestehender Strukturen steht die Ergänzung bestehender Strukturen durch Anfügungen und weitreichendere Überbauungen gegenüber. Das vor kurzem mit dem Mies van der Rohe Award ausgezeichnete Büro Gustav Düsing will für seinen in Zusammenarbeit mit wolff:architekten und Architekten für Nachhaltiges Bauen entstandenen, siegreichen Entwurf für den Neubau der deutschen Botschafterresidenz in Tel Aviv als einziger Wettbewerbsteilnehmer den Altbau weitgehend erhalten und als „aufgebrochenes Objekt“ behandeln; die Architekt*innen entfernen die alte Hülle, umhüllen den Rohbau mit einer Membran und ergänzen ihn um Außenräume und Zwischenzonen, die durch Wind und Schatten für natürliche Klimatisierung an heißen Tagen sorgen. Dasselbe Vorgehen plant das Büro – dieses Mal mit FAKT – bei seinem Entwurf für die Architekturschule von Siegen: Die Rohbaustruktur der alten Druckerei der Siegener Zeitung, ein zweigeschossiger Waschbeton-Skelettbau aus den 1970er-Jahren, wird vollständig erhalten, die abgenommenen Waschbeton-Fassadenelemente werden als Sitzmöbel genutzt, eine Holzkonstruktion wird als Fassade aufgesetzt. Die neue Wintergarten-Struktur der Fassade wird von der Hängekonstruktion des neuen Dachs abgehängt, ein Leichtbau-System, das, so Düsing, durch eine statische Entlastung des Bestandsbaus möglich wird – schließlich fehlen ja die schwergewichtigen Waschbetonplatten der Fassade. III. Umbau und soziale Praxis: Neue Räume für Bildung, Sorge und Gemeinschaft Etliche der heute obsoleten Infrastrukturgroßbauten der Nachkriegsmoderne dienten der Inszenierung von kollektiven Erlebnissen – ob Messebauten wie das leer stehende Berliner ICC oder Shoppingmalls. Diese Malls sind deutlich sichtbar vom digitalen Strukturwandel betroffen: Der Begriff der Shopping Apocalypse kommt zwar aus den Vereinigten Staaten, wo laut deadmalls.com mehr als 300 Malls als „dying“ oder bereits aufgegeben gelten, wobei hier nicht nur der Wandel des Konsumentenverhaltens, sondern auch ein Überangebot an Malls eine Rolle spielt. Die Nachnutzungsfrage stellt sich aber in jedem Fall; der Abriss etwa der einst für 175 Millionen Dollar errichteten Randall Park Mall nach nur 33 Jahren Betriebszeit ist nur ein Beispiel für eine ökologisch verheerende Abrisspraxis. Auch in Berlin wirken das geschlossene Kaufhaus Galeries Lafayette an der Friedrichstraße und die anliegende Mall mehr oder weniger wie eine Geisterstadt, ebenso bildet sich der Leerstand im Kalle Neukölln, dem Centrum Warenhaus Friedrichshain oder dem Ring-Center an der Frankfurter Allee dramatisch ab. Um dem Verfall des Ring-Centers entgegenzuwirken, durften im vergangenen Jahr Kunstinitiativen wie das Kollektiv FKA SIX ehemalige Läden als Ausstellungs- und Veranstaltungsflächen bespielen. Wie aber können Umnutzungen von Malls aussehen? Wie sehr sich die Mall mit ihren Sanitäreinrichtungen und (im Gegensatz zu Parkhäusern) meist taghell erleuchteten Passagen zum Wohnen anbietet, zeigt der Fall der illegalen Besiedlung einer Shoppingmall in Providence Place, Rhode Island, durch den Künstler Michael Townsend. Zusammen mit sieben anderen Künstlern lebte er von 2003 bis 2007 dort immer wieder in einem 70 Quadratmeter großen unterirdischen Raum. Selbst die Security schien nichts von diesem Raum zu wissen. Townsend und seine Freunde trugen Möbel und eine PlayStation in die Mall. Sie mauerten eine Öffnung zu und bauten eine Tür ein; zum Waschen nutzten sie die Sanitärräume des Einkaufszentrums, wo es auch Duschen gibt. Bis zu drei Wochen am Stück lebten sie in der Mall, ohne dass irgendjemand auf sie aufmerksam wurde. Townsend plante sogar, eine Küche und ein zweites Schlafzimmer einzubauen – aber dann entdeckten die Sicherheitskräfte des Einkaufszentrums den Schwarzbau doch und Townsend wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Die Geschichte ist deswegen interessant, weil die formale Anlage der Mall eine Besiedlung einfach macht. Die Mall imitiert mit Plätzen, Boulevards und Ladenstraßen traditionelle Figuren und Elemente des Städtebaus. Dieser urbanistische Vampirismus, der jene alte Stadt imitierte, die er ökonomisch zerstörte, wurde den Betreibern der Malls von einer kritischen Urbanismustheorie immer vorgeworfen. Aber gerade im Surrogatcharakter der Mall liegt eine Chance: Wenn man die Gewinnerwartung subtrahiert, ist die Shoppingmall eine von ihrer Anlage her extrem dichte urbane Struktur, organisiert für eine große Öffentlichkeit nach dem Prinzip maximalen Konsums. Es ist kein Raum für bloße Erledigungen, sondern bietet mit Cafés, Springbrunnen, Bänken, Pflanzen und Restaurants Aufenthaltsqualität. Weicht die Gewinnerwartung aus den oft schon lange abgeschriebenen Malls, können sich andere Nutzungen einnisten, in denen es um Bildung, Sorge, Pflege, solidarische Praktiken und eine andere Form von Produktion, Geselligkeit und Wohnen geht, die nicht mehr vom konstitutiven Gegensatz von maximaleffizienter Erwerbstätigkeit und Freizeit sowie Erholungsangeboten geprägt sind, sondern von einer umfassenden Neudefinition des Verhältnisses von Arbeit und Zusammenleben. Wie Bildung in einer Mall aussehen kann, zeigte das Projekt Mall Anders: Acht Monate lang, von Dezember 2021 bis Juni 2022, nutzten verschiedene Berliner Universitäten eine 380 Quadratmeter große Einzelhandelsfläche im Charlottenburger Wilma, um dort zu forschen und Wissenschaft in einer neuen Form von Öffentlichkeit zu vermitteln. 50 Kaufhäuser sollen in Deutschland in den kommenden Jahren dichtgemacht werden, eines soll zu einer Schule werden: In Lübeck gibt es Pläne, in ein 2020 geschlossenes Kaufhaus ein Oberstufenzentrum einziehen zu lassen, die Dachterrasse soll ein Pausenhof mit Panoramablick werden; auch in Braunschweig sollen Galeria-Kaufhäuser zu Schulen werden. Wie viel Kohlendioxid durch eine Umnutzung eines Einkaufszentrums eingespart werden kann, zeigt sich am Berliner Forum Steglitz – nämlich rund 32.000 Tonnen gegenüber Abriss und Neubau. Um diese Emissionen auszugleichen, müsste man 1,3 Millionen Bäume pflanzen. Laut einer Analyse des Immobilienunternehmens Enterprise Community Partners könnten in den Vereinigten Staaten, wenn nur 10 Prozent der unrentablen Einzelhandelsflächen in Wohnraum umgewandelt würden, 700.000 neue Wohnungen entstehen. Laut einem Bericht der Bank USB aus dem Jahr 2023 werden in den nächsten fünf Jahren in den USA rund 50.000 Geschäfte schließen. Diese Ruinen bergen ein enormes Belebungspotenzial, sei es als Wohnraum, sei es für lokale Produktion, Reparaturshops oder Begegnungsstätten. Laut einer Studie des Metropolitan Area Planning Council von Massachusetts aus dem Jahr 2021 würde die Umwandlung von nur 10 Prozent der sterbenden Shoppingmall-Flächen im Großraum Boston ausreichen, um das gesamte Bevölkerungswachstum in der Region in den nächsten zehn Jahren aufzufangen. Ausgerechnet die Konsumtempel mit ihrer verschwenderischen Inszenierung von „öffentlichem Raum“ könnten Teil der Lösung werden. Laut einer Analyse des Magazins Fortune sei zwar „die Umwandlung von Einzelhandelsflächen in Wohnraum mit einer Reihe von physischen und politischen Herausforderungen verbunden. Dennoch gibt es wichtige Gründe dafür, dass die Umwandlung toter Einzelhandelsflächen eine vielversprechendere Lösung für die Wohnungskrise darstellt als die Umwandlung von Büros in Wohnungen, die sich als viel teurer und seltener erwiesen hat als ursprünglich angenommen.“ In den Vereinigten Staaten wurden bereits etliche Einkaufszentren erfolgreich zu Wohnkomplexen umgebaut: In Aurora, Illinois, wurde ein Teil des Einkaufszentrums Fox Valley Mall in 304 Wohnungen umgewandelt, auch in Vernon Hills, Illinois, wurde die Hawthorn Mall um 311 Wohnungen und Gemeinschaftseinrichtungen ergänzt. Während hier noch Shopping stattfindet, wurde in Santa Ana, Kalifornien, die Strip Mall Tiny Tim Plaza zu einem Gemeindezentrum mit 51 Wohnungen umgebaut. In Irondequoit, New York, einem Vorort der Stadt Rochester, wurde eine verlassene Mall der Handelskette Sears sehr aufwendig und mit architektonisch eher zweifelhaften Ergebnissen zu einem Wohnkomplex namens Skyview Park Apartments mit 157 Wohnungen für einkommensschwache und ältere Menschen umgebaut; die Anlage wurde 2022 eröffnet. Diese Projekte zeigen, dass trotz rechtlicher Hürden ein derartiger Umbau nicht unmöglich ist. Die Struktur der meist kleinen Läden, die sich zum natürlichen Licht einer verglasten Passage öffnen und Strom- sowie Wasseranschluss haben, bietet sich für eine Wohn- sowie Ladennutzung durchaus auch ohne großen Aufwand an. Studierende des aus der Harvard Graduate School of Design hervorgegangenen FAM-Kollektivs haben schon vor Jahren in ihrer Serie Provocations eine Nachnutzung der Mall als kollektiven Wohnraum oder urbane Farm skizziert. Zur Mall gehört auch der Parkraum. Auch er ist Teil der Großstrukturen der Nachkriegsmoderne. In den Vereinigten Staaten wird der gesamte Parkraum auf insgesamt 20.000 Quadratkilometer geschätzt – das entspricht der Fläche von New Jersey. Wie dieser Raum jenseits seiner konventionellen Neubebauung umgenutzt werden kann, ist in Los Angeles zu sehen: Dort hat das Architekturbüro SelgasCano eine Art Zeltstadt aus kreisrunden kleinen Bauten errichtet, zwischen denen ein Dschungel wuchert. Das sogenannte Second Home liegt in East Hollywood auf einem 9.000 Quadratmeter großen Grundstück mit zwei Bestandsgebäuden, die 1964 von dem legendären Architekten Paul Williams entworfen wurden. Das Projekt beherbergt über 200 Arbeitsplätze, Co-Working-Spaces, ein Café, ein Restaurant, Veranstaltungs- und Konferenzsäle und Ruhebereiche. Die warmgelben, verglasten Zellen sind Büros, und die Korridore, die hier unter freiem Himmel liegen, sind ein Park, aber auch eine Art kollektives Wohnzimmer. Statt neue Büros zu bauen und sie mühsam zu begrünen, hat SelgasCano eigentlich einen Park gebaut, in dem sich 60 ovale Einzelbüros und Besprechungsräume für fast 700 Menschen befinden. Während man hier arbeitet, können die Kinder in den Park-Zwischenräumen Fangen und Verstecken spielen: Vereinbarkeit von Familie und Beruf einmal anders. Es gibt vier verschiedene Formen und Größen von Zellen, durch die transparenten, gebogenen Wände schaut man ins Grüne, als säße man mitten im Urwald. Second Home zeigt eine typologische Alternative zum Großraumbüro. Zusammen ergeben die Zellen eine ganz neue Form von Landschaft, in der Leben und Arbeiten neu sortiert werden könnten. **** Die Stadt baut sich auch ohne Planung um. Durch die technologische Revolution und ihre Folgen steuern die Städte des globalen Nordens auf die größte Ruinenproduktion der Geschichte zu: Viele Postämter, Einkaufszentren, Parkhäuser, Bürobauten werden bald leer stehen. Auf die meist privaten Eigentümer*innen kommen dadurch oft enorme Unterhaltskosten zu. Eine kommerziell weniger ertragreiche Nutzung ist häufig besser als ein Abriss und eine Neubebauung mit ungewisser Rendite. Hier kann eine kluge stadtökonomische Wirtschaftspolitik ansetzen, indem sie Umnutzungen unterstützt. Städte wie Bremen und Hamburg fördern mit Programmen wie „Verborgene Potenziale“ und dem Förderprogramm „Frei_Fläche“ die Zwischen- oder Umnutzung leer stehender Ladenflächen durch Werkstätten oder Kulturräume – wobei hier fast schon wieder eine Fetischisierung von Kultur als alleinigem Standortrettungsmittel zu beobachten ist. Doch langfristig können die Ruinen, die die technologische Revolution hinterlässt, aber auch Straßen und Parkplätze, die hauptsächlich für die Organisation des individuellen Verkehrs von zu Hause zum Büro und zurück bestimmt sind, grundlegend neugestaltet werden. In ehemaligen Bürobauten können, wie die Umnutzung des Berliner Hauses der Statistik schon heute zeigt, kleine lokale Produktionen, dazu Orte für Bildung, Forschung und Pflege entstehen. Man wird all diese leeren Flächen neu definieren können und neue Freiräume haben, um Zeit miteinander zu verbringen, Kinder großzuziehen und mit Freund*innen außerhalb der Kernfamilie zu leben. Ein Leben, nicht mehr auf einen Nine-to-five-Rhythmus beschränkt, könnte in großen, offenen, bewohnbaren Landschaften stattfinden, in denen Arbeit, Bildung, Wissensproduktion und Zusammensein anders organisiert werden. Der große Vordenker des kollektiven Bauens in der Moderne, Charles Fourier, kritisierte zu Beginn der Industrialisierung im frühen 19. Jahrhundert die neu entstehenden kleinen, aufs Notwendigste reduzierten Arbeiterhäuschen am Rande der Städte scharf und forderte stattdessen den Bau eines „Phalansteriums“ – eine Art genossenschaftliches Versailles für Tausende von Arbeiter*innen, die so auch in den Genuss vormals dem Adel vorbehaltener Lebensverhältnisse kommen sollten: Es ging darum, großzügige Wohnanlagen, kultivierte Landschaften, Bildung und hedonistischen Lebensstil zu demokratisieren. Eine der interessantesten Umsetzungen der Idee eines öffentlichen Gemeinschaftsraums inklusive großer öffentlicher Bäder findet sich auf dem Dach eines ehemaligen Verwaltungsbaus in São Paulo, den Paulo Mendes da Rocha zusammen mit MMBB Arquitetos 2017 zu einem – auch mit öffentlichen Mitteln finanzierten – Kulturzentrum umbaute. Der Auftraggeber war eine Gewerkschaftsorganisation. Heute wird das Sesc 24 de Maio täglich von bis zu 10.000 Menschen besucht, die Bibliothek, die kollektiven Wohnzimmer und Restaurants, vor allem aber der riesige Pool auf dem Dach zeigen, wie Architektur eine ökonomisch immer weiter auseinanderdriftende Gesellschaft zumindest zeitweise wieder zusammenbringen kann. Das Sesc 24 de Maio referiert auch auf den Fun Palace von Cedric Price und der Regisseurin und Theaterdirektorin Joan Littlewood. Sie entwarfen 1961 ein offenes Stahlgerüst mit eingehängten, aus Modulen zusammensetzbaren Räumen, Bühnen und Plateaus, in und auf denen der öffentliche Raum, die kollektiven Rituale einer Gesellschaft, die Art, wie Menschen miteinander Zeit verbringen – sich bilden, feiern, forschen, produzieren, lieben –, neu definiert werden sollten. Die Reaktion der Politik auf den Wandel der Stadtzentren war bisher vor allem leichte Panik, gefolgt von Versuchen, das zu retten, was die Stadt bislang prägte. Der ehemalige deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier berief 2020 einen City-Krisengipfel ein, bei dem unter anderem darüber diskutiert wurde, wie der Einzelhandel in den deutschen Fußgängerzonen gerettet werden könne. Aber was man dort findet, sind ja längst nicht mehr die kleinen Läden, die einst die idyllische Altstadt prägten, sondern vor allem jene großen Retailer, die diese Läden verdrängten. Ist es wirklich schade, wenn Ketten wie H&M nicht mehr in den Fußgängerzonen zu finden sind, wenn Verkäufer*innen nicht mehr im Akkord kassieren müssen, wenn die übermüdeten Pendler*innen, die in den Bürotürmen arbeiten, morgens nicht mehr hupend und mit ungesundem Blutdruck eine Stunde im Pendlerstau stehen? Was würde mit der Stadt passieren, wenn aus ihr die Arbeit verschwände, wenn also ihre ökonomische Topografie, ihre kollektiven Rituale nicht mehr um die Idee von Arbeit, Konsum und Kommunikation herum aufgebaut wären? Mag sein, dass die Zukunft der Innenstädte darin liegt, dass dort von Tourist*innen und wenigen Privilegierten, „Innenstadt“ nachgespielt wird, dass die City sich in ihren eigenen Themenpark verwandelt, mit Restaurants und historischen Attraktionen oder deren Nachbauten und Häusern, die vor allem bewohnbare Anlagedepots sind – man würde dann in Innenstädte gehen, wie man bisher in die Museen ging. Vielleicht ist das aber nicht die einzige Perspektive. Wenn ausgerechnet der Kapitalismus, der einst die Bürotürme und die Einkaufszentren wachsen und die Preise für den knappen, in der Innenstadt verbliebenen Wohnraum in die Höhe schießen ließ, durch die noch effizientere Nutzung von Online-Handel und Homeoffice für den endgültigen Abzug all dieser prägenden Funktionen aus dem physischen Raum der Innenstadt sorgt, wenn sie zur Ruine wird und ihren ökonomischen Wert verliert, dann könnte sie am Ende entspannter und ohne übertriebene Gewinnerwartungen neu besiedelt werden – so wie die römischen Arenen und Paläste in der Spätantike und im Mittelalter zu Wohnanlagen umgebaut wurden. Die grundlegende Transformation aber läge im Übergang zu einer Kultur, die ihren Raum nicht mehr nach der Maßgabe von Wachstums- und Effizienzsteigerung organisiert, sondern nach der Idee des otium, der maß-, rücksichts- und genussvollen Betätigung, die sich dem Kult des neg-otium – jener durchökonomisierten Sphäre permanenter Geschäftigkeit, die die Stadtkultur des späten Neoliberalismus prägte – entgegenstellt. 1Vgl. KPMG (Hg.): World Government Summit 2020 – Futures of Cities: Principles for Digital Transformation in Cities, 2021, assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ae/pdf-2022/02/principles-for-digital-transformation-in-cities-english.pdf (Stand: 16.7.2024) 2Siehe hier u. a.: Eli McGarvie: „The return to office Saga: Is remote work dead or just evolving“, in: WeAreDevelopers, 13.5.2024, www.wearedevelopers.com/blog/the-return-to-office (Stand: 16.7.2024); Marvin Schade: „Neue alte Arbeitswelt“, in: Medieninsider, 4.6.2024, medieninsider.com/axel-springer-buro-pflicht-neue-alte-arbeitswelt/22060 (Stand: 16.7.2024) 3Vgl. u. a. Jane Jacobs: The Death and Life of Great American Cities, New York 1961 4Unsichtbares Komitee: Der kommende Aufstand, 2010, www.trend.infopartisan.net/trd1210/insurrection.pdf (Stand: 16.7.2024) 5andersurania.org 6Hans-Jörg Werth: „Aus Alt wird Neu“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.5.2023 7„Abrissmoratorium – Ein offener Brief“, 19.9.2022, www.bda-bund.de/2022/09/abrissmoratorium (Stand: 16.7.2024) 8abrissmoratorium.de 9Bundesarchitektenkammer: Vorschlag zur Änderung der Musterbauordnung (MBO), 15.5.2023, bak.de/wp-content/uploads/2023/05/Aenderungsvorschlag-der-BAK-zur-MBO_Endf-15-5-23.pdf (Stand: 16.7.2024) 10Charlotte Collins, Mariam Hofbeck: „Umbau statt Abriss – Diese 15 historischen Gebäude werden jetzt überraschend anders genutzt“, in: AD, 28.5.2023, www.ad-magazin.de/galerie/umbau-statt-abriss-15-historische-gebaeude-neu-genutzt (Stand: 16.7.2024) 11Diana Artus: „Flanieren ohne Regenschirm“, in: BauNetz, 26.10.2020, www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Transformation_des_Gare_Maritime_in_Bruessel_von_Neutelings_Riedijk_7441420.html (Stand: 16.7.2024) 12Niklas Maak: „Neues Deutschland“, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 3.2.2016, www.faz.net/aktuell/feuilleton/leere-haeuser-als-neues-zuhause- fuer-fluechtlinge-14043394.html (Stand: 16.7.2024) 13„Schule statt Kaufhaus in der Altstadt“, in: BauNetz, 30.5.2022, www.baunetz.de/meldungen/Meldungen-Symposium_in_Luebeck_7941960.html (Stand: 16.7.2024) 14Hans-Jörg Werth 2023 (wie Anm. 6) 15Irina Ivanova, Sydney Lake: „Tired – Office conversions to residential. Wired: Turning dead malls and suburban shopping strips into apartments“, in: Fortune, 13.4.2024, fortune.com/2024/04/13/office-conversions-retail-residential-dead-malls-housing (Stand: 16.7.2024) 16Ebd.
| Erscheinungsdatum | 13.09.2024 |
|---|---|
| Zusatzinfo | 200 farbige Abbildungen und Pläne |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 235 x 297 mm |
| Gewicht | 850 g |
| Einbandart | geklebt |
| Themenwelt | Technik ► Architektur |
| Schlagworte | Abriss/Neubau • Architekturbiennale Venedig 2023 • Bauwirtschaft • Großstruktur • Infrastruktur • Klimawandel • Paradigmenwechsel • Praxis • Sozialstruktur • Transformation • Umbau • Umbaukultur • umbaustrategien • Umbauwende |
| ISBN-10 | 3-931435-86-5 / 3931435865 |
| ISBN-13 | 978-3-931435-86-8 / 9783931435868 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich