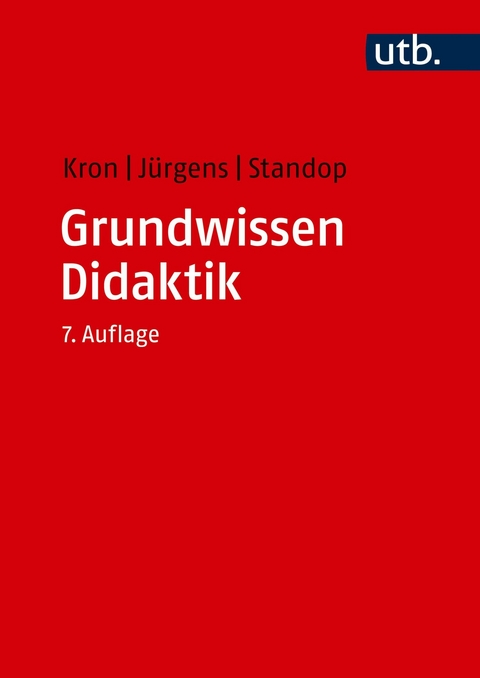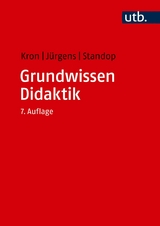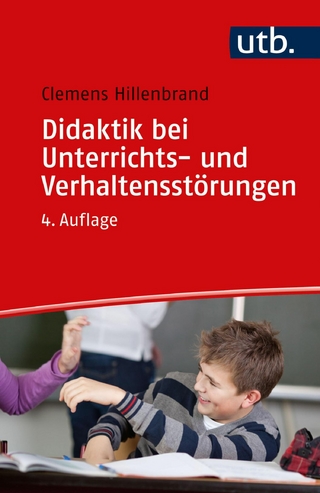Grundwissen Didaktik (eBook)
282 Seiten
UTB GmbH (Verlag)
978-3-8463-8802-0 (ISBN)
Dr. phil. Friedrich W. Kron (verstorben) lehrte am Institut für Erziehungswissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Vorwort zur 7. Auflage9
Vorwort zur 1. Auflage10
Hinweise zur Arbeit mit diesem Buch13
1 Erste Begegnungen mit der Didaktik als Gegenstandsfeld in der Lehrer:innenausbildung14
1.1 Das Gegenstandsfeld als Studien- und Ausbildungsinhalt14
1.2 Die Fach- und Wissenschaftssprache18
1.3 Die Rolle der Didaktik in der „zweiten Phase“ der Lehrer:innenbildung18
1.4 Didaktik als wissenschaftliche Disziplin20
1.4.1 Didaktik als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft20
1.4.2 Das Fach und seine Nachbardisziplinen22
1.5 Die Stellung der Didaktik im Bildungssystem24
1.5.1 Konkretisierungsfelder der Didaktik25
1.5.2 Das Verhältnis von Allgemeiner Didaktik und Fachdidaktik30
1.5.3 Das Verhältnis von Didaktik und Methodik32
1.6 Zur Wort- und Begriffsbedeutung34
2 Didaktik als wissenschaftliche Disziplin37
2.1 Klassische Bestimmungen37
2.1.1 Didaktik als Wissenschaft vom Lehren und Lernen38
2.1.2 Didaktik als Theorie und Wissenschaft vom Unterricht39
2.1.3 Didaktik als Theorie der Bildungsinhalte40
2.1.4 Didaktik als Theorie der Steuerung von Lernprozessen41
2.1.5 Didaktik als Anwendung psychologischer Lehr- und Lerntheorien42
2.2 Didaktik als schulkulturelle Vermittlungswissenschaft43
2.2.1 Didaktik als Enkulturationswissenschaft43
2.2.2 Enkulturation als Grundbegriff44
2.2.3 Vier Betrachtungsebenen didaktischer Phänomene47
2.3 Wissenschaftliche Grundlegungen54
2.3.1 Wissenschafts- und erkenntnistheoretischer Rahmen54
2.3.2 Begriff und Funktion didaktischer Theorien55
2.3.3 Der Zusammenhang von Theorien, Modellen und Konzepten58
2.3.4 Erkenntnis- und handlungsleitende Interessen61
2.3.5 Das interpretative Paradigma als Basis einer neuen Didaktik65
2.4 Didaktik und ihre Gegenstandstheorien: ein Überblick 66
3 Lerntheorien und -modelle im Kontext von Lehren und Lernen73
3.1 Lernen und Lehren aus der Sicht des Sozialbehaviorismus:
B. F. Skinner73
3.1.1 Die Einflussfaktoren der Umwelt74
3.1.2 Verstärkung als grundlegender Steuerungsmechanismus76
3.1.3 Selbstverstärkung als Zusatzannahme78
3.1.4 Das programmierte Lehren und Lernen79
3.2 Die Theorie vom Lernen am Modell: Bandura81
3.2.1 Zur begrifflichen Klärung81
3.2.2 Einstellungen und Wertorientierungen82
3.2.3 Das Selbstkonzept im eigenen Erleben83
3.2.4 Individuelle und Umweltbedingungen des Lernens am Modell84
3.3 Die strukturgenetische Lerntheorie und die Konsequenzen für das Lehren: Aebli und Piaget86
3.3.1 Der Zusammenhang von Lernen und Entwicklung: Aebli86
3.3.2 Der Zusammenhang von Handeln und Denken: Dewey93
3.3.3 Die Entwicklung von Handlungskonzepten: Dewey95
3.3.4 Die zentrale Funktion der Operationen: Piaget97
3.3.5 Der Zusammenhang von Struktur und Funktion als Genese: Piaget98
3.4 Die konstruktivistische Betrachtung von Lehren und Lernen: Kelly100
3.4.1 Der Ansatz des psychologischen Konstruktivismus101
3.4.2 Die Bedeutung psychischer Konstrukte102
3.4.3 Der Mensch als Konstrukteur von Wirklichkeit103
3.4.4 Der Königsweg des Lernens: Forschen und Erkennen104
3.4.5 Schlussfolgerungen für die Praxis106
3.5 Neurobiologische Erkenntnisse zum Lernen und Schlussfolgerungen für das Lehren107
3.5.1 Die Bedeutung der Wahrnehmung108
3.5.2 Die Funktionen des Gedächtnisses111
3.5.3 Die Theorie der kognitiven Belastung von Sweller et al.115
4 Theorien, Modelle und Konzepte von Unterricht118
4.1 Bildung als Leitbegriff: Klafki118
4.1.1 Die Grundlegung: Die Theorie der kategorialen Bildung118
4.1.2 Modelle zur didaktischen Analyse von Unterricht sowie Unterrichtskonzepte124
4.1.3 Die Weiterführung: Der kritisch-konstruktive Theorieentwurf127
4.1.4 Das Konzept zur Unterrichtsvorbereitung133
4.1.5 Bildung für die Zukunft135
4.2 Lernen als Leitbegriff137
4.2.1 Das lerntheoretische oder „Berliner Modell“ zur Analyse und Planung von Unterricht: Heimann138
4.2.2 Die Grundlegung: Der lehrtheoretisch-kritische Entwurf: Schulz141
4.2.3 Die Weiterführung: Das „Hamburger Modell“ zur Planung von Unterricht: Schulz145
4.2.4 Die lernzielorientierte Modellbildung: Chr. und B. Möller149
4.2.5 Der lernorganisatorische Entwurf mit emanzipatorischer Zielstellung: Bönsch154
4.3 Interaktion als Leitbegriff158
4.3.1 Begriff und Bedeutung von Interaktion und Handeln159
4.3.2 Begriff und Bedeutung von Kommunikation162
4.3.3 Unterricht als Interaktion: Biermann166
4.3.4 Die Betonung der Beziehungsebene im Unterricht: Bosch, Buschmann und Fischer167
4.3.5 Unterricht als Kommunikationsprozess: Popp und Rumpf169
4.3.6 Der handlungs- und situationsbezogene Ansatz: Flechsig und Haller171
4.3.7 Der kritisch-kommunikative Modellentwurf: Winkel175
4.3.8 Handlungsorientierte Didaktiken179
4.4 System als Leitbegriff180
4.4.1 Zum Begriffsverständnis180
4.4.2 Der kybernetische Theorie- und Modellentwurf: v. Cube184
4.4.3 Der systemrationale Ansatz: König und Riedel188
4.4.4 Die strukturtheoretische Erfassung von Lehr- und Lernprozessen: Peterßen192
4.4.5 Unterricht aus system- und evolutionstheoretischer Perspektive: Scheunpflug193
4.5 Konstruktion als Leitbegriff196
4.5.1 Zum Begriffsverständnis196
4.5.2 Der systemisch-konstruktivistische Ansatz: Reich198
4.6 Instruktion und Konstruktion als Leitbegriffe: Der schüler:innenaktive Unterricht200
4.6.1 Heuristik des schüler:innenaktiven Unterrichts202
4.6.2 Aktivitätsparadigma als Leitfaden204
4.7 Integration als Leitbegriff205
4.7.1 Herstellung von Gemeinsamkeit205
4.7.2 Die entwicklungslogische Didaktik: Feuser207
5 Curriculum und aktive Curriculumarbeit212
5.1 Grundlegungen212
5.1.1 Zum aktuellen Diskussionsstand: Die Wiederentdeckung des Curriculums212
5.1.2 Zur Curriculum- und Lehrplantradition214
5.1.3 Zur internationalen Curriculumdiskussion217
5.1.4 Strukturelemente eines Curriculums220
5.2 Curriculumkonzeptionen221
5.2.1 Die bildungstheoretische Curriculumkonzeption221
5.2.2 Die lerntheoretische Curriculumposition224
5.2.3 Die pragmatische Auffassung von Curriculum227
5.3 Formen eines Curriculums229
5.3.1 Das formelle Curriculum230
5.3.2 Das schulbezogene Curriculum230
5.3.3 Das klassenbezogene Curriculum230
5.3.4 Handlungsorientierte Curricula231
5.3.5 Vom Lehrplan zum Curriculum232
5.4 Curriculumkonzepte von Lehrer:innen233
5.4.1 Das interpretationsfeste Konzept234
5.4.2 Das interpretationsoffene Konzept234
5.4.3 Das interpretative Curriculumkonzept235
5.5 Der curriculare Transformationsprozess der Lehrer:innen235
6 Mediendidaktische Grundlegungen238
6.1 Mediendidaktik als Wissenschaft238
6.1.1 Mediendidaktik als interdisziplinäres Fach238
6.1.2 Mediendidaktische Ansätze240
6.2 Mediendidaktische Kompetenz243
6.2.1 Zum Kompetenzbegriff243
6.2.2 Allgemeine Medienkompetenz244
6.2.3 Pädagogische und didaktische Kompetenz246
6.2.4 Medienpädagogische und -didaktische Kompetenzen248
6.2.5 Das Technologie-Akzeptanz-Modell252
6.3 Digitale Medien als aktueller Schwerpunkt in Mediendidaktik und Unterricht254
6.3.1 Zum Gebrauch des Medienbegriffs254
6.3.2 Die Medientafel als Überblick255
6.3.3 Medien als Interaktionsangebote256
6.3.4 Was ist „neu“ an digitalen Medien?257
6.3.5 Funktionen digitaler Medien im Unterricht258
6.3.6 Fünf pragmatische mediendidaktische Axiome260
Literatur261
Namensregister277
Sachwortregister280
1Erste Begegnungen mit der Didaktik als Gegenstandsfeld in der Lehrer:innenausbildung
In diesem Kapitel werden die Leserinnen und Leser auf ihren Erfahrungsebenen angesprochen: im Studium, der „ersten Phase“ der wissenschaftlichen Ausbildung; im Referendariat, der „zweiten Phase“ der Berufsausbildung, und in der Berufstätigkeit selbst.
Im Zentrum stehen Erörterungen über Didaktik als Hochschuldisziplin. Informationen über Didaktik als Inhalt im Studium und über die Wort- und Begriffsbedeutung runden die Darlegungen ab.
1.1Das Gegenstandsfeld als Studien- und Ausbildungsinhalt
Modul
Studierenden begegnet das Fach zunächst in Einführungsveranstaltungen, den ersten Lehrveranstaltungen oder in Studieninformationen. Institutionell konkretisiert wird die Begegnung mit Didaktik in den Modulen, die von den Instituten, Fachbereichen oder Fakultäten für das Bachelor- und Masterstudium „vor Ort“ entwickelt und verbindlich gemacht werden. Module sind aus mehreren Themen bestehende Studieneinheiten.
Kerncurriculum Erziehungs-wissenschaft
Alle Module gründen in einer Reihe von Empfehlungen der „Deutschen Gesell- schaft für Erziehungswissenschaft“ (DGfE), der Standesorganisation der Erziehungswissenschaftler:innen, die mit dem Begriff „Kerncurriculum Erziehungswissenschaft“ belegt werden (www.DGfE.de). Auch die Kultusministerkonferenz (KMK) hat Empfehlungen zur Strukturierung der neuen BA- und MA-Studiengänge in Bezug auf ein Lehramt herausgegeben (KMK 2004, 2019).
Die DGfE hat außerdem analoge Empfehlungen für das Studium der Pädagogik als Schulfach, z. B. in Fachschulen und sozialpädagogischen Zweigen bzw. allgemeinbildender gymnasialer Oberstufen, und für die Lehrer:innenbildung herausgegeben (DGfE 2005). Allen Empfehlungen ist gemein:
■Sie basieren auf dem Beschluss der Ländervertretungen in der Europäischen Union 1998 in Bologna, das Studium an den Hochschulen der EU-Länder als Bachelor- und Masterstudiengänge zu organisieren. Zwecksetzungen dieser für Deutschland neuen Studienorganisation sind die Standardisierung und damit angestrebte Vergleichbarkeit der Leistungen und Abschlüsse sowie die angezielte erhöhte Mobilität der Studierenden innerhalb Europas.
■Sie bieten Studieneinheiten oder Kompetenzbereiche an, die auf BA- und MA-Studiengänge verteilt sind.
■Die in den Empfehlungen festgeschriebenen Studieninhalte und -ziele bilden die Grundlage für die Erstellung von Modulen vor Ort.
Alle Empfehlungen der DGfE basieren auf dem Kerncurriculum für das Hauptfachstudium Erziehungswissenschaft. Die Empfehlungen der KMK konzentrieren sich auf die Lehrer:innenbildung und entwickeln auch eigenständige Themen.
Tab. 1: Kerncurriculum Erziehungswissenschaft
Wissenschaftliche Grundlagen der Erziehungswissenschaft
■Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft und ihrer Teildisziplinen
■Geschichte und Theorie der Erziehung und Bildung
■Wissenschaftstheoretische Ansätze
Gesellschaftliche Grundlagen der Erziehungswissenschaft
■Institutionen der Erziehung und Bildung
■Gesellschaftliche Bedingungen pädagogischer Institutionen
■Gesellschaftliche Differenzierungen
Forschungsmethodische Grundlagen
■Qualitative und quantitative Methoden
■Forschungs- und Denktraditionen
■Bildungsforschung
Einführung in erziehungswissenschaftliche Studienrichtungen
■Erziehungswissenschaft und ihre Teildisziplinen
■Einführung in eine Studienrichtung
■Die Studienrichtung als Handlungsfeld
Das Kerncurriculum für das Hauptfachstudium Erziehungswissenschaft wird in Tabelle 1 vorgestellt. Es besteht aus vier Studieneinheiten, die durch je drei Themenbereiche repräsentiert sind. Die fett gedruckten Themenbereiche betreffen die Didaktik und werden zum großen Teil in diesem Buch behandelt.
Im Folgenden werden die didaktischen Themen aus verschiedenen Empfehlungen skizziert, die von der DGfE und der KMK in den Jahren 2004 bis 2008 veröffentlicht worden sind (www.DGfE.de; Heft 29, 2004; Heft 31, 2005; Heft 32, 2006):
(1) Das „Kerncurriculum für das Hauptfachstudium Erziehungswissenschaft“ (DGfE 2004) umfasst einen Mindeststandard an Studieninhalten, zu dem die didaktischen Themenbereiche aus Tabelle 2 gehören.
(2) Das „Kerncurriculum für das Studium des Schulfaches Pädagogik im Bachelor/Baccalaureus- und Master/Magister-System“ (DGfE 2005) gilt insbesondere für die Ausbildung von Lehrer:innen, die Pädagogik als Schulfach in Realschulen, Gymnasialen Oberstufen, Gesamtschulen und Berufsbildenden Schulen unterrichten. Dieses Kerncurriculum enthält drei Studieneinheiten zur Fachdidaktik Pädagogik und eindeutig didaktische Themen (Tab. 3).
(3) Das „Strukturmodell für die Lehrerbildung im Bachelor/Baccalaureus (BA)- und Master/Magister-System (MA)“ (DGfE 2005) kann als Vorschlag eines Kerncurriculums für das Studium für ein Lehramt angesehen werden. Es ist aus der Gesamtverantwortung der Erziehungswissenschaft für die Ausbildung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer heraus zu verstehen. Dabei bildet das „Kerncurriculum Erziehungswissenschaft“ die Grundlage.
Die inhaltliche Strukturierung des BA- und MA-Studiums ist durch je drei erziehungswissenschaftliche Studieneinheiten bestimmt, in denen sich klar didaktische Themen bzw. Studieneinheiten finden, wie Tabelle 4 zeigt.
BA
■Grundlagen von Erziehung und Bildung
■Rahmenbedingungen von Bildung, Ausbildung und Erziehung
■Tätigkeitsfeld Schule
MA
■Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens
■Grundlagen professionsorientierter Forschungsmethoden
■Professionsspezifische Vertiefung
(4) Die „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ (KMK 2004, 2019) sind nach vier großen „Kompetenzbereichen“ gegliedert:
■Unterrichten,
■Erziehen,
■Beurteilen sowie
■Innovieren.
Tab. 2: Didaktisch relevante Themenfelder in den „Kerncurricula Erziehungswissenschaft“ (DGfE)
1.Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft und ihrer Teildisziplinen, z. B. Lehren und Lernen, Unterricht, Erziehung, Bildung, Entwicklung, Sozialisation, Institutionen, Handeln, Verhalten, Leistung, Ausbildung.
2.Geschichte der Theorie und Bildung, z. B. didaktische Problementfaltung in der Geschichte der Pädagogik (ein eigenes Kapitel zu diesem Thema finden Sie unter www.reinhardt-verlag.de auf der Seite dieses Buches), Theorien und Modelle der Didaktik, des Lehrens und Lernens, des Unterrichts und ihre Funktionen in Forschung und pädagogischer Praxis.
3.Institutionen der Erziehung und Bildung, z. B. Schule und außerschulische Einrichtungen, Organisationsstrukturen und -formen, Interaktions- und Kommunikationsprozesse, gesellschaftliche Bedingungen schulischen Lehrens und Lernens.
4.Bildungsforschung, z. B. Unterrichts- und Curriculumforschung.
5.Erziehungswissenschaft, ihre Teildisziplinen und Handlungsfelder, z. B. Didaktik als Begründung der Praxis organisierten Lehrens und Lernens, Fachdidaktik, Lehrer:innenbildung, Pädagogik der frühen Kindheit, Mediendidaktik.
Tab. 3: „Didaktik im Kerncurriculum“ für Pädagogik als Schulfach (DGfE)
1.Lehrplanentwicklung
2.Fachdidaktische Ansätze
3.Unterrichtsinhalte und -methoden des Pädagogikunterrichts
4.Text- und Praxisanalyse
5.Projekte
6.Fachdidaktisches Lehrforschungsprojekt.
Tab. 4: Didaktik im „Strukturmodell für die Lehrerbildung“ (DGfE)
1.Grundbegriffe wie z. B. Lehren und Lernen, Unterricht, Bildung, Ausbildung
2.Forschungsmethodische...
| Erscheint lt. Verlag | 13.5.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Didaktik |
| Sozialwissenschaften ► Pädagogik ► Schulpädagogik / Grundschule | |
| Schlagworte | Aebli • Bandura • Bildung • bildungsinhalte • Curricula • Dewey • didaktische Methoden • Didaktisches Handeln • didaktische Theorien • Einführung • ericson • Erziehungswissenschaft • Erziehungswissenschaften studieren • Fachdidaktik • Freiarbeit • Gemeinschaftsschulen • Gymnasium • Handbuch • Klafki • Lehramt • Lehramtsstudium • Lehrbuch • Lehrerausbildung • Lehr- und Lernprozess • Lernprozess • Lerntheorie • Mediendidaktik • Medienpädagogik • Nachschlagewerk • Pädagogik • Piaget • Repetitorium • Schulbildung • Schule • Schulpädagogik • Skinner • Stadtteilschulen • Standardlehrbuch • Unterrichtsgestaltung • Unterrichtskonzepte |
| ISBN-10 | 3-8463-8802-5 / 3846388025 |
| ISBN-13 | 978-3-8463-8802-0 / 9783846388020 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,6 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich