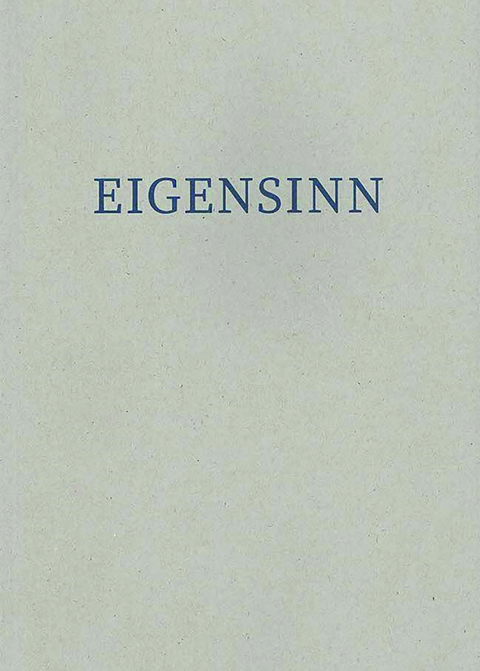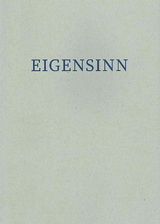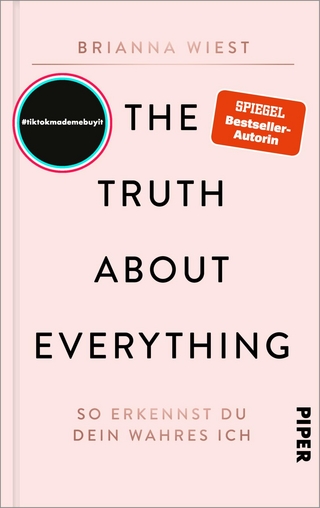Eigensinn
Aufland Verlag
978-3-944249-32-2 (ISBN)
Und wir wollten herausfinden, ob der vehemente Sog der Großdiskurse unserer Gesellschaft auf dem Land an Grenzen stößt – und ob diese Grenzen auch ihre guten Seiten haben. Wir suchten also nach einem ländlichen Erfahrungsgrund, der den medialen Sinnstiftungen und Leitideen dieser Gesellschaft gegenüber Distanz ermöglicht. Und wir wollten herausfinden, ob diese einzelnen Erfahrungen über den persönlichen Horizont hinausweisen und eine soziale Dimension haben. Im Begriff des Eigensinns schienen uns diese Fragen angelegt.
In diesem Werkstattbuch Nr. 6 zum Jahresthema EIGENSINN des Oderbruchmuseums finden sich Berichte von Menschen die Tiere halten und züchten, auf verschiedene Weisen bäuerlich produzieren, Dinge Sammeln und anderen zeigen, miteinander tauschen, sich um Menschen kümmern, politisch engagieren, Bier brauen, Autos schrauben, eine Schule gegründet haben…
Eigensinn, so stellten wir fest, hat kein missionarisches Moment. Aber wenn es Menschen gelingt, eigene Ressourcen aufzuschließen und miteinander ein eigenes gesellschaftliches Spiel zu stiften, das nach selbst gewählten Regeln funktioniert, ist dies für die Beteiligten nicht nur auskömmlich, es bleibt auch kaum die Zeit, den selbst gestalteten Teil der Welt zu überschreiten. Verantwortung übernimmt man für das, was man zur Hand hat. Dass die großen und kleinen Verhängnisse der Gegenwart nicht immer in dieser Beschränkung zu lösen sind, mag wohl sein. Aber haben nicht viele dieser Verhängnisse ihren Ursprung gerade im Fehlen solcher eigensinnigen Lebensmodelle? Sind diese nicht der Humus, in dem friedliche, bescheidene, sich selbst beschränkende Praxen gedeihen, in denen repariert wird, in denen aus Mangel Reichtum und aus Konflikten Entwicklung wird?
Humus des Friedens Ländlicher Eigensinn und was man von ihm lernen kann Kenneth Anders Die Redensart vom sturen Bauern ist alt. Heute wird sie nur noch selten ausgesprochen, aber die damit verbundene Idee hat sich gehalten und schlägt sich in vielen Varianten nieder. In den über zwanzig Jahren des Demografiediskurses, in denen das Landleben als Auslaufmodell bezeichnet wurde, standen eigentlich alle, die nicht in die Ballungsräume ziehen wollten, als irgendwie begriffsstutzig unter dem Generalverdacht der Sturheit. Bauern, die nicht auf „Bio“ umstellen, erscheinen als verstockt, Landbewohner, die AfD wählen, sind mindestens dumm, die Ölheizung im ländlichen Keller und das dieselgetriebene Auto – wichtigstes Element der ländlichen Mobilität – sind gestrig. Man kann das zurückweisen oder rechtfertigen. Interessanter sind die Versuche, dieses Bild fruchtbar zu machen, wie man es in den Büchern von Dörte Hansen und Juli Zeh erleben kann. Die aufschlussreichste literarische Erkundung der ländlichen Lebenshaltung, die mir bekannt ist, ist die des britischen Autors John Berger. Wenn ein Bauer für sein Recht, eigenen Schnaps zu brennen, sehenden Auges ins Gefängnis geht, ahnt man, dass der übliche Sturheitsbefund zum Verständnis nicht ausreicht. Vielmehr ähnelt er dem Vorwurf der Faulheit: Beides sind Scheinerklärungen, durch die man nicht schlauer wird. Also gilt, wie immer: Will man Menschen verstehen, sollte man sie zuerst selbst sprechen lassen. Eben dies haben wir am Oderbruch Museum, wie in den vorherigen fünf Jahren auch, getan. Das Jahresthema „Eigensinn“ wurde aus zwei Gründen gewählt. Zum einen wollten wir nach fünf Jahren, in denen jeweils recht klar abgegrenzte Teilbereiche des Oderbruchs erkundet wurden, einen Querschnitt wagen. Wir wollten schauen, ob es etwas Gemeinsames gibt, das zwischen dem ländlichen Bauen, der Auseinandersetzung mit dem Wasser, der Landwirtschaft, der dörflichen Gemeinschaft oder dem Handwerk liegt – in verschiedenen Erscheinungsformen zwar, aber doch in Beziehung zur gemeinsamen Landschaft. Darüber hinaus aber wollten wir herausfinden, ob der vehemente Sog der Großdiskurse unserer Gesellschaft auf dem Land an Grenzen stößt – und ob diese Grenzen auch ihre guten Seiten haben. Wir suchten also nach einem ländlichen Erfahrungsgrund, der den medialen Sinnstiftungen und Leitideen dieser Gesellschaft gegenüber Distanz ermöglicht. Und wir wollten herausfinden, ob diese einzelnen Erfahrungen über den persönlichen Horizont hinausweisen und eine soziale Dimension haben. Im Begriff des Eigensinns schienen uns diese Fragen angelegt. Er ist weniger emphatisch als das große Wort der Freiheit, weniger optimistisch als die Rede vom Selbermachen und weniger wertend als der bereits erwähnte Befund der Sturheit. Aber mit wem muss man sprechen, wenn man diese Fragen vertiefen will? Eine erste Spur führt in die Selbstversorgung. Die eigene Herstellung von Gemüse, Milchprodukten oder Fleisch wird in unserer Gesellschaft in der Regel missverstanden, weil es kaum einen qualifizierten Begriff der Subsistenzwirtschaft gibt. Die Subsistenzwirtschaft, und sei sie noch so klein, ist aus der Versorgungs- und Verbrauchskultur heraus nur in verniedlichter Form zu verstehen – als Hobby. Gern wird sie belächelt, vor allem, indem man sie als Autarkielösung fehlinterpretiert; Selbstversorgung wäre demnach eine Strategie, die in der komplexen Gesellschaft scheitern muss. Andere überfrachten sie mit politischer Mission als Umbruch ins postfossile Zeitalter, wie im Diskurs über das Urban Gardening zu sehen ist. Entscheidend am subsistenzwirtschaftlichen Handeln ist aber etwas anderes: die kontinuierliche Beziehung zu einem ganz bestimmten, nicht austauschbaren Teil der Welt. Dieser Teil wird für den Menschen im subsistenzwirtschaftlichen Handeln zur Ressource. Mensch und Ressource bilden ein kleines System, das sich von seiner Umwelt unterscheidet und eine eigene Komplexität stiftet. So entsteht eine eigene räumliche und zeitliche Ordnung. Menschen richten ihr Tun an den Erfordernissen aus, die sich im Selbstversorgungsregime ergeben. Die Schweine müssen gefüttert, der Stall muss ausgemistet, das Beet gejätet werden. Außerdem akkumuliert man Erfahrung, die an einem ganz konkreten Standort gemacht wurde und für spezifische Bedingungen gilt, sodass die eigene Tätigkeit nach und nach besser gelingt beziehungsweise durch eigenes Scheitern neu herausgefordert wird. Inwiefern diese Empirie übertragbar ist, ist für das Gelingen und Misslingen nicht wichtig. Zwar tauschen Selbstversorger Erzeugnisse und Erfahrungen, aber entscheidend ist, dass die eigene Praxis nicht an den gesellschaftlichen Regeln, sondern an den Erfordernissen der Ressource ausgerichtet ist. Eine eigensinnige Praxis kann deshalb einen großen Teil des menschlichen Sinnbedarfs decken, sodass Sinnangebote der Gesellschaft an Bedeutung verlieren. Damit einher geht das Bewusstsein, dass Dinge, die für einen selbst sinnstiftend und erfüllend sind, für andere möglicherweise bedeutungslos sind. Im Eigensinn steckt kein Missionsgeist. Vielmehr lässt sich eine gewisse Einsilbigkeit kennenlernen: Ich mach’ das so. Dazu kann ich nichts sagen. Ich finde das so aber besser. Ich kenne das gar nicht anders. Umso größer war unsere Freude darüber, dass uns die befragten Oderbrücher dennoch bereitwillig über ihr Leben Auskunft gaben. Der Logik des Eigensinns entspricht es, dass ordnende Eingriffe in die eigene Praxis durch die Gesellschaft meist störend oder sogar bedrohlich wirken. Die eigene – und eben unabhängige – Bindung an die Ressource wird strapaziert oder sogar zerstört. Es ist kein Wunder, dass die Aufgabe der Tierhaltung im Zuge der landwirtschaftlichen Kollektivierung der DDR für viele Bauern ein Albtraum war, der noch heute in den Familienerzählungen eine Rolle spielt. Das Bewusstsein davon, wie die Tiere behandelt werden müssen, war nicht Teil öffentlicher Verordnungen oder allgemeiner Wertvorstellungen, sondern es wurzelte in einem tiefsitzenden, oftmals über Generationen aufgebauten Programm aus Erfahrung und täglicher Fürsorge, das nun gewaltsam durchbrochen wurde. Auch heute entzünden sich die größten Konflikte zwischen den kleinen selbstversorgenden Systemen und der Gesellschaft im Bereich der Tierhaltung. Dies liegt vor allem an den veterinärmedizinischen Standards, die im Zuge der Kontrolle immer größerer Tierbestände in der professionellen Landwirtschaft letztlich auch den kleinen Tierhaltern zum Maßstab gesetzt werden. Die Verordnungen bei den jährlichen Vogelgrippen zum Beispiel gehen an der Wirklichkeit kleiner Selbstversorgungswirtschaften mit Hühnern, Enten und Gänsen vorbei: Wer seine Hühner im Freien hält, hat oft gar keine Kapazitäten für eine wochenlange Einstallung. Auch der gegenwärtige Umgang mit der Afrikanischen Schweinepest wird wahrscheinlich zu vielen irreversiblen Aufgaben in der individuellen Schweinehaltung führen. Das Bedauern der Politik über diese Schäden hält sich, wie bei allen „alternativlosen Maßnahmen“, in Grenzen. Dass die Selbstversorgung eine für ländliche Räume elementare kulturelle Praxis ist, wird in der Versorgungsgesellschaft mit einem Achselzucken quittiert. Für jede Subsistenzwirtschaft werden bestimmte Dinge benötigt, die das System nicht allein generieren kann: Stoffe, Energie, Geräte, Saatgut, Tiere und vieles mehr. Diese Bedarfe verweisen den Selbstversorger auf die Gesellschaft, es gibt also von vornherein keine intrinsische Idee der Autarkie. Allerdings wird die praktische Agenda der Selbstversorgung nur schwach von dieser gesellschaftlichen Abhängigkeit beeinflusst, denn die von der Umwelt beanspruchten Güter werden im subsistenzwirtschaftlichen System sofort angeeignet. Ein Spaten, der regelmäßig benutzt wird, ist der eigene Spaten. Man hat ihn gekauft, geerbt, gefunden, geschenkt bekommen, aus Teilen zusammengesetzt – das ist auf Dauer nicht mehr wichtig. Die Übergänge der ländlichen Subsistenzwirtschaften zur Erwerbsarbeit sind fließend. Dass aus dem Interesse an alten Tomatensorten eine kleine Geschäftsidee wird oder aus der privaten Leidenschaft für das Bierbrauen eine regionale Brauerei entsteht, tut dem in der jeweiligen Praxis wurzelnden Eigensinn keinen Abbruch – denn auch hier entfaltet sich die Tätigkeit nicht aus einem gesellschaftlichen Teilsystem und dessen Erfordernissen heraus, sondern aus dem, was die Ressource einem abverlangt und was sie einem ermöglicht. Auch die professionelle moderne Landwirtschaft hat noch ein durch ihren Boden bedingtes subsistenzwirtschaftliches Fundament, das heute meist übersehen wird. Die Grenzen zu emotionalen Beweggründen wie Freude, Leidenschaft und Hingabe für das eigene Tun sind ebenfalls fließend. Es kann sein, dass aus einer geliebten Freizeitbeschäftigung eine ernste Sache wird, die Auswirkungen auf die ganze Lebensführung hat. Dem Eigensinn mag durch Verluste oder Misslingen sogar Leid innewohnen, dieses wird aber meist ohne Selbstmitleid in Kauf genommen. Entscheidend ist wiederum die Beziehungsqualität zwischen dem Menschen und dem von ihm angeeigneten Teil der Welt. Halten wir zunächst fest: Ländlicher Eigensinn entzündet sich oft durch die Verfügung über eine Ressource. Er gedeiht durch eine bestimmte Praxis in Auseinandersetzung mit einer bestimmten Sache. Damit wäre es schon einmal gelungen, das Motiv der Sturheit vom Befund eines Persönlichkeitsmerkmals auf die Beziehungen zwischen Menschen und ihrer Welt zu lenken. Das ist ein erster wichtiger Schritt. Ein zweiter Schritt besteht darin, die Flexibilität hinsichtlich der menschlichen Ressourcen zu erkennen. Die Selbstversorgung ist nur der Modellfall des Eigensinns. Dieser kann sich neben Garten, Land und Tier auch an einem Hof, einem Haus, einem Trecker, einer Nachbarschaft, einem Gewässer, an Werkzeugen, Musikinstrumenten oder an Sammlungsgut entfalten, wenn diese Elemente fortlaufend angeeignet werden. Sogar der eigene Körper kann aus dieser Perspektive eine Ressource sein. Entscheidend ist nicht die Bedeutung für die Ernährung oder die empfundene Begeisterung, sondern die Beziehungsqualität, die von Zeitstruktur, Gebrauch, Pflege, Planung und Optimierung geprägt ist. Da die Ressourcen sehr verschieden sind, fallen wiederum die einzelnen Systeme sehr verschieden aus. Auch die jeweiligen Menschen, die in Auseinandersetzung mit einer Ressource ihr Können, ihr Urteilsvermögen, ihren Witz und ihre Ideen entwickeln, unterscheiden sich deutlich und man hat den Eindruck, dass ihre Individualität nicht aus einem ideologischen Individualismus erwächst, sondern einfach daraus, dass sie je spezifische Dinge tun. Unter den Befragten dieses Jahres waren aber nicht nur Sammler, Tierzüchter, Angler, Selbstversorger oder mutige Bauherren, die alte Gebäude erhalten. Immer wieder stießen wir auf Menschen, die mit Ideen und Initiativen einen beachtlichen Wirkungsradius erlangten. Viele von ihnen kamen nach einer städtischen Sozialisation aufs Land. Das ist kein neues Phänomen: Gerade das Oderbruch nimmt immer wieder Menschen auf, die sich in den Städten nicht wohlfühlen. Der Eigensinn dieser Menschen entfaltet sich weniger in Auseinandersetzung mit einer Ressource, sondern eher im Spannungsfeld von Konflikt, Rückzug und Engagement, hat also von vornherein eine soziale Dimension. Diese Menschen spielen für die Frage, ob sich ländlicher Eigensinn über den persönlichen Horizont des Einzelnen hinaus entfalten kann, eine sehr wichtige Rolle. Für Verwaltungen sind sie eine Herausforderung, für die Nachbarn oft auch – aber wenn es gelingt, ihre Energie in eine gemeinschaftliche Interaktion zu überführen, ist es in der Regel sehr zum Vorteil der ländlichen Gesellschaften. Über einen Kamm scheren lassen sich diese Menschen freilich nicht. Aber es fällt auf, dass sie in der Lage sind, sich und andere zu mobilisieren und diese Aktivität wiederum nicht aus der Logik eines gesellschaftlichen Teilsystems entwickeln. Sie kommen nicht in erster Linie als Geschäftsleute, Politiker oder Sozialmanager daher, sie stellen sich vielmehr in die Mitte und machen Vorschläge oder kritisieren etwas. Diese Aktivität kann auf dem Land eine andere Wirkung entfalten als in den Städten. Eine Tauschgemeinschaft mit eigenen Regeln, eine Bürgerinitiative, eine freie Schule, eine Safranproduktion oder ein immer wieder neues Gedenken an die Toten des Zweiten Weltkrieges – es sind sehr unterschiedliche Gründe, die diese Menschen antreiben. Aber sie zwingen die anderen zur Reaktion, stellen Routinen infrage und erneuern dadurch das Zusammenleben aller. Das größte utopische Potenzial ist deshalb dort zu erwarten, wo diese beiden Spielarten aufeinanderstoßen: die Bewirtschaftung der Ressource als subsistenzwirtschaftliche Lebensform und die soziale Provokation der eingeübten Spieregeln. Gelingt es, beides zusammenzuführen, entsteht kollektiver Eigensinn. Dieser ist auf jeden Fall eine große Organisationsleistung und braucht Spielregeln und Spielanreize. Gelingt ein solches Spiel, entsteht eigensinniger Gemeinsinn. Man findet ihn in manchen Dörfern und bei siedlungsübergreifenden Formen des Tauschs oder der Kooperation. Die moderne Mobilität, zunächst einer der wichtigsten Verursacher der Zerstörung der dörflichen Selbstorganisation, ermöglicht dabei in nie dagewesenem Maße die regionale Interaktion. Sind diese Beobachtungen von Bedeutung? Haben die eigensinnigen Praxen Auswirkungen auf die Regionalentwicklung des Oderbruchs im Besonderen und die der ländlichen Räume im Allgemeinen? Diese Fragen kann man nicht pauschal bejahen. Zunächst hängt ihre Beantwortung davon ab, ob man sie überhaupt ernst nehmen will. Das fällt nicht jedem leicht, denn es ist ja wahr: Die kleinteilige Selbstversorgerwirtschaft entspricht selten den ästhetischen Vorstellungen des idealen Bauernhofs, sie ist nicht auf Repräsentation und schon gar nicht auf Idylle angelegt. Die Sammelwut mancher Heimatstuben findet nur selten den Weg zu kuratorischem Glanz, sie mag auf Außenstehende schrullig wirken. Die zarten wirtschaftlichen Erwerbsansätze können den Gewinnerwartungen der Gegenwart nicht entsprechen. Und eigensinnige soziale Initiativen machen von außen vielleicht einen querulantischen Eindruck, denn sie bedienen sich eben nicht der gefälligen Sprache der politischen Partizipationsrhetorik. Der Eigensinn wartet nicht auf die Anerkennung des Staates. Ein Begriff wie „Ehrenamt“ gleitet an ihm ab, denn man will für sein Tun nicht geehrt werden – man macht es, weil man es selbst so und nicht anders will. Entscheidet man sich aber nun, diese Menschen und ihre Tätigkeit ernst zu nehmen, ist es geboten, sich den Kontext anzuschauen, in dem all das heute stattfindet, was in diesem Buch berichtet wird. Dieser Kontext wird von der urbanen Gesellschaft gebildet. Immer mehr Menschen leben in den Ballungsräumen und werden dort mit allem, was sie zum Leben brauchen, versorgt. Wir werden an die globalen Stoff-, Energie- und Datenströme angeschlossen, denen jede Ressourcenbeziehung fremd ist. Die Mobilisierung aller Güter und Informationen schließt eine Bindung, wie wir sie in den Berichten dieses Buches finden, aus. Die Logiken des gesellschaftlichen Metabolismus sind von der Warenlogik bestimmt und werden von Großdiskursen flankiert, die das zerstörerische Moment dieser Weltbeziehung nicht wahrhaben wollen und deshalb immer steilere politische Maßnahmen präferieren. Ein Sog, dem die Wissenschaften und Medien immer mehr erliegen. Die Öffentlichkeit, als habe sie ein Bewusstsein von dieser Ohnmacht, nimmt die Ideologien und kollektiven Selbstentlastungen umso bereitwilliger auf und spielt sie an die Menschen als konsumtives und staatsbürgerliches Erziehungsprogramm zurück. Die menschliche Erfahrung dagegen, sinnlich gegründet und reflektiert, wird in einer solchen Dynamik lästig. Aus ihr könnten sich Einwände, Abwägungen oder Zweifel an den einmal definierten Rettungsstrategien ergeben. Insofern hat die Abwertung der eigensinnigen ländlichen Praxen vielleicht sogar ihren systemischen Sinn: Sie stören den immer lauter werdenden Alarm unserer sich selbst verbrauchenden Welt. Eigensinn, so stellten wir weiter oben fest, hat kein missionarisches Moment. Wenn es Menschen gelingt, eigene Ressourcen aufzuschließen und miteinander ein eigenes gesellschaftliches Spiel zu stiften, das nach selbst gewählten Regeln funktioniert, ist dies für die Beteiligten nicht nur auskömmlich, es bleibt auch kaum die Zeit, den selbst gestalteten Teil der Welt zu überschreiten. Verantwortung übernimmt man für das, was man zur Hand hat. Dass die großen und kleinen Verhängnisse der Gegenwart nicht immer in dieser Beschränkung zu lösen sind, mag wohl sein. Aber haben nicht viele dieser Verhängnisse ihren Ursprung gerade im Fehlen solcher eigensinnigen Lebensmodelle? Sind diese nicht der Humus, in dem friedliche, bescheidene, sich selbst beschränkende Praxen gedeihen, in denen repariert wird, in denen aus Mangel Reichtum und aus Konflikten Entwicklung wird? Wir danken den Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern dieses Jahres für ihre Bereitschaft, uns Einblick in ihre Schicksale, ihre Lösungen und Nöte zu geben.
| Erscheinungsdatum | 17.01.2022 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Aufland Werkstattbuch ; 6 |
| Zusatzinfo | Porträts und weitere Aufnahmen zu den Gesprächspartner sowie Fotoessays zu ausgewählten Personen in Schwarzweiß. Die Aufnahmen sind von Michael Anker und Stefan Schick. |
| Verlagsort | Croustiller |
| Sprache | deutsch |
| Maße | 165 x 235 mm |
| Gewicht | 665 g |
| Themenwelt | Literatur ► Essays / Feuilleton |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Schlagworte | Eigensinn • Oderbruch • Oderbruchmuseum • Regionalentwicklung |
| ISBN-10 | 3-944249-32-1 / 3944249321 |
| ISBN-13 | 978-3-944249-32-2 / 9783944249322 |
| Zustand | Neuware |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich