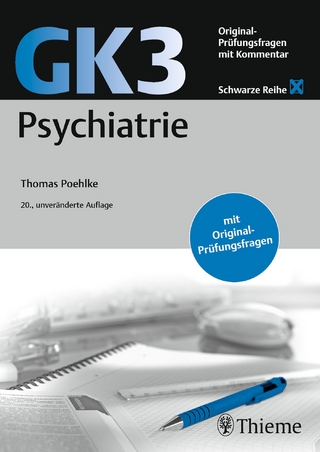Die Behandlung der Opfer
Klett-Cotta (Verlag)
978-3-608-89107-2 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Die oft schwer traumatisierten Flüchtlinge werden bei uns grob vernachlässigt, nicht selten sogar durch Bürokratie und unsere Ignoranz retraumatisiert. Klaus Ottomeyer hat Behandlungsstandards entwickelt, die das psychotherapeutisch und zwischenmenschlich Nötige praxisnah formulieren.
Viele Flüchtlinge werden bei uns ein zweites Mal misshandelt.
Die meist schwer traumatisierten Flüchtlinge werden bei uns grob vernachlässigt, nicht selten sogar durch Bürokratie und unsere Ignoranz retraumatisiert. Klaus Ottomeyer hat Behandlungsstandards entwickelt, die das psychotherapeutisch und zwischenmenschlich Nötige praxisnah formulieren.Auf der Basis umfangreicher Erfahrungen mit diesen Klienten hat Klaus Ottomeyer Behandlungsstandards entwickelt, die das psychotherapeutisch und zwischenmenschlich Nötige praxisnah formulieren.
Der Band bietet:
- erschütternde Informationen über den Umgang mit Asylsuchenden.
- Konkrete Beispiele und Vermittlung von Behandlungsstandards
Ein Thema mit Öffentlichkeitsrelevanz: Das Buch provoziert und bezieht eindeutig Stellung.
ZIELGRUPPE:
- Traumatherapeuten
- Psychotherapeuten aller Schulen
- beratende Psychologen
- Sozialarbeiter
- ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingsbetreuung
Klaus Ottomeyer, Dr., Professor für Sozialpsychologie an der Universität Klagenfurt, praktisch tätig als Psychotraumatologe;Er ist Vorstand des Forschungs- und Beratungszentrums für Traumaopfer »Aspis«.
http://www.newbooks-services.de/CustomerLiterature/Texts/2/9783608891072_TOC_001.pdfInhalt
Vorwort: Luise Reddemann 7
Wozu dieses Buch? 9
1. Einführung: Traumatherapie unter günstigen Umständen 14 Faribas Geschichte 14
Andreas Geschichte 26
Einige Gedanken und Erläuterungen 30
2. Therapie mit Flüchtlingen – Erschwernisse und Schikanen 39
Die Geschichte von HerrnKadir 39
Magomeds Geschichte 46
Die Geschichte von HerrnBisultanov 56
Helfer, die »im Dreieck springen«. Gegenübertragung und zwei EgoStates 64
Victim, Survivor und Trickster. Die notwendige Differenzierung der Wahrnehmung 72
3. Abwehr des Traumas und Verfolgung der Opfer 77
Masters of Denial 77
Der psychotische Kosmos 87
Der Neid 91
Das Gewissen 95 Die Neunmalklugen 99
Gesichter, Kinder, Augen 104 Sadismus und Autoritarismus 110
4. Ein Europa der Menschenjagden? 119
5. Begegnung mit Kinderüberlebenden des Nazi-Terrors.135 Die Geschichte von FrauOgris 135
Die Geschichte von FrauSeebacher 152 Knoblauch, Rotkäppchen und ein Sommer 159
6. Die Schatten der Schuld – an den Grenzen der Psychotherapie 166
7. Versöhnung, Vergebung und Behandlung der Opfer 182
Zur Funktionvon Vergebungin der Therapie 182
Versuch eines Dialogs mit kirchlichen Tätern. Ein Gespräch mit Pfarrer Jürgen Öllinger 192
8. Gebrochenes Selbst – zerbrechende Welt. Trauma, Identität und Gesellschaft 199
9. Anhang: Was wirkt, was hilft? 223
Danksagung 238
Literatur 240
»Dies ist ein besonderes Buch in der mittlerweile schon unübersichtlich werdenden Vielzahl traumatherapeutischer Publikationen ... Es geht hier um Flüchtlinge, Asylsuchende und hochbetagte Opfer des NS-Regimes.«
Erhard Wedekind, Systeme, 2/2011
»Auch für Nicht-TherapeutInnen wertvoll, weil es Erklärungen liefert für Phänomene, die viele in der Flüchtlingsarbeit auch abseits psychotherapeutischer Arbeit kennen, sei es die Verführung zu narzisstischen Helferphantasien, die ewige Gratwanderung zwischen Abgrenzung und Engagement oder das Ausblenden der TäterInnenseite von KlientInnen. PsychotherapeutInnen hingegen könnten die Erfahrungen und aufgeworfenen Fragen eines erfahrenen Kollegen interessieren, insbesondere hinsichtlich neuer Therapiemethoden wie EMDR und EFT.«
Marion Kremla, Asyl aktuell, 3/2011
»Klaus Ottomeyers Buch "Die Behandlung der Opfer" ist ein hervorragendes Fachbuch über Psychotherapie, das aufgrund umfassender Erklärungen auch für Laien sehr gut lesbar ist.«
Bartosz Bzowski, ahs aktuell, Oktober 2011
»Dieses Fachbuch empfiehlt sich sehr für alle Personen, die im beruflichen Kontext mit den Themen Trauma und Flucht bzw. Trauma und politische Gewalt zu tun haben. Nicht nur „EinsteigerInnen“, sondern auch erfahrene (Trauma-)TherapeutInnen und SozialarbeiterInnen werden dieses Fachbuch mit großem Gewinn lesen können. Darüber hinaus ist dem Buch aufgrund seiner menschenrechtlichen und gesellschaftlichen Relevanz auch in anderen Leserkreisen eine sehr weite Verbreitung zu wünschen.«
Nicolas Grießmeier, socialnet.de, 23.04.2012
»Klaus Ottomeyer ist Traumatherapeut und Professor für Sozialpsychologie an der Universität Klagenfurt, der Landeshauptstadt von Kärnten. In seine Praxis kommen viele Menschen, die durch Erfahrungen von Krieg und politischer Verfolgung schwer traumatisiert sind. Er beklagt, dass die Gesellschaft sich gegenüber den Problemen dieser Menschen verschließt. Einerseits sind psychische Erkrankungen und Traumata immer weniger tabuisiert. Doch andererseits bestehen in der Gesellschaft Vorurteile gegen Asylsuchende und Kriegsflüchtlinge, und den Einheimischen fehlt oft das Verständnis für ihre Notlage... Ottomeyer schildert einzelne Beispiele aus seiner Arbeit, um die breite Öffentlichkeit für die Problematik zu sensibilisieren und ein besseres Verständnis für die Nöte der Flüchtlinge zu erwecken. Er schildert einzelne Methoden der Traumatherapie im Allgemeinen und der Behandlung von kriegs- und gewaltbedingten Traumata im Besonderen. Die Europäische Union, die sich gerne als Anwalt von Freiheit und Menschenrechten sieht, verursacht durch ihre unmenschliche Politik der geschlossenen Grenzen eine Verschlimmerung des Leides... Klaus Ottomeyers Buch „Die Behandlung der Opfer“ ist ein hervorragendes Fachbuch über Psychotherapie, das aufgrund umfassender Erklärungen auch für Laien sehr gut lesbar ist. Es ist aber auch ein Plädoyer für eine offene Gesellschaft, ein Aufruf zur Toleranz und zum Verständnis für die Notlagen von Traumatisierten. Das Buch ist nicht nur für Psychologen als Lektüre zu empfehlen, sondern auch und vor allem für alle Multiplikatoren, die in Flüchtlingsberatungsstellen arbeiten.«
Bartosz Bzowski, www.migrapolis-deutschland.de, 19.05.2011
Vorwort Das Anteilnehmen an extrem belastenden Erfahrungen hat in den letzten Jahren zugenommen, und das ist erfreulich. Das Bedürfnis, Schlimmes von sich fernzuhalten, um davon nicht »angesteckt« zu werden, ist ja verständlich. Denn vieles spricht inzwischen dafür, dass die meisten Menschen gar nicht anders können, als das Leiden anderer auch mitzufühlen. In der Beschäftigung mit traumatischen Lebenserfahrungen und deren Folgen scheint es jedoch eine unbewusste Hierarchie im öffentlichen Diskurs zu geben. Zunächst stoßen Naturkatastrophen und deren Folgen auf breites öffentliches Interesse, danach kommen, zumal in letzter Zeit, die Opfer von Gewalt und sexueller Gewalt in der Familie und im familiären Umfeld, siehe im Frühjahr 2010 die Anteilnahme der Öffentlichkeit an den Folgen von Traumatisierungen von Kindern in Schulen, Heimen etc. Doch wer weiß, auch unter Fachleuten, um das Grauen, das Menschen, die als Asylsuchende oder als hochbetagte Opfer des NS-Terrors zu uns kommen, erlitten haben? Wenn man bedenkt, dass Terrence des Prés wichtiges Buch »Der Überlebende – Anatomie der Todeslager«, das auf Englisch 1976 erschien, auf Deutsch erst im Jahr 2008 herauskam, so kommt man nicht umhin, eine Scheu und Vermeidungstendenzen im Umgang mit kollektiv zugefügtem Leid zu vermuten. Vielleicht weil die Opfer von staatlichem und politischem Terror uns an unsere Geschichte als Tätervolk erinnern? Umso wichtiger erscheint es mir, dass Klaus Ottomeyer und sein Team bei Aspis in Klagenfurt sich der Opfer staatlicher und politischer Gewalt annehmen, so wie es einige ähnlich ausgerichtete Beratungsstellen in Deutschland ebenfalls tun. Die Zahl dieser engagierten Kolleginnen und Kollegen ist nicht groß im Vergleich mit den vielen, die sich heute um Psychotraumata kümmern. Es könnte allerdings auch ihnen widerfahren, dass ein Mensch, der Opfer von Krieg, Vertreibung und Folter ist, in die Praxis kommt. Und dann werden sie sich vor die Herausforderung gestellt sehen, dass ihr Handwerkszeug zum Umgang mit den speziellen Traumafolgen bei Weitem nicht ausreicht. Das Buch von Klaus Ottomeyer fordert uns heraus, uns mit der Geschichte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert genauer zu befassen und zur Kenntnis zu nehmen, dass nicht weit entfernt von uns Menschen gequält und gefoltert werden. Klaus Ottomeyer zeigt, wie er und sein Team mit diesen Menschen arbeiten. Es wird deutlich, dass vieles gebraucht wird, vor allem aber mitfühlende Menschlichkeit und ein weit über das übliche professionelle Engagement hinausgehender Einsatz. Die Fallgeschichten in Klaus Ottomeyers Buch werden wohl kaum jemand kalt lassen. Ich habe mich immer wieder bei der Lektüre geschämt, eine Europäerin zu sein und Teil eines Systems, das alles tut, um Menschen mit diesen und ähnlichen Geschichten nicht die notwendige Fürsorge angedeihen zu lassen. Mit breitem psychoanalytischem Hintergrund und tiefem Verständnis für seine Patientinnen und Patienten gelingt es Klaus Ottomeyer, die Leserin und den Leser auf eine Reise in die innere und äußere Welt der Opfer mitzunehmen. Von ihm ist zu lernen, wie man den Opfern begegnen kann: als Mensch und als professionell handelnde Therapeutin. Das Buch vermittelt sowohl tiefenhermeneutisches wie sozialpsychologisches Wissen und Verstehen und zeigt, wie man dieses Wissen praktisch und kreativ umsetzen kann. Ich wünsche diesem Buch viele Leserinnen und Leser. Denn seine Lektüre hilft, schwer traumatisierten Menschen mit weit mehr als Technik zu begegnen. Luise Reddemann Wozu dieses Buch? Der Titel des vorliegenden Buches »Die Behandlung der Opfer« klingt zunächst mehrdeutig oder vielleicht auch anmaßend. Aber seine Mehrdeutigkeit ermöglicht es mir zu erklären, worum es mir geht. Es geht erstens darum zu zeigen, dass es möglich ist, Menschen, die traumatisiert sind, die großen Schrecken und tiefe Verzweiflung erlebt haben, mit den Mitteln der Psychotherapie zu behandeln; und dass es mittlerweile erprobte Wege und handwerkliche Mittel der Traumatherapie gibt, die zu kennen und in verständlicher Form weiterzugeben, Sinn macht. Obwohl es eine empfohlene Abfolge der therapeutischen Schritte und bestimmte Techniken gibt, darf man die Patienten und Patientinnen nie schematisch behandeln, sondern muss für jeden und jede »die Therapie neu erfinden«. Deshalb erzähle ich vor allem Geschichten von Menschen. Ein therapeutischer Pessimismus in der Behandlung ist ebenso unangebracht wie die Vorstellung, allen Hilfe suchenden Patientinnen und Patienten helfen zu können oder zu müssen – der »furor sanandi«, wie Freud es nannte. Ich werde zumindest eine Geschichte erzählen, in der mein furor sanandi vorkommt und wahrscheinlich nichts Gutes bewirkt hat. Es geht im Buch zweitens darum zu zeigen, wie die Gesellschaft (und das sind auch wir selbst) die Opfer von Gewalt und ihre Traumata behandelt: nämlich oft genug respektlos, entwertend, schikanierend und manchmal sogar sadistisch – wobei Politiker hier die Funktion von Schleusenwärtern oder Schleusenöffnern haben. Das beeinflusst natürlich die Heilung und Erholung der Trauma-Opfer – bis hin zu der Erfahrung, dass die nachträgliche schlechte Behandlung und Ignoranz gegenüber den Opfern für sie eigentlich die schlimmste Traumatisierung darstellt. Darüber hinaus beeinträchtigt die schlechte Behandlung der Opfer durch die Gesellschaft und die Politik unser aller Lebensqualität. Traumatisierung ist – worauf Luise Reddemann (2008) hingewiesen hat – vor allem ein extremer Angriff auf die menschliche Würde. Wenn wir Ignoranz und Verhöhnung gegenüber einer besonders verletzlichen und in ihrer Würde bedrohten Menschengruppe – zum Beispiel gegenüber traumatisierten Flüchtlingen – zulassen, wird dies über kurz oder lang auf uns zurückschlagen. An den traumatisierten Asylsuchenden, die nicht mehr und nicht weniger als ein Menschenrecht in Anspruch nehmen, welches in allen demokratischen Gesellschaften verankert ist, wird seit geraumer Zeit die Entwertung und Beschimpfung ganzer Menschengruppen eingeübt, die als verletzlich, ökonomisch »überzählig« oder ganz einfach als faul gelten. Dabei mag die Beschimpfung der Opfer, an denen »ein Exempel statuiert wird«, gegen die Angst helfen, selbst einmal zu den Invaliden und Opfern des gesellschaftlichen Prozesses zu gehören. Es zeichnet sich ab, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise, die im Herbst 2008 begonnen hat, die Jagdbereitschaft der (noch) Integrierten weiter verstärkt. Die politischen Profiteure und Demagogen sind schon dabei, das Feuer anzufachen. Die Traumadiskussion, die wir in den Gesundheitswissenschaften seit etwa 25 Jahren und in den westlichen Medien seit etwa 15 Jahren führen, war manchmal unscharf und mit einer inflationären Verwendung des Traumabegriffs verbunden. Sie hatte aber mit der Anerkennung von seelischem Leid, das durch gesellschaftliche Gewalt (und manchmal auch durch die Gewalt der Natur) hervorgerufen wird, einen wichtigen »civilizing influence«, der immer wieder verloren zu gehen droht. Die Tendenzen zu einem erneuten Vergessen und zur Verachtung der Opfer sind genauso stark. Es wird auch erfolgreich gesplittet: Westeuropäische Opfer des Tsunami oder von anderen »Großschadensereignissen« erhalten (zu Recht) jegliche Hilfe nach dem neuesten Stand der Trauma-Wissenschaft – und zwar ohne Wartezeiten. Gleichzeitig werden traumatisierte Menschen aus Asien oder Afrika, die dem Tode nahe waren, möglichst »ohne Ansehen der Person« gleich wieder zurückgeschickt, wenn sie zum Beispiel aus Somalia oder Darfur kommend auf Lampedusa, diesseits der europäischen Grenze, gelandet sind. Wenn sie es schaffen, sich irgendwie auf der europäischen Rettungsinsel festzukrallen, gelten sie als »Wirtschaftsflüchtlinge« oder Simulanten. Auch Millionen von Flüchtlingen aus dem Irak haben sich die – vor allem um sich selbst besorgten – Europäer erfolgreich vom Leib gehalten. Es geht also drittens bei der Rede von der »Behandlung der Opfer« um einen wünschenswerten Umgang mit Menschen jeglicher Herkunft, der auf die Erhaltung oder Förderung von Selbstachtung und Würde gerichtet ist. Man sollte Menschen immer mit Respekt behandeln. Es handelt sich hier weniger um ein trainierbares Programm als um ein Prinzip der Begegnung. Ich wähle absichtlich dieses etwas altertümliche Wort. Jeder, der mit Traumatisierten arbeitet – egal ob professionell oder ehrenamtlich –, weiß, wie sehr sich die Verletzung der Würde des Opfers auch auf der Seite des Helfers/der Helferin niederschlägt. Das kann bis zu einer dauerhaften Niedergeschlagenheit beim Helfer oder in seinem Team führen. Unsere Selbstachtung und unser Selbstbewusstsein als Individuen hängen zusammen. »Das Tun des Einen ist das Tun des Anderen«, heißt es bei Hegel über die Entwicklung unseres Selbstbewusstseins. Natürlich muss man manchmal die Augen schließen, ganz woanders hinschauen und Urlaub machen. Aber dann sollte man wenigstens für einen Moment wissen, dass man wegschaut. Raoul Hilberg hat sein zusammenfassendes Buch über seine le benslange Holocaust-Forschung »Opfer – Täter – Zuschauer« (1992) genannt. Diese drei Gruppen bilden immer ein System, dem wir kaum entrinnen können, und zwar auf der unmittelbar-lokalen Ebene, in der wir arbeiten und leben, ebenso wie auf der globalen Ebene, wo wir als Zuschauer via TV an den neuesten Kriegen und Flüchtlingsdramen, vielleicht sogar am nächsten Genozid teilhaben können. Ich habe das zweifelhafte Glück, als Wissenschaftler und Psychotherapeut seit 27 Jahren im österreichischen Bundesland Kärnten zu arbeiten und zu leben, wo es in Bezug auf den Umgang mit den Opfern organisierter Gewalt, mit den Opfern des Nazi-Terrors und mit traumatisierten Flüchtlingen zu einer »Lockerung des moralischen Korsetts« und zu Grobheiten und Entwürdigungen gekommen ist, die für andere westliche Demokratien (noch) unüblich sind. Die politische Kultur im Nachbarland Italien ist seit 2008 allerdings dabei, auf diesem Feld rapide aufzuholen. In Frankreich zeugen Äußerungen und Abschiebungserlasse des amtierenden Präsidenten von der neuen Grobheit gegenüber Menschen, die fremd und hilfsbedürftig sind. Aber möglicherweise waren Kärnten, Österreich, Frankreich und Italien nur Vorreiter in Bezug auf eine neue, »unbefangene« politische Kultur in Europa, die es mit den Menschenrechten für Minderheiten und mit der Genfer Konvention nicht mehr so genau nimmt. Auch wenn die Aufkündigung des Schutzes für traumatisierte Menschen und Angehörige von Minderheiten zunächst nur ein paar Dutzend, ein paar Hundert oder Tausend Menschen trifft, muss man sich doch so bald wie möglich und solange es noch geht, dagegenstellen. Wie gesagt, nicht nur aus Gründen der Moral, sondern auch zur Erhaltung der Lebensqualität in einem freundlichen, friedlichen Europa. Luise Reddemann bezieht sich in ihrem Buch über die Würde in der Psychotherapie (2008) auf den Philosophen Richard Rorty (2003). Sie teilt mit ihm die Ansicht, dass eine Kultur der Menschenrechte weniger aus komplizierten moralphilosophischen Diskussionen, Wissensbeständen und Herleitungen entsteht, sondern auf relativ einfache Weise durch das »Hören trauriger und rührseliger Geschichten« (Rorty), welche an die menschliche Einfühlungsfähigkeit appellieren und sie stärken. Diese »Schule der Empfindsamkeit« wirkt der Einteilung der Menschen in verschiedene Sorten und Güteklassen entgegen. Als ich das las, wusste ich plötzlich genau, wozu ich dieses Buch schreibe und warum ich es auf diese Weise schreibe. Man müsste nur das Wort »rührselig« (wahrscheinlich die Folge einer nicht ganz richtigen Übersetzung ins Deutsche) durch das Wort »anrührend« ersetzen, denn »rührselig« wird bei uns mit Kitsch assoziiert. Ich habe versucht, Kitsch zu vermeiden. Der Rückgriff auf erlebte Geschichten scheint mir auch sinnvoll, weil wir in der Psychotraumatologie (also der Wissenschaft vom extremen seelischen Leid, vom Schrecken, von der Verzweiflung und unseren Möglichkeiten der Linderung und Abhilfe) seit geraumer Zeit wieder einer Tendenz begegnen, die Geschichten der Betroffenen hinter Gesetzmäßigkeiten, Hirnfunktionen, Messwerten und Zahlenkolonnen (die natürlich ihren Sinn haben) verschwinden zu lassen. Die Bewegtheit (»Angerührtheit«) der ForscherInnen und TherapeutInnen angesichts des traumatischen Schreckens, für die es in unserer Fachsprache den Begriff der »Gegenübertragung« gibt, wird im öffentlichen Raum zugunsten einer quasi-medizinischen Objektivität wieder schamhaft verborgen. In der Supervision und Eigentherapie der HelferInnen wird sie freilich umso intensiver behandelt. Ohne Selbstreflexion ist im Umgang mit Trauma (wie auch mit anderen Formen seelischen Leidens) nichts zu lernen. Ich weiß, dass es riskant werden kann und der wissenschaftlichen Karriere nicht zuträglich ist, wenn man zu viel vom Zweifel an sich selbst und vom Nachdenken über sich selbst in der Öffentlichkeit zeigt. Aber als einer der letzten österreichischen Wissenschafts-Beamten, der sich langsam auf die (derzeit noch) vom Staat garantierte Pension zubewegt, riskiere ich vergleichsweise gar nichts. Ganz grob gesagt ist das Buch so aufgebaut, dass die in die reflektierten Fallgeschichten hineinspielenden gesellschaftlichen Bedingungen ein immer größeres, manchmal »störendes« Gewicht bekommen, sodass ich gegen Ende mehr als Sozialpsychologe und politischer Psychologe denn als Psychotherapeut argumentiere. Ich habe die Fallgeschichten anonymisiert, damit die PatienInnen nicht erkennbar sind. Die Mehrheit der PatientInnen habe ich noch um ihr Einverständnis zu den aufgeschriebenen Geschichten bitten können. Andere sind verzogen oder verstorben. Luise Reddemann hat mir noch einen Rat gegeben: Ich solle die Leser Innen darauf hinweisen, dass die Fallgeschichten teilweise belastend sind und dass es gut ist, wenn sie mit Erholungspausen dazwischen gelesen werden. Sie hat sicherlich recht. Mir war das nicht so präsent, weil für mich selbst die Verschriftlichung meiner Erfahrungen mit TraumapatientInnen aus den letzten 20 Jahren eher eine emotionale Entlastung bedeutet hat und ich beim Schreiben einen Teil der Belastung loswerde. 1. Einführung: Traumatherapie untergünstigen Umständen Am Beginn sollen zwei Geschichten stehen, welche einführend zeigen, was ein Trauma ist und wie man traumatisierte Menschen nach dem (mir zur Verfügung stehenden) Stand des Fachwissens psychotherapeutisch behandeln kann. Anders als in den meisten der später dargestellten Fallgeschichten waren hier die äußeren Umstände für die Psychotherapie eher günstig. Es gab kaum eine Einmischung und Behinderung von außen: durch Behörden und durch die fremdenfeindliche Politik im Land. Die Belastungen und der Ärger, die man als Therapeut oft empfindet, wenn Gewaltopfer von ihrer Umgebung weiterhin ungerecht behandelt werden, und die in nachfolgenden Kapiteln des Buches eine Rolle spielen, hielten sich in Grenzen. Auch die eigene lebensgeschichtliche Verstrickung des Therapeuten, die manchmal die Therapie erschweren kann, war nicht blockierend. Und es handelt sich um Traumatisierungen, die für die Patientinnen mit einer einmaligen seelischen Verletzung verbunden und/oder an zeitlich begrenzte rekonstruierbare Situationen gebunden waren. Ein Trauma dieser Art heißt in der Fachsprache »Typ-I-Trauma«. (Terr 1995) Von Typ-II-Traumata, die – wie zum Beispiel Gefängnis- und Lageraufenthalte – auf lang anhaltenden und wiederholten Traumatisierungen beruhen, wird in nachfolgenden Geschichten die Rede sein. Deswegen kann man in den ersten beiden Darstellungen von »Traumatherapie unter günstigen Umständen« sprechen. Die erste Geschichte handelt von einer afghanischen Frau, die zweite von einer aus Süddeutschland. Faribas Geschichte Fariba kam in unsere Traumaberatungsstelle, weil andere afghanische Frauen uns empfohlen hatten. Sie war verheiratet, etwa Anfang vierzig und wohnte mit ihrem Mann und drei Kindern in einer Flüchtlingspension. Als Übersetzerin unterstützte mich wie schon oft Shanaz, die aus dem Iran stammt und weiß, was ein Flüchtlingsschicksal ist. Da Fariba Tadschikin war und die afghanische Sprache Dari sprach, gab es kaum Probleme. Das persische Farsi und das Dari sind sich sehr ähnlich. Die Afghaninnen mögen Shanaz sehr. Obwohl das eigentlich den strengen Lehrbuchregeln für die Rolle der Übersetzerin in der Psychotherapie widerspricht, kommt Shanaz mit ihrer herzlichen Art manchmal in die Rolle einer Co-Therapeutin. Ich kann mit ihr gut arbeiten. Faribas Mann und die drei Kinder glaubten, Fariba sei in der letzten Zeit verrückt geworden. Im unmittelbaren Kontakt sehr offen und freundlich, erzählte sie mir von ihren merkwürdigen Erlebnissen und Verhaltensweisen. Auf dem Balkon des Zimmers, in dem sie zu fünft wohnten, sah sie des Öfteren Gesichter und Männer, die von draußen hereinwollten. Manchmal war die sich bewegende Wäsche der äußere Auslöser, manchmal gar nichts. Sie fürchtete, dass durch die Tür zum Flur Männer kommen könnten, und musste die Tür immer wieder versperren – was für die Kinder, die sich hinaus, und wieder hereinbewegen wollten, ein Problem war. Manchmal glaubte sie auch, dass gefährliche Verbrecher aus dem TV-Gerät kommen könnten, um ihrer Familie etwas anzutun. Am meisten verwirrt waren ihr Mann und ihre Kinder darüber, dass Fariba nicht nur schlecht einschlafen konnte, sondern des Nachts aufstand und im Zimmer schlafwandelte. Die zuerst genannten Merkwürdigkeiten konnten gut Traumasymptome sein; vom Schlafwandeln als Traumasymptom hatte ich allerdings noch nie gehört. Fariba berichtete noch von einem Konflikt, den sie kürzlich im Zusammenhang mit der geplanten Schul-Ski-Woche ihres Sohnes hatte. Obwohl die Lehrerin und andere Eltern sich bemüht hatten, dem Flüchtlingskind den Aufenthalt finanziell zu ermöglichen, und obwohl der Junge sich freute, wollte Fariba ihn nicht fahren lassen. Sie hatte furchtbare Angst, dass er in der Fremde verunglücken könnte. Da ich von anderen Patientinnen wusste, dass eine der Schlepperrouten, auf der die Flüchtlinge aus Afghanistan hinaus und dann quer durch Asien und die ehemaligen Sowjetrepubliken nach Europa gebracht wurden, durch sehr hohe und gefährliche Gebirge führte, fragte ich Fariba vorsichtig, ob sie auf der Flucht Berge, Schnee und Eis als etwas sehr Gefährliches erlebt habe. Sie bejahte die Frage und fügte noch hinzu, dass sie den kleinen Jungen damals abwechselnd mit ihrem Mann getragen habe und dass viele Flüchtlinge auf dem Weg abgestürzt oder erfroren seien. Ich brauchte nicht mehr viel zu interpretieren. Fariba verstand fast von selbst, dass sich die schrecklichen Erinnerungen von damals in ihre Psyche und ihren Körper als (gewissermaßen »zeitlose«) Erfahrungen und Erwartungen eingeprägt oder eingebrannt hatten und dass die alte Angst in neuen Situationen, welche an die traumatische Situation auch nur vage erinnern, wieder aktiviert wird. Die Berge Kärntens sehen nicht so viel anders aus als die Berge in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Usbekistan. Unser Traumagedächtnis hängt mit einem archaischen Automatismus der Amygdala, der »Mandelkernregion« im Gehirn, zusammen, der von den »höheren« und bewussten Gedächtnisfunktionen zunächst abgekoppelt ist (Hinckeldey und Fischer 2002). Man hat die Amygdala mit einem Rauchmelder verglichen. An dieser Stelle unseres Gesprächs konnte ich sinngemäß den Lieblingssatz aller TraumatherapeutInnen einbringen: »Sie sind nicht verrückt oder abnormal, sondern ihre Symptome sind normale Reaktionen auf eine abnormale Situation.« Obwohl schon häufig benutzt, wirkt dieser Satz immer wieder entlastend. So war es auch im Falle von Fariba. Sie konnte den Sohn auf die Ski-Woche mitfahren lassen, er hatte Spaß daran und kam zum Glück ohne Verletzung zurück. Im Kontext der lebensgefährlichen Flucht über die Berge war ein »traumakompensatorisches Schema« (Fischer und Riedesser 2009, S. 395) entstanden, aus dem Fariba in Richtung auf ein Mehr an eigener Beweglichkeit heraustreten konnte, nachdem sie es verstanden hatte. Die Wiedergewinnung von Beweglichkeit ist ein Hauptziel jeder Traumatherapie. Hier wird schon eine elementare Operation sichtbar, die TraumatherapeutInnen eigentlich ständig und manchmal fast wie nebenbei vollziehen: Das »szenische Verstehen« und Komplettieren von alltäglichen Geschichten und Begegnungen, welche die Opfer irritieren und ängstigen, weil ihnen der Zusammenhang zur ursprünglichen traumatischen Situation nicht klar ist. Der wichtigste Autor zur Methode des »szenischen Verstehens« in der Psychoanalyse und in den Kulturwissenschaften ist Alfred Lorenzer (1970, 1974). Die wenigsten wissen, dass er seine Theorie zuerst in der Arbeit mit Traumapatienten entwickelt hat (vgl. Lorenzer 1965). Das Herausfinden und Bearbeiten des hauptsächlichen Traumas war etwas komplizierter, aber auch nicht sehr schwer. Ich ließ mir von Fariba einen kleinen Überblick über ihre Lebensgeschichte, die guten und die schlechten Ereignisse geben. Wer in den letzten Jahrzehnten in Afghanistan gelebt hat oder dort aufgewachsen ist, hat hauptsächlich Krieg und Zerstörung erlebt. Es gibt kaum eine Familie, in der nicht Angehörige von Bomben zerfetzt, entführt oder ermordet wurden. Fariba hatte zumindest etwas Glück gehabt: Sie hatte fürsorgliche Eltern, sie durfte sich ihren Mann selbst aussuchen (der allerdings inzwischen aus ihrer Sicht etwas zu autoritär war), und sie hatte noch das Schulsystem in der Zeit der prosowjetischen Regierung durchlaufen, bei dem es eine fast völlige Gleichberechtigung der Mädchen und Frauen gegeben hatte. Sie konnte arabisch (persisch), etwas lateinisch und sogar kyrillisch schreiben. Auch viele Gegner des Kommunismus sprechen sehr respektvoll vom längst versunkenen afghanischen Bildungssystem in der Zeit vor der Vertreibung der Russen durch die Mudjahedin. Vor allem hatte Fariba in der Schule ihre Liebe zum Malen entdeckt, welche sie später, vor allem nach der Machtübernahme der Taliban im Herbst 1996, verstecken musste, weil Malen und die Malerei etwas Lebensgefährliches darstellte, vor allem für eine Frau. Khaled Hosseini berichtet in seinem realistischen Afghanistan-Roman »Tausend strahlende Sonnen« (2007) von einem Maler, der vor allem Flamingos gemalt hatte. Die Taliban fanden die nackten Beine der Vögel anstößig, schlugen dem Maler öffentlich die Füße blutig und stellten ihn vor die Wahl, entweder die Bilder zu zerstören oder die Flamingos in züchtiger Form darzustellen, woraufhin der Maler allen Flamingos Hosen malte – allerdings, was die Taliban nicht wussten, mit Wasserfarben, damit die Hosen für die Zeit nach den Taliban wieder abwaschbar waren. Auch Fariba hatte ihre Freude an selbst gemalten Bildern irgendwie durch die Ära der Verfolgung gerettet, hatte allerdings seit vielen Jahren nicht mehr mit Zeichenpapier und Pinsel hantiert. Die Familie von Fariba war in verschiedene schwierige Situationen geraten. Das Schlimmste war aber folgende Geschichte gewesen: In der Zeit kurz vor der Machtübernahme durch die Taliban war es in Kabul sehr unsicher, weil verschiedene Milizen um die einzelnen Stadtteile kämpften. Eine paramilitärische Gruppe, sogenannte Pachmanen (Leute aus der Bergregion von Pachman), führte sich als eine Art Schutztruppe für das Stadtviertel auf, in dem Fariba mit ihrer Familie wohnte. In Wirklichkeit waren sie aber auch darauf aus, die Bewohner des Viertels auszuplündern. An einem Abend donnerte es an die Tür des Familienhauses, und als nicht gleich geöffnet wurde, brach eine Bande von Pachmanen die Tür auf und trieb die Familie gewaltsam in das Obergeschoss. Zur Familie gehörten, neben Fariba und ihrem Mann, ihre zwei kleinen Kinder und eine junge Schwägerin, eine Schwester des Mannes. Die Situation muss grauenvoll gewesen sein. Die Pachmanen wollten Geld. Als sie keines bekamen – weil keines im Haus war –, begannen sie Faribas Mann die Beine zu brechen. Fariba selbst musste vor allem die Kinder schützen. Als sich die Männer der Schwägerin näherten, sprang diese aus dem Fenster und und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie starb. Die Pachmanen zogen wieder ab. Ihnen passierte nichts. Sie arrangierten sich später mit den Taliban und wurden ein Teil von ihnen. Der Anführer der Bande wurde einige Jahre später umgebracht, und die Situation wurde für Faribas Familie noch einmal gefährlich, weil die Taliban annahmen, dass Faribas Mann etwas damit zu tun habe. Die Flucht wurde unumgänglich. Nach dieser ersten Erzählung des hauptsächlichen traumatischen Ereignisses war es nicht mehr sehr schwer, den Sinn der meisten Symptome zu verstehen, unter denen Fariba litt. Die Bilder von den Männern, die sie über den Balkon, durch die Tür oder gar aus dem Fernsehgerät kommen sah, waren in der Sprache der Traumadiagnostik »intrusive Symptome«, eindringende, unerwünschte Bilder der Erinnerung an die traumatische Situation, welche in unserem Falle die Patientin als verbrecherische »Eindringlinge« tagsüber und wohl auch nachts im Zusammenhang mit dem Schlafwandeln verfolgten. Zugleich waren sie Symptome der »Hypervigilanz«, der Überwachsamkeit, die für Traumatisierte typisch sind. Die Sache von damals war überhaupt nicht erledigt, quälte Fariba immer noch – so als ob eine (weitgehend unbewusste) Instanz in ihr sagen würde: »Solche Dinge können in unserer Welt jederzeit passieren, Fariba, hüte deine Kinder, sperre alle Türen ab, sei immer wachsam, schreckliche Verbrecherfilme, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, können jederzeit in die Wirklichkeit kommen!« Irgendwie hatte diese Instanz ja sogar recht. Ein gelassenes Leben ohne Wachsamkeit und Angst, vielleicht auch eine Freude über das neue Leben in Österreich, war für Fariba fast nicht mehr möglich. Ähnlich wie bei der Angst vor Bergen und Schnee und um ihren Sohn war es nicht schwer, Fariba diese Zusammenhänge zu erklären. Sie war nicht verrückt. Nachdem wir eine erste Klarheit über Faribas quälende Symptome und ihren Hintergrund hatten, schrieb ich einen psychotherapeutischen »Befundbericht« mit einer entsprechenden Traumadiagnose samt einer Darstellung der traumatisierenden Ereignisse für den sogenannten Unabhängigen Asylsenat. Bei diesem lag damals der Asylantrag von Fariba und ihrem Mann, nachdem er in der ersten Instanz beim Bundesasylamt abgewiesen worden war. Ich verfasse solche Befundberichte grundsätzlich so, dass ein Fachkollege es versteht, dass die Juristen oder Beamten bei den Asylbehörden es verstehen und dass die PatientInnen es in übersetzter Form verstehen. Ich übergebe den Bericht formell der Patientin, die ihn dann weiterleiten kann. (Im Juristendeutsch: Die Patientin bleibt die »Geheimnisherrin«; die Schweigepflicht des Therapeuten bleibt gewahrt.) Mit ihren Symptomen erfüllte Fariba alle Kriterien für die klassische Diagnose Posttraumatische Belastungsstörung: A. Vorliegen eines lebensbedrohlichen Ereignisses, B. Symptome der Intrusion (Überflutung), C. Symptome des Vermeidens, D. Symptome der Übererregung (vgl. Saß u. a. 2003, S. 530 f.). An der Glaubhaftigkeit von Faribas Erzählung (für die Asylbehörden eine wichtige Frage) hatte ich nicht die geringsten Zweifel. Das österreichische Asylgesetz enthält immerhin einen Paragraphen, der traumatisierten Flüchtlingen einen besonderen Schutz zusichert – wenngleich diese Bestimmung in anderen Bestimmungen und in der Behördenpraxis wieder unterlaufen wird. In Faribas Fall hatten wir das Glück, dass die Behörde nicht auf die Idee kam, sozusagen als Gegenstück zu meinem Bericht aus der Psychotherapie, eines jener hanebüchenen und unwissenschaftlichen psychiatrischen Gutachten zur Frage der Traumatisierung anzufordern, die damals in Österreich verbreitet waren und die es teilweise auch heute noch gibt (vgl. Ottomeyer 2006). Traumatherapie hat üblicherweise drei Phasen (die sich überlappen können): Die Phase der Stabilisierung, in der man neben dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung Kraftquellen, sogenannte »Ressourcen«, der Patientin sucht und verstärkt, dann eine Phase, in der das Trauma in einer für die Patientin erträglichen Weise rekonstruiert und in die Lebenserzählung besser eingefügt (»bearbeitet«) wird, und schließlich die Phase der Wiedereingliederung, der Integration der Patientin in ein »normales« Alltags- und Sozialleben, in welchem das Trauma und die Folgesymptome nicht mehr das beherrschende Thema sind. Das Element einer beruhigenden Aufklärung über den Sinn der Traumasymptome (»Normale Reaktionen ...«) gehört an den Beginn der Stabilisierungsphase. Fariba hatte, wie schon deutlich geworden ist, einige Kraftquellen. Das war ihre gute Bildung, das war ihr Humor, das waren ihre festen Freundschaften mit einigen afghanischen Frauen – gemeinsam hatten sie es geschafft, durch einen wohlformulierten Protestbrief dafür zu sorgen, dass es in der Flüchtlingspension nicht nur eine halbe Stunde am Tag warmes Wasser gab. Eine weitere Kraftquelle war die in der Therapie wiederentdeckte Freude am Malen. In der Stabilisierungsphase machen wir meistens einige bekannte Imaginationsübungen, die hauptsächlich von Luise Reddemann stammen. Sie sollten, wenn möglich, mit einer leichten (immer noch kontrollierten) körperlichen Entspannung der Patientin verbunden sein. Eine Übung ist die vom »Inneren Helfer«, das Üben einer Imagination von einer hilfreichen Figur aus Märchen, Literatur, aus momentaner fantasievoller Eingabe, aus dem Film oder aus dem spirituellen Bereich. Eine zweite ist die Übung vom »Sicheren Ort« oder »Wohlfühl-Ort«. Die Patientin wird eingeladen, sich einen Ort vorzustellen, an dem sie sich ganz sicher fühlt. Sie darf so lange die Elemente dieses Ortes in der Vorstellung herumrücken, gestalten, austauschen, bis sie sich wirklich wohl und sicher fühlt (vgl. Reddemann 2001). Das funktioniert (mit Varianten) auch quer durch die Kulturen. Die Anhänger von C. G. Jung würden hier von einem »Archetyp« sprechen. Man darf die mit Entspannung verbundenen Imaginationsübungen mit TraumapatientInnen nicht zu früh machen. Sie können Angst auslösen, wenn die angespannte Aufmerksamkeit nach außen – als subjektiv sinnvolles Traumasymptom – noch gebraucht wird. Es sollten auch die Augen immer offen bleiben, weil sonst intrusive Bilder, »flash backs«, vom Trauma einschießen können. Ein mehrmaliges tieferes Ausatmen (Fischer 2003) kann hilfreich sein. Manchmal müssen wir auf die beliebten Übungen auch ganz verzichten. Fariba gefiel die Übung vom »Sicheren Ort« besonders gut. Da es in meinem Büro immer Malsachen und Zeichenblöcke gibt, lud ich sie ein, den vorgestellten Ort aufzumalen. Sie freute sich, weil sie lange nicht mehr gemalt hatte und das Bild recht gut gelang. Das erste Bild vom »Sicheren Ort« zeigte ein Haus mit einem Garten, in dem drei Kinder mit einem Ball spielten und eine Frau gerade aus der Haustür gekommen ist. Es gibt große Bäume und Vögel, die in den Himmel fliegen. Es ist wichtig, erklärt sie Shanaz und mir, dass man sich Geräusche dazu vorstellt. Vor allem das Rufen der Kinder, die »Modarjan« oder »Mamijan« rufen, die Zärtlichkeitsform für »Mutter« oder »Mami«. Sie rufen das aber nicht, weil sie Hilfe brauchen oder etwas wollen, sondern einfach aus Freude über die Situation. Fast alle Menschen aus islamischen Ländern, mit denen ich bisher gearbeitet habe, können kaum anders, als sich ihren »Sicheren Ort« im Kontakt mit Menschen vorzustellen, die ihnen lieb und wichtig sind. Die Akustik ist oft von Bedeutung. Macht man die Übung mit orientalischen Menschen, so kann man kaum dem Rat von Luise Reddemann folgen, möglichst keine realen Menschen oder Bekannten in den vorgestellten »Sicheren Ort« hereinzuholen, weil diese oft wieder als anstrengend oder enttäuschend erlebt werden könnten. Bei einer iranischen Patientin, die – wegen der politischen Betätigung ihrer Eltern – als Jugendliche mehrere Jahre im Gefängnis gesessen hatte und nun in einer schmutzigen, isolierten Flüchtlingspension auf das Ende des Asylverfahrens wartete, sah der »Sichere Ort« zum Beispiel so aus: Sie befindet sich mit Ehemann und Kind in einer hellen Wohnung mit geöffneten Fenstern mitten in einem belebten und geräuschvollen Stadviertel, das zwar europäisch ist, aber doch gewisse Ähnlichkeiten mit einem beliebten Viertel in Teheran hat. Bei Fariba war klar: Sie brauchte einen »Sicheren Ort«, vor allem auch für ihre Kinder. Ich gab ihr nach unserem ersten Versuch die Malsachen mit nach Hause. In den nächsten Wochen wunderten sich die Kinder erneut über ihre Mutter. Vorher hatten nur sie in der Schule und manchmal zu Hause Bilder gemalt. Jetzt malte die Mutter, und das kleine Familienzimmer war bald voll von ihren Produkten. Einige davon brachte sie mir wieder mit in die Therapie, wo ich sie bewunderte, mich aber jeder tiefenpsychologischen Deutung enthielt. Die Bilder ließ ich farbkopieren und durfte sie für mich behalten. Auf einem sieht man eine Frau, die ein Kind in einer Wiege hütet (wobei das Kind selbst hinter der Wand der Wiege nicht sichtbar ist). Um die zentrale Szene herum gibt es noch einen wolkigen Rahmen, der Abgeschlossenheit und Sicherheit für die beiden vermittelt. Es ist das, was Fariba an jenem furchtbaren Abend für sich und die Kinder, zu denen auch die ihr anvertraute junge Schwägerin zählte, am meisten gefehlt hatte. Nach ein paar Wochen änderten sich die Motive der Bilder. Beeindruckend war besonders ein Bild, auf dem links ein schwarzes Haus und rechts ein schwarzer, teilweise verdorrter oder verbrannter Baum zu sehen sind. Beide stehen aber auf einer Wiese, die ein schönes Grün hat, und vom Betrachter aus führt ein Weg über die Wiese auf eine aufgehende Sonne zu. Wir hatten zuvor über das Traurige und Zurückgelassene gesprochen. Das neue Bild machte auf mich den Eindruck, dass das Traurige nun eingebettet und besser abgegrenzt in einer Welt der Hoffnung und des Lichts war. Vielleicht war es nun Zeit, die traumatische Geschichte tiefergehend zu bearbeiten. Die Sonne ist in Afghanistan wie bei uns ein Symbol der Hoffnung und Wärme. Im Nachhinein könnte man sagen: Es zeigte sich so etwas wie eine erste »Gestaltbildung« um das Trauma herum. »Die traumatische Situation hat eine ›Gestalt‹, einen Umriss und eine Grenze gewonnen. Während der Patient zunächst in der Situation steckt, hat er nun eine gewisse Distanz dazu gewonnen und steht ihr gleichsam gegenüber.« (Reddemann und Fischer 2010, S. 268) Für die sogenannte »Traumaexposition« oder »Traumakonfrontation«, die gemeinsame und dosierte Rekonstruktion der Traumageschichte mit dem Ziel einer besseren Integration und Kontrolle der belastenden Gefühle und Erinnerungsbilder, wählte ich die »Bildschirmtechnik«. Es gibt noch andere Expositionstechniken: vom dosierten »co-narrativen« Erzählen der Ereignisse über das Zeichnen von Bilderfolgen und die anspruchsvolle »Beobachtertechnik« (Reddemann 2004, S. 158 ff.) bis hin zum berühmten »EMDR«, der Technik der gelenkten Augenbewegungen, auf die ich in einem späteren Kapitel eingehe. Wer die Bildschirmtechnik erfunden hat, ist nicht ganz klar, sie scheint in ihren verschiedenen Varianten aber recht wirksam zu ein (vgl. Gurris und Wenk-Ansohn 1997; Sachsse 2004; Reddemann 2004, S. 176 ff.). Auch Gottfried Fischer verwendet sie unter dem Namen »Videoübung« (kombiniert mit Rollenspiel) als Technik des »emotionalen Durcharbeitens« (Reddemann und Fischer 2010, S. 269). Man sitzt mit der Patientin vor einem vorgestellten Bildschirm, der an einer Wand des Arbeitsraumes sein kann, um sich den belastenden »Trauma-Film« – welcher die Patientin im Alltag immer wieder in einer fragmentierten, unkontrollierten Form überfällt – diesmal gemeinsam in einer kontrollierten und gegebenenfalls auch poetisch umgestalteten Form anzuschauen. Dazu haben wir eine »magische Fernbedienung«, mit der man den Film anhalten, vor- und zurückspulen, verlangsamen, farblich verändern usw. und auch nach einem neuen Skript ablaufen lassen kann. Man kann sich die magische Fernbedienung in der Hand der Patientin gemeinsam vorstellen oder auch durch einen Gegenstand symbolisieren. Man sollte die Filmerzählung mit einer noch sicheren Situation, vor dem Einbruch des Bedrohlichen, beginnen, und die Protagonistin, die Hauptdarstellerin sollte von sich zunächst in der dritten Person reden. Wenn es aufregend wird, kippen die meisten Patientinnen in die erste Person; es kann dann beruhigend oder distanzierend sein, auf Anregung des Therapeuten wieder in die dritte Person zurückzuwechseln. Man kann auch Pausen machen, in denen ein Schluck Tee oder Wasser getrunken wird. Und man sollte vorher einen »Sicheren Ort« in der Vorstellung gut installiert haben, zu dem man gemeinsam zurückgehen kann, wenn die Bilder der Traumageschichte zu belastend werden. Im Falle von Fariba schlug ich vor, zwei ihrer wunderbar gemalten »Sicheren Orte« als reale Bilder rechts und links neben den vorgestellten Bildschirm zu hängen. Damit war das Schreckliche gewissermaßen wie in einem »Triptychon« eingefasst. (Zum Triptychon in der Gestaltungstherapie vgl. Reddemann 2001, S. 125 ff.) Links neben Fariba saß ich, rechts daneben Shanaz, die übersetzte. Wir ließen den Film mit dem Nachmittag jenes schlimmen Tages in einem Vorort von Kabul beginnen. Erst war alles friedlich. Die Kinder spielten, Fariba war mit ihrer Schwägerin in der Küche. Dann die schrecklichen Ereignisse, die wir Schritt für Schritt unter Einbeziehung von scheinbar auch unwichtigen Details, nach denen ich fragte, rekonstruierten. Das Fragen nach Details dient u. a. dem Abbremsen einer unkontrollierten Überflutung mit schrecklichen Bildern und Gefühlen, welche mit der spontanen Traumaerzählung oder Traumaerinnerung zumeist verbunden ist. Die Gefühle des Schreckens, der Hilflosigkeit und Angst sind aber spürbar. Fariba zittert manchmal, bekommt schreckgeweitete Augen. Zwischendrin wünscht sie sich (entsprechend unserer früheren Absprache) Pausen, in denen der Film ausgeschaltet ist und in denen wir mit unserer Aufmerksamkeit zwischen den beiden Bildern vom »Sicheren Ort« hin- und herpendeln. Dann schafft sie es, wieder in den Film hineinzugehen und ihn zu Ende zu erzählen bis zu der Stelle, wo die Räuber wieder abgezogen sind und sich Fariba um die Verletzungen ihres Mannes und die tote Schwägerin kümmern konnte. Das war natürlich entsetzlich, aber Fariba hat irgendwie gehandelt. Die Schwägerin konnte allen Schwierigkeiten zum Trotz am nächsten Tag ordnungsgemäß beerdigt werden. Ich frage Fariba dann, ob sie nun den Film bis zu einer Stelle zurückspulen möchte, von welcher aus wir dann das Skript gemeinsam neu schreiben könnten. Dieses Umschreiben in Richtung auf eine für die Patientin passende »Wunschszene« kommt aus dem Psychodrama. Fariba sagt Ja und scheint auch gleich eine Idee zu haben, wie das neue Skript aussehen könnte. Wir gehen zurück bis zu der Stelle, wo die Räuber damit beginnen, gewaltsam die Tür aufzubrechen. Fariba hat nun ein funktionierendes Telefon und ruft eine Polizeiwache im Stadtviertel an. Bewaffnete Polizisten erscheinen innerhalb kurzer Zeit am Tatort und nehmen die Mitglieder der Pachmanenbande fest. Fariba kann sich sehr genau deren Gesichter vorstellen, in denen sich Schrecken, Angst und Hilflosigkeit abbilden. Diese Vorstellung tut ihr gut, sie muss sogar etwas lachen. Wir beenden hier die Bildschirmübung, spulen die Videokassette mit beiden Varianten zurück und gehen zur sogenannten »Tresorübung« über. Fariba wird eingeladen, sich vorzustellen, wie sie die Videokassette in einen Tresorraum bringt, wo auch andere Filme aus ihrem Leben gelagert sind, sie an einer bestimmten Stelle ablegt und wieder hinausgeht. »Sie hören, wie sich die Tür schließt, wie Sie den Schlüssel umdrehen ... Sie legen den Schlüssel an einen bestimmten Ort, den nur Sie kennen. Normalerweise bleibt die Kassette im Tresor. Nur dann, wenn Sie wollen, und nur dann holen Sie sich den Schlüssel und schauen sich die Kassette oder Teile daraus, die Sie interessieren, an ...« Diese Übung soll gegen das Überfallartige helfen, welches dem Traumfilm anhaftet. Nach dieser abschließenden imaginativen Übung war Fariba erschöpft, aber, wie sie sagte, erleichtert. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass einzelne Bilder aus dem Film in den nächsten Tagen vielleicht doch wiederkommen könnten. Wir würden dann die Bildschirmübung und die Tresorübung so lange wiederholen, bis das Belastungsgefühl für sie deutlich schwächer wird. Ganz am Ende der Stunde gab es einen harmlosen Small Talk über das Befinden von Faribas Kindern. In der Tat ist die Wiederholung der Bildschirmübung (oder auch einer anderen Form der Traumaexposition) in vielen Traumatherapien erforderlich. Man kann vor und nach jeder Bildschirmarbeit zusammen mit der Patientin die Schwere der empfundenen Belastung in Bezug zur Traumageschichte auf einer Skala von zehn bis null messen. Der Verhaltenstherapeut Wolpe hat einst die »SUD-Skala« eingeführt. (SUD steht für Subjective Units of Disturbance. 10 steht für die höchstmögliche Belastung, 0 wäre gar keine Belastung.) In meinem Uni-Arbeitszimmer nehme ich oft meine zehnbändige Sigmund-Freud-Studienausgabe oder zehn aufgestapelte Hefte der »Zeitschrift für Psychotraumatologie« als Skala und frage die PatientInnen, wie viele Bände ich nun wegnehmen soll, damit sich die momentan gespürte Belastung bzw. Erleichterung abbildet. Bei Fariba habe ich keine Skala verwendet. Und wir hatten das Glück, dass sie bereits bei unserem nächsten Treffen von einer starken Abschwächung der Symptome und ihrer psychischen Belastung berichtete. Etwas später hatte Fariba einen Traum, in welchem ihr ihre verstorbene Schwägerin erschien. Sie brachte Orangen zu Faribas Familie in die Flüchtlingsunterkunft. Fariba bekam von ihr eine Orange überreicht. Die Kinder und ihr Mann bekamen zwei. Ich hatte den Gedanken, dass es sich um einen wichtigen Schritt in Richtung auf eine Kontaktaufnahme oder innere Aussöhnung mit der Schwägerin handeln könnte, gleichzeitig kam mir aber auch in den Sinn, dass Fariba vielleicht noch eine gewisse »Überlebensschuld« gegenüber der umgekommenen jungen Frau empfinden würde. Die Überlebensschuld ist ein wichtiges Element oder Konstrukt in unseren traumatheoretischen Lehrbüchern, und sie kommt auch wirklich vor. Aber ich habe diese Spur damals nicht weiterverfolgt. Vielleicht war ich zu erschöpft, vielleicht war es aber auch nicht nötig. Immerhin wirkte Fariba bei ihrer Erzählung vom Traum nicht beunruhigt, sondern eher neugierig und erstaunt. Möglicherweise war die eine Orange bereits ein Symbol für den Beginn eines wichtigen Prozesses. Faribas Situation und Befinden beruhigten sich. Ein paar Wochen später kam uns im Zusammenhang mit Ereignissen in Faribas Flüchtlingsunterkunft gewissermaßen Therapeut Zufall zu Hilfe. In der Unterkunft war an einem Abend ein tschetschenischer Mann laut und fast gewalttätig geworden. Fariba bekam Angst um ihre Familie. Jemand rief die Polizei, die auch prompt kam und den Randalierer mitnahm, der davon offenbar so beeindruckt war, dass er sich beruhigte und am nächsten Tag wieder freikam. Ich war froh, dass unsere Polizei in diesem Fall so reagiert hatte, wie man es sich für ein zivilisiertes Land nur wünschen kann. Es ist oft so, dass die afghanischen Flüchtlinge in Bezug auf die (manchmal wirklich etwas impulsiven) tschetschenischen Mitbewohner ganz ähnliche Ängste erleben wie in Bezug auf die wilden und gewalttätigen Männer in ihrer Heimat, welche sie dort bedroht hatten. Bei Fariba beruhigten sich diese Ängste in der Folge so weit, dass sie sich mit einer tschetschenischen Frau anfreundete, die als Mutter ganz ähnliche Sorgen hatte wie sie selbst. Sie tauschten sich in der Küche und bei anderen Aktivitäten aus. Es kam Fariba zugute, dass sie einmal Russisch gelernt hatte, das ja (neben ihrer Muttersprache) auch die erwachsenen Tschetscheninnen und Tschetschenen gut beherrschen. Faribas Symptome klangen weiterhin ab, und zwar noch bevor sie den positiven Asylbescheid erhielt, der natürlich eine große Freude brachte. Fariba wollte die Therapie nach knapp einem Jahr beenden, weil ein alleinstehender afghanischer Mann, den sie gut kannte und sehr bedauerte, aus ihrer Sicht meine frei werdenden therapeutischen Kapazitäten nun viel dringender brauchen würde als sie. Zur Verabschiedung kamen auch ihre Kinder mit. Ich erhielt eine große Packung mit »Merci«-Pralinen, zu denen Faribas größere Tochter sorgenvoll anmerkte, davon würde der Professor nun aber wirklich zu dick, sowie ein schönes Hemd und eine passende Krawatte. Andreas Geschichte Andreas Geschichte handelt von Menschen aus einer anderen Kultur und in einem anderen therapeutischen Kontext. Die traumatherapeutische Arbeit mit ihr ergab sich in einem Gruppenprozess. Andrea nahm an einer Selbsterfahrungs- und Therapiegruppe teil, die etwas länger als ein Jahr dauerte, acht Frauen und einen Mann umfasste und in der vor allem mit der Methode des Psychodramas gearbeitet wurde. Alle zwei oder drei Wochen fuhr ich zu den mehrstündigen Gruppentreffen in ein benachbartes Land. Andrea kam vor einem Gruppentreffen zu mir und berichtete davon, dass sie sich seit dem letzten Treffen oft schlecht gefühlt habe. Das habe wohl mit der unsanften Landung auf dem Fußboden zu tun, die in der Szene passiert sei, wo sie im Spiel der Gruppenkollegin M. als Darstellerin von deren Mutter vom »Vater« umarmt worden sei. Sie habe von ihrer Verletzung in der Nachbesprechung des Spiels von M. nicht berichtet, weil sie M.'s Spiel und Vorstellung von einer stürmisch-verliebten Begegnung der Eltern nicht kaputt machen wollte. M. war über diese Szene im Rollenspiel und das neue Gefühl, »ein Kind der Liebe« zu sein, sehr glücklich gewesen, weil der Vater später mehr oder weniger verschwunden war. Andrea wusste auch jetzt nicht, ob es richtig sei, ihre Verstörung in die Gruppe einzubringen. Ich ermutigte sie, es zu tun. Vielleicht hätten wir dieses Mal eine Möglichkeit, ihre Verletzung besser zu verstehen. In der verbalen Befindlichkeitsrunde nach dem Start der Gruppe berichtete Andrea dann von ihrem Gefühl der Verletztheit. Was die anderen lustig gefunden hätten und was M. geholfen habe, habe sie wie einen sexuellen Übergriff erfahren. Und ihr seien in der Zeit danach sehr unangenehme Erinnerungen an einen sexuellen Übergriff durch einen Verwandten gekommen, den sie als Kind erlitten hatte. Für die Anwärmphase, die am Beginn jedes psychodramatischen Treffens steht, schlug ich den Gruppenmitgliedern die Imaginationsübung »Innerer Helfer« vor. Es war klar, dass die Gruppenmitglieder und vor allem Andrea etwas brauchen würden, das Unterstützung angesichts der angesprochenen Traumageschichte geben konnte. Die Ressourcen-Übung vom »Inneren Helfer« wurde oben, in Faribas Geschichte, schon kurz erwähnt. Die PatientInnen werden eingeladen, sich auf ihrem Sitz etwas zu entspannen, den Atem zu spüren und sich aus dem entstehenden angenehmen Körpergefühl heraus einen »Inneren Helfer« vorzustellen, der aber möglichst keine reale Figur, sondern eher märchenhaft und fantastisch sein soll. Im Falle unserer Psychodramagruppe kamen alle mit einer Helferfigur in Kontakt und wurden dann eingeladen, kurz darüber zu berichten. Andrea hatte sich einen schwarzen, pudelartigen Hund, groß wie ein Wolf, vorgestellt, der bei Bedarf Zähne zeigen und bedrohlich werden kann. Die Gruppe ist an der Geschichte von Andrea und der Idee, ihr zu helfen, sehr interessiert. Eine andere junge Frau deutet an, dass sie in der letzten Zeit öfters mit der vagen Erinnerung an einen Missbrauch beschäftigt sei. Für sie selbst sei es allerdings zu früh, sich damit intensiver zu befassen. Andrea war also von der Aufmerksamkeit der anderen gut gehalten. Mir kommt eine Inszenierung in den Sinn, die eine Kombination aus Psychodrama und der Bildschirmtechnik ist. Ich frage Andrea, ob sie sich das traumatische Ereignis von einem geschützten Platz aus und begleitet von unterstützenden Figuren auf einem vorgestellten Bildschirm anschauen und es dann vielleicht auch umgestalten möchte. Andrea riskiert es. Sie darf sich ein Gruppenmitglied als ihren großen Pudelwolf aussuchen und noch ein zweites als ein »Double« für sich, als eine »zweite Andrea« zur zusätzlichen Verstärkung. (Die Arbeit mit einem ichstärkenden Double ist im Psychodrama eine altvertraute Technik.) Die beiden gewählten Frauen übernehmen gern die Rollen. Jetzt sind sie schon zu dritt. Zwischen den beiden Helfe rinnen sitzt Andrea bequem mit Kissen auf dem Boden und mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Ein Holzbrettchen, das wir im Raum finden, dient als die fabelhafte Fernbedienung für einen Film, den wir uns gemeinsam auf der gegenüberliegenden Leinwand ansehen. Andrea wird gebeten, zunächst in der dritten Person und von einer noch sicheren Situation ausgehend zu berichten, wie sich die belastenden Ereignisse zugetragen haben. Andrea drückt auf die Fernbedienung, weiß, dass sie jederzeit unterbrechen, den Ablauf verändern kann, und beginnt zu erzählen. An manchen Stellen frage ich nach, und es entsteht eine Präzisierung: Andrea ist zehn oder elf. Wie jedes Jahr freut sie sich auf die Sommerferien, die sie allein bei den Großeltern in schöner Umgebung in der Nähe eines Flusses verbringen darf. Das ist besonders wichtig, weil es zu Hause schwierig ist, da der Vater die Familie verlassen hat und die Mutter mit den Kindern oft überfordert ist. Bei den Großeltern ist außerdem ein Onkel mit seiner Frau zu Besuch, der wie bereits öfters aus der Ferne zum Urlaubmachen gekommen ist. Andrea interessiert sich sehr für die Tiere auf dem kleinen Anwesen. Die Hündin, ein Pudel mischling, hat Junge bekommen, und der Onkel bietet Andrea an, die Jungen in der Scheune, wo sie noch ziemlich hilflos herumkrabbeln, zu besuchen, damit sie sie streicheln und mit ihnen spielen kann. In dieser Situation nähert sich der Mann dem Mädchen, und es kommt zum sexuellen Übergriff. Andrea muss den Übergriff nicht weiter beschreiben, wir gehen mit der Fernbedienung etwas nach vorne, und Andrea berichtet von der Situation danach. In den folgenden Tagen tat der Onkel, als sei nichts passiert. Andrea wurde von seiner Frau freundlich in das Gästezimmer eingeladen. Aber sie schämte sich furchtbar. Von da an waren ihr die Ferien bei den Großeltern verdorben. Andrea fährt verwirrt und traurig nach Hause. Sie kann niemandem von dem schlimmen Erlebnis erzählen. Auch ging sie später im Sommer nicht mehr zu den Großeltern, wo der Täter weiterhin jedes Jahr Ferien machte. Damit war ihr ein »Sicherer Ort« zum Wohlfühlen abhanden gekommen. Ich frage Andrea, ob sie sich vorstellen könne, mithilfe unserer Fernbedienung den Film noch einmal zurücklaufen zu lassen, um an der Stelle, wo für die junge Andrea Schlimmes passiert ist, die Geschichte zu verändern, dem Mädchen von damals als Erwachsene von heute die Hilfe zu schicken, die es gebraucht hätte. Andrea stellt sich nun vor, dass sie nach dem Übergriff mit dem Pudelwolf in die Scheune geht und beide den Onkel zur Rede stellen. Man sieht, dass die Pudelwolf-Darstellerin und Andreas Double innerlich richtig mitgehen, aber alle drei bleiben auf ihrem Platz gegenüber dem Bildschirm sitzen. Der Pudelwolf zeigt seine großen Zähne und bedroht den Onkel, der furchtbare Angst bekommt. Die große Andrea im »neuen Film« attackiert ihn verbal, er solle sich schämen für das, was er getan habe. Ich ermutige die zwischen ihren Helferinnen auf dem Boden sitzende Andrea, das ganz laut zu sagen: »Du bist ein gemeiner Mensch, du hast dich zu schämen, zu schämen ...!« Andrea wird laut und deutlich. Die Angst des Onkels wird immer größer, er packt seine Sachen, flüchtet mit seinem Auto und ward nie wieder gesehen. Allgemeines Aufatmen in der Gruppe. – Ich schlage Andrea noch die abschließende Tresorübung vor. Sie scheint eine Beruhigung zu bringen. Wir setzen uns gemeinsam in die Runde, um das Erlebte nachzubesprechen. Das ist die im Psychodrama und auch in anderen Gruppentherapien so wichtige »Integrationsphase«. Zuerst geht es um die »Rollenfeedbacks« der beiden Mitspielerinnen. Ihnen (dem »Pudelwolf« und dem Double von Andrea) hat es zunächst gefallen, bei Andrea zu sein, sie auch körperlich zu stützen und zu trösten. Und die Aggression gegen den Täter war sehr lustvoll gewesen. Im Gespräch wird betont, wie wichtig es war, das Gefühl der Scham dorthin zu schicken, wo es hingehört, nämlich zu dem Mann, der seine Missbrauchshandlung zu verantworten hat. Auf keinen Fall darf die Scham beim Kind, beim Opfer bleiben. – Alle Gruppenmitglieder geben Andrea ihr persönliches »Sharing«. Die junge Frau, die zu Beginn der Sitzung von einer vagen Missbrauchs-Erinnerung gesprochen hatte, berichtet, dass die vorgestellte Attacke und Klarstellung gegenüber dem Täter für sie sehr bewegend, aber irgendwie auch entlastend gewesen sei. M., deren Spiel Andreas Beunruhigung ausgelöst hatte, fühlt sich Andrea sehr nahe und spürt gleichzeitig, dass ihr Bild von der positiven Umarmung der Eltern von Andreas traumatischer Erinnerung nicht berührt ist. Andrea selbst sagt, dass sie sehr erleichtert sei. Erstens, weil sie die Geschichte zum erstenmal erzählt habe, und zweitens, weil alle in der Gruppe so reagiert hätten, dass sie sich überhaupt nicht habe schämen müssen. Das Gefühl der Scham, etwas Schmutziges getan zu haben, sei in der Tat in all den folgenden Jahren in ihr geblieben. Jetzt spüre sie deutlich, dass sie sich in keiner Weise zu schämen habe. Am Ende unserer Gruppentreffen, ein knappes Jahr nach jener Sitzung, wurden alle Teilnehmerinnen und unser männliches Gruppenmitglied im Zuge der Abschlussreflexion gebeten, sich zu erinnern und mitzuteilen, welches Spiel oder welche Szene aus dem gesamten Gruppenprozess für sie im Nachhinein die wichtigsten seien. Dazu sollte mit Farbstiften ein Bild gemalt werden. Andrea war auf ihrem Bild in Begleitung eines großen schwarzen Pudelwolfs mit beeindruckenden Zähnen vor einem Fernsehapparat zu sehen. Sie berichtete, dass die Wirkung ihres Spiels nachhaltig gewesen sei. Sie habe in Gruppen eigentlich immer ein diffuses Gefühl der Scham gehabt, dessen Ursprung ihr nicht klar gewesen sei. Daraus waren Rede- und Lernhemmungen entstanden. Diese seien nun ganz und gar verschwunden. Sie fühle sich in Gruppen, auch außerhalb der Psychodramagruppe, mittlerweile freier und sicherer. Das Kapitel des Missbrauchs schien für sie zunächst abgeschlossen.
Vorwort Das Anteilnehmen an extrem belastenden Erfahrungen hat in den letzten Jahren zugenommen, und das ist erfreulich. Das Bedürfnis, Schlimmes von sich fernzuhalten, um davon nicht »angesteckt« zu werden, ist ja verständlich. Denn vieles spricht inzwischen dafür, dass die meisten Menschen gar nicht anders können, als das Leiden anderer auch mitzufühlen. In der Beschäftigung mit traumatischen Lebenserfahrungen und deren Folgen scheint es jedoch eine unbewusste Hierarchie im öffentlichen Diskurs zu geben. Zunächst stoßen Naturkatastrophen und deren Folgen auf breites öffentliches Interesse, danach kommen, zumal in letzter Zeit, die Opfer von Gewalt und sexueller Gewalt in der Familie und im familiären Umfeld, siehe im Frühjahr 2010 die Anteilnahme der Öffentlichkeit an den Folgen von Traumatisierungen von Kindern in Schulen, Heimen etc. Doch wer weiß, auch unter Fachleuten, um das Grauen, das Menschen, die als Asylsuchende oder als hochbetagte Opfer des NS-Terrors zu uns kommen, erlitten haben? Wenn man bedenkt, dass Terrence des Prés wichtiges Buch »Der Überlebende – Anatomie der Todeslager«, das auf Englisch 1976 erschien, auf Deutsch erst im Jahr 2008 herauskam, so kommt man nicht umhin, eine Scheu und Vermeidungstendenzen im Umgang mit kollektiv zugefügtem Leid zu vermuten. Vielleicht weil die Opfer von staatlichem und politischem Terror uns an unsere Geschichte als Tätervolk erinnern? Umso wichtiger erscheint es mir, dass Klaus Ottomeyer und sein Team bei Aspis in Klagenfurt sich der Opfer staatlicher und politischer Gewalt annehmen, so wie es einige ähnlich ausgerichtete Beratungsstellen in Deutschland ebenfalls tun. Die Zahl dieser engagierten Kolleginnen und Kollegen ist nicht groß im Vergleich mit den vielen, die sich heute um Psychotraumata kümmern. Es könnte allerdings auch ihnen widerfahren, dass ein Mensch, der Opfer von Krieg, Vertreibung und Folter ist, in die Praxis kommt. Und dann werden sie sich vor die Herausforderung gestellt sehen, dass ihr Handwerkszeug zum Umgang mit den speziellen Traumafolgen bei Weitem nicht ausreicht. Das Buch von Klaus Ottomeyer fordert uns heraus, uns mit der Geschichte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert genauer zu befassen und zur Kenntnis zu nehmen, dass nicht weit entfernt von uns Menschen gequält und gefoltert werden. Klaus Ottomeyer zeigt, wie er und sein Team mit diesen Menschen arbeiten. Es wird deutlich, dass vieles gebraucht wird, vor allem aber mitfühlende Menschlichkeit und ein weit über das übliche professionelle Engagement hinausgehender Einsatz. Die Fallgeschichten in Klaus Ottomeyers Buch werden wohl kaum jemand kalt lassen. Ich habe mich immer wieder bei der Lektüre geschämt, eine Europäerin zu sein und Teil eines Systems, das alles tut, um Menschen mit diesen und ähnlichen Geschichten nicht die notwendige Fürsorge angedeihen zu lassen. Mit breitem psychoanalytischem Hintergrund und tiefem Verständnis für seine Patientinnen und Patienten gelingt es Klaus Ottomeyer, die Leserin und den Leser auf eine Reise in die innere und äußere Welt der Opfer mitzunehmen. Von ihm ist zu lernen, wie man den Opfern begegnen kann: als Mensch und als professionell handelnde Therapeutin. Das Buch vermittelt sowohl tiefenhermeneutisches wie sozialpsychologisches Wissen und Verstehen und zeigt, wie man dieses Wissen praktisch und kreativ umsetzen kann. Ich wünsche diesem Buch viele Leserinnen und Leser. Denn seine Lektüre hilft, schwer traumatisierten Menschen mit weit mehr als Technik zu begegnen. Luise Reddemann Wozu dieses Buch? Der Titel des vorliegenden Buches »Die Behandlung der Opfer« klingt zunächst mehrdeutig oder vielleicht auch anmaßend. Aber seine Mehrdeutigkeit ermöglicht es mir zu erklären, worum es mir geht. Es geht erstens darum zu zeigen, dass es möglich ist, Menschen, die traumatisiert sind, die großen Schrecken und tiefe Verzweiflung erlebt haben, mit den Mitteln der Psychotherapie zu behandeln; und dass es mittlerweile erprobte Wege und handwerkliche Mittel der Traumatherapie gibt, die zu kennen und in verständlicher Form weiterzugeben, Sinn macht. Obwohl es eine empfohlene Abfolge der therapeutischen Schritte und bestimmte Techniken gibt, darf man die Patienten und Patientinnen nie schematisch behandeln, sondern muss für jeden und jede »die Therapie neu erfinden«. Deshalb erzähle ich vor allem Geschichten von Menschen. Ein therapeutischer Pessimismus in der Behandlung ist ebenso unangebracht wie die Vorstellung, allen Hilfe suchenden Patientinnen und Patienten helfen zu können oder zu müssen – der »furor sanandi«, wie Freud es nannte. Ich werde zumindest eine Geschichte erzählen, in der mein furor sanandi vorkommt und wahrscheinlich nichts Gutes bewirkt hat. Es geht im Buch zweitens darum zu zeigen, wie die Gesellschaft (und das sind auch wir selbst) die Opfer von Gewalt und ihre Traumata behandelt: nämlich oft genug respektlos, entwertend, schikanierend und manchmal sogar sadistisch – wobei Politiker hier die Funktion von Schleusenwärtern oder Schleusenöffnern haben. Das beeinflusst natürlich die Heilung und Erholung der Trauma-Opfer – bis hin zu der Erfahrung, dass die nachträgliche schlechte Behandlung und Ignoranz gegenüber den Opfern für sie eigentlich die schlimmste Traumatisierung darstellt. Darüber hinaus beeinträchtigt die schlechte Behandlung der Opfer durch die Gesellschaft und die Politik unser aller Lebensqualität. Traumatisierung ist – worauf Luise Reddemann (2008) hingewiesen hat – vor allem ein extremer Angriff auf die menschliche Würde. Wenn wir Ignoranz und Verhöhnung gegenüber einer besonders verletzlichen und in ihrer Würde bedrohten Menschengruppe – zum Beispiel gegenüber traumatisierten Flüchtlingen – zulassen, wird dies über kurz oder lang auf uns zurückschlagen. An den traumatisierten Asylsuchenden, die nicht mehr und nicht weniger als ein Menschenrecht in Anspruch nehmen, welches in allen demokratischen Gesellschaften verankert ist, wird seit geraumer Zeit die Entwertung und Beschimpfung ganzer Menschengruppen eingeübt, die als verletzlich, ökonomisch »überzählig« oder ganz einfach als faul gelten. Dabei mag die Beschimpfung der Opfer, an denen »ein Exempel statuiert wird«, gegen die Angst helfen, selbst einmal zu den Invaliden und Opfern des gesellschaftlichen Prozesses zu gehören. Es zeichnet sich ab, dass die Finanz- und Wirtschaftskrise, die im Herbst 2008 begonnen hat, die Jagdbereitschaft der (noch) Integrierten weiter verstärkt. Die politischen Profiteure und Demagogen sind schon dabei, das Feuer anzufachen. Die Traumadiskussion, die wir in den Gesundheitswissenschaften seit etwa 25 Jahren und in den westlichen Medien seit etwa 15 Jahren führen, war manchmal unscharf und mit einer inflationären Verwendung des Traumabegriffs verbunden. Sie hatte aber mit der Anerkennung von seelischem Leid, das durch gesellschaftliche Gewalt (und manchmal auch durch die Gewalt der Natur) hervorgerufen wird, einen wichtigen »civilizing influence«, der immer wieder verloren zu gehen droht. Die Tendenzen zu einem erneuten Vergessen und zur Verachtung der Opfer sind genauso stark. Es wird auch erfolgreich gesplittet: Westeuropäische Opfer des Tsunami oder von anderen »Großschadensereignissen« erhalten (zu Recht) jegliche Hilfe nach dem neuesten Stand der Trauma-Wissenschaft – und zwar ohne Wartezeiten. Gleichzeitig werden traumatisierte Menschen aus Asien oder Afrika, die dem Tode nahe waren, möglichst »ohne Ansehen der Person« gleich wieder zurückgeschickt, wenn sie zum Beispiel aus Somalia oder Darfur kommend auf Lampedusa, diesseits der europäischen Grenze, gelandet sind. Wenn sie es schaffen, sich irgendwie auf der europäischen Rettungsinsel festzukrallen, gelten sie als »Wirtschaftsflüchtlinge« oder Simulanten. Auch Millionen von Flüchtlingen aus dem Irak haben sich die – vor allem um sich selbst besorgten – Europäer erfolgreich vom Leib gehalten. Es geht also drittens bei der Rede von der »Behandlung der Opfer« um einen wünschenswerten Umgang mit Menschen jeglicher Herkunft, der auf die Erhaltung oder Förderung von Selbstachtung und Würde gerichtet ist. Man sollte Menschen immer mit Respekt behandeln. Es handelt sich hier weniger um ein trainierbares Programm als um ein Prinzip der Begegnung. Ich wähle absichtlich dieses etwas altertümliche Wort. Jeder, der mit Traumatisierten arbeitet – egal ob professionell oder ehrenamtlich –, weiß, wie sehr sich die Verletzung der Würde des Opfers auch auf der Seite des Helfers/der Helferin niederschlägt. Das kann bis zu einer dauerhaften Niedergeschlagenheit beim Helfer oder in seinem Team führen. Unsere Selbstachtung und unser Selbstbewusstsein als Individuen hängen zusammen. »Das Tun des Einen ist das Tun des Anderen«, heißt es bei Hegel über die Entwicklung unseres Selbstbewusstseins. Natürlich muss man manchmal die Augen schließen, ganz woanders hinschauen und Urlaub machen. Aber dann sollte man wenigstens für einen Moment wissen, dass man wegschaut. Raoul Hilberg hat sein zusammenfassendes Buch über seine le benslange Holocaust-Forschung »Opfer – Täter – Zuschauer« (1992) genannt. Diese drei Gruppen bilden immer ein System, dem wir kaum entrinnen können, und zwar auf der unmittelbar-lokalen Ebene, in der wir arbeiten und leben, ebenso wie auf der globalen Ebene, wo wir als Zuschauer via TV an den neuesten Kriegen und Flüchtlingsdramen, vielleicht sogar am nächsten Genozid teilhaben können. Ich habe das zweifelhafte Glück, als Wissenschaftler und Psychotherapeut seit 27 Jahren im österreichischen Bundesland Kärnten zu arbeiten und zu leben, wo es in Bezug auf den Umgang mit den Opfern organisierter Gewalt, mit den Opfern des Nazi-Terrors und mit traumatisierten Flüchtlingen zu einer »Lockerung des moralischen Korsetts« und zu Grobheiten und Entwürdigungen gekommen ist, die für andere westliche Demokratien (noch) unüblich sind. Die politische Kultur im Nachbarland Italien ist seit 2008 allerdings dabei, auf diesem Feld rapide aufzuholen. In Frankreich zeugen Äußerungen und Abschiebungserlasse des amtierenden Präsidenten von der neuen Grobheit gegenüber Menschen, die fremd und hilfsbedürftig sind. Aber möglicherweise waren Kärnten, Österreich, Frankreich und Italien nur Vorreiter in Bezug auf eine neue, »unbefangene« politische Kultur in Europa, die es mit den Menschenrechten für Minderheiten und mit der Genfer Konvention nicht mehr so genau nimmt. Auch wenn die Aufkündigung des Schutzes für traumatisierte Menschen und Angehörige von Minderheiten zunächst nur ein paar Dutzend, ein paar Hundert oder Tausend Menschen trifft, muss man sich doch so bald wie möglich und solange es noch geht, dagegenstellen. Wie gesagt, nicht nur aus Gründen der Moral, sondern auch zur Erhaltung der Lebensqualität in einem freundlichen, friedlichen Europa. Luise Reddemann bezieht sich in ihrem Buch über die Würde in der Psychotherapie (2008) auf den Philosophen Richard Rorty (2003). Sie teilt mit ihm die Ansicht, dass eine Kultur der Menschenrechte weniger aus komplizierten moralphilosophischen Diskussionen, Wissensbeständen und Herleitungen entsteht, sondern auf relativ einfache Weise durch das »Hören trauriger und rührseliger Geschichten« (Rorty), welche an die menschliche Einfühlungsfähigkeit appellieren und sie stärken. Diese »Schule der Empfindsamkeit« wirkt der Einteilung der Menschen in verschiedene Sorten und Güteklassen entgegen. Als ich das las, wusste ich plötzlich genau, wozu ich dieses Buch schreibe und warum ich es auf diese Weise schreibe. Man müsste nur das Wort »rührselig« (wahrscheinlich die Folge einer nicht ganz richtigen Übersetzung ins Deutsche) durch das Wort »anrührend« ersetzen, denn »rührselig« wird bei uns mit Kitsch assoziiert. Ich habe versucht, Kitsch zu vermeiden. Der Rückgriff auf erlebte Geschichten scheint mir auch sinnvoll, weil wir in der Psychotraumatologie (also der Wissenschaft vom extremen seelischen Leid, vom Schrecken, von der Verzweiflung und unseren Möglichkeiten der Linderung und Abhilfe) seit geraumer Zeit wieder einer Tendenz begegnen, die Geschichten der Betroffenen hinter Gesetzmäßigkeiten, Hirnfunktionen, Messwerten und Zahlenkolonnen (die natürlich ihren Sinn haben) verschwinden zu lassen. Die Bewegtheit (»Angerührtheit«) der ForscherInnen und TherapeutInnen angesichts des traumatischen Schreckens, für die es in unserer Fachsprache den Begriff der »Gegenübertragung« gibt, wird im öffentlichen Raum zugunsten einer quasi-medizinischen Objektivität wieder schamhaft verborgen. In der Supervision und Eigentherapie der HelferInnen wird sie freilich umso intensiver behandelt. Ohne Selbstreflexion ist im Umgang mit Trauma (wie auch mit anderen Formen seelischen Leidens) nichts zu lernen. Ich weiß, dass es riskant werden kann und der wissenschaftlichen Karriere nicht zuträglich ist, wenn man zu viel vom Zweifel an sich selbst und vom Nachdenken über sich selbst in der Öffentlichkeit zeigt. Aber als einer der letzten österreichischen Wissenschafts-Beamten, der sich langsam auf die (derzeit noch) vom Staat garantierte Pension zubewegt, riskiere ich vergleichsweise gar nichts. Ganz grob gesagt ist das Buch so aufgebaut, dass die in die reflektierten Fallgeschichten hineinspielenden gesellschaftlichen Bedingungen ein immer größeres, manchmal »störendes« Gewicht bekommen, sodass ich gegen Ende mehr als Sozialpsychologe und politischer Psychologe denn als Psychotherapeut argumentiere. Ich habe die Fallgeschichten anonymisiert, damit die PatienInnen nicht erkennbar sind. Die Mehrheit der PatientInnen habe ich noch um ihr Einverständnis zu den aufgeschriebenen Geschichten bitten können. Andere sind verzogen oder verstorben. Luise Reddemann hat mir noch einen Rat gegeben: Ich solle die Leser Innen darauf hinweisen, dass die Fallgeschichten teilweise belastend sind und dass es gut ist, wenn sie mit Erholungspausen dazwischen gelesen werden. Sie hat sicherlich recht. Mir war das nicht so präsent, weil für mich selbst die Verschriftlichung meiner Erfahrungen mit TraumapatientInnen aus den letzten 20 Jahren eher eine emotionale Entlastung bedeutet hat und ich beim Schreiben einen Teil der Belastung loswerde. 1. Einführung: Traumatherapie untergünstigen Umständen Am Beginn sollen zwei Geschichten stehen, welche einführend zeigen, was ein Trauma ist und wie man traumatisierte Menschen nach dem (mir zur Verfügung stehenden) Stand des Fachwissens psychotherapeutisch behandeln kann. Anders als in den meisten der später dargestellten Fallgeschichten waren hier die äußeren Umstände für die Psychotherapie eher günstig. Es gab kaum eine Einmischung und Behinderung von außen: durch Behörden und durch die fremdenfeindliche Politik im Land. Die Belastungen und der Ärger, die man als Therapeut oft empfindet, wenn Gewaltopfer von ihrer Umgebung weiterhin ungerecht behandelt werden, und die in nachfolgenden Kapiteln des Buches eine Rolle spielen, hielten sich in Grenzen. Auch die eigene lebensgeschichtliche Verstrickung des Therapeuten, die manchmal die Therapie erschweren kann, war nicht blockierend. Und es handelt sich um Traumatisierungen, die für die Patientinnen mit einer einmaligen seelischen Verletzung verbunden und/oder an zeitlich begrenzte rekonstruierbare Situationen gebunden waren. Ein Trauma dieser Art heißt in der Fachsprache »Typ-I-Trauma«. (Terr 1995) Von Typ-II-Traumata, die – wie zum Beispiel Gefängnis- und Lageraufenthalte – auf lang anhaltenden und wiederholten Traumatisierungen beruhen, wird in nachfolgenden Geschichten die Rede sein. Deswegen kann man in den ersten beiden Darstellungen von »Traumatherapie unter günstigen Umständen« sprechen. Die erste Geschichte handelt von einer afghanischen Frau, die zweite von einer aus Süddeutschland. Faribas Geschichte Fariba kam in unsere Traumaberatungsstelle, weil andere afghanische Frauen uns empfohlen hatten. Sie war verheiratet, etwa Anfang vierzig und wohnte mit ihrem Mann und drei Kindern in einer Flüchtlingspension. Als Übersetzerin unterstützte mich wie schon oft Shanaz, die aus dem Iran stammt und weiß, was ein Flüchtlingsschicksal ist. Da Fariba Tadschikin war und die afghanische Sprache Dari sprach, gab es kaum Probleme. Das persische Farsi und das Dari sind sich sehr ähnlich. Die Afghaninnen mögen Shanaz sehr. Obwohl das eigentlich den strengen Lehrbuchregeln für die Rolle der Übersetzerin in der Psychotherapie widerspricht, kommt Shanaz mit ihrer herzlichen Art manchmal in die Rolle einer Co-Therapeutin. Ich kann mit ihr gut arbeiten. Faribas Mann und die drei Kinder glaubten, Fariba sei in der letzten Zeit verrückt geworden. Im unmittelbaren Kontakt sehr offen und freundlich, erzählte sie mir von ihren merkwürdigen Erlebnissen und Verhaltensweisen. Auf dem Balkon des Zimmers, in dem sie zu fünft wohnten, sah sie des Öfteren Gesichter und Männer, die von draußen hereinwollten. Manchmal war die sich bewegende Wäsche der äußere Auslöser, manchmal gar nichts. Sie fürchtete, dass durch die Tür zum Flur Männer kommen könnten, und musste die Tür immer wieder versperren – was für die Kinder, die sich hinaus, und wieder hereinbewegen wollten, ein Problem war. Manchmal glaubte sie auch, dass gefährliche Verbrecher aus dem TV-Gerät kommen könnten, um ihrer Familie etwas anzutun. Am meisten verwirrt waren ihr Mann und ihre Kinder darüber, dass Fariba nicht nur schlecht einschlafen konnte, sondern des Nachts aufstand und im Zimmer schlafwandelte. Die zuerst genannten Merkwürdigkeiten konnten gut Traumasymptome sein; vom Schlafwandeln als Traumasymptom hatte ich allerdings noch nie gehört. Fariba berichtete noch von einem Konflikt, den sie kürzlich im Zusammenhang mit der geplanten Schul-Ski-Woche ihres Sohnes hatte. Obwohl die Lehrerin und andere Eltern sich bemüht hatten, dem Flüchtlingskind den Aufenthalt finanziell zu ermöglichen, und obwohl der Junge sich freute, wollte Fariba ihn nicht fahren lassen. Sie hatte furchtbare Angst, dass er in der Fremde verunglücken könnte. Da ich von anderen Patientinnen wusste, dass eine der Schlepperrouten, auf der die Flüchtlinge aus Afghanistan hinaus und dann quer durch Asien und die ehemaligen Sowjetrepubliken nach Europa gebracht wurden, durch sehr hohe und gefährliche Gebirge führte, fragte ich Fariba vorsichtig, ob sie auf der Flucht Berge, Schnee und Eis als etwas sehr Gefährliches erlebt habe. Sie bejahte die Frage und fügte noch hinzu, dass sie den kleinen Jungen damals abwechselnd mit ihrem Mann getragen habe und dass viele Flüchtlinge auf dem Weg abgestürzt oder erfroren seien. Ich brauchte nicht mehr viel zu interpretieren. Fariba verstand fast von selbst, dass sich die schrecklichen Erinnerungen von damals in ihre Psyche und ihren Körper als (gewissermaßen »zeitlose«) Erfahrungen und Erwartungen eingeprägt oder eingebrannt hatten und dass die alte Angst in neuen Situationen, welche an die traumatische Situation auch nur vage erinnern, wieder aktiviert wird. Die Berge Kärntens sehen nicht so viel anders aus als die Berge in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Usbekistan. Unser Traumagedächtnis hängt mit einem archaischen Automatismus der Amygdala, der »Mandelkernregion« im Gehirn, zusammen, der von den »höheren« und bewussten Gedächtnisfunktionen zunächst abgekoppelt ist (Hinckeldey und Fischer 2002). Man hat die Amygdala mit einem Rauchmelder verglichen. An dieser Stelle unseres Gesprächs konnte ich sinngemäß den Lieblingssatz aller TraumatherapeutInnen einbringen: »Sie sind nicht verrückt oder abnormal, sondern ihre Symptome sind normale Reaktionen auf eine abnormale Situation.« Obwohl schon häufig benutzt, wirkt dieser Satz immer wieder entlastend. So war es auch im Falle von Fariba. Sie konnte den Sohn auf die Ski-Woche mitfahren lassen, er hatte Spaß daran und kam zum Glück ohne Verletzung zurück. Im Kontext der lebensgefährlichen Flucht über die Berge war ein »traumakompensatorisches Schema« (Fischer und Riedesser 2009, S. 395) entstanden, aus dem Fariba in Richtung auf ein Mehr an eigener Beweglichkeit heraustreten konnte, nachdem sie es verstanden hatte. Die Wiedergewinnung von Beweglichkeit ist ein Hauptziel jeder Traumatherapie. Hier wird schon eine elementare Operation sichtbar, die TraumatherapeutInnen eigentlich ständig und manchmal fast wie nebenbei vollziehen: Das »szenische Verstehen« und Komplettieren von alltäglichen Geschichten und Begegnungen, welche die Opfer irritieren und ängstigen, weil ihnen der Zusammenhang zur ursprünglichen traumatischen Situation nicht klar ist. Der wichtigste Autor zur Methode des »szenischen Verstehens« in der Psychoanalyse und in den Kulturwissenschaften ist Alfred Lorenzer (1970, 1974). Die wenigsten wissen, dass er seine Theorie zuerst in der Arbeit mit Traumapatienten entwickelt hat (vgl. Lorenzer 1965). Das Herausfinden und Bearbeiten des hauptsächlichen Traumas war etwas komplizierter, aber auch nicht sehr schwer. Ich ließ mir von Fariba einen kleinen Überblick über ihre Lebensgeschichte, die guten und die schlechten Ereignisse geben. Wer in den letzten Jahrzehnten in Afghanistan gelebt hat oder dort aufgewachsen ist, hat hauptsächlich Krieg und Zerstörung erlebt. Es gibt kaum eine Familie, in der nicht Angehörige von Bomben zerfetzt, entführt oder ermordet wurden. Fariba hatte zumindest etwas Glück gehabt: Sie hatte fürsorgliche Eltern, sie durfte sich ihren Mann selbst aussuchen (der allerdings inzwischen aus ihrer Sicht etwas zu autoritär war), und sie hatte noch das Schulsystem in der Zeit der prosowjetischen Regierung durchlaufen, bei dem es eine fast völlige Gleichberechtigung der Mädchen und Frauen gegeben hatte. Sie konnte arabisch (persisch), etwas lateinisch und sogar kyrillisch schreiben. Auch viele Gegner des Kommunismus sprechen sehr respektvoll vom längst versunkenen afghanischen Bildungssystem in der Zeit vor der Vertreibung der Russen durch die Mudjahedin. Vor allem hatte Fariba in der Schule ihre Liebe zum Malen entdeckt, welche sie später, vor allem nach der Machtübernahme der Taliban im Herbst 1996, verstecken musste, weil Malen und die Malerei etwas Lebensgefährliches darstellte, vor allem für eine Frau. Khaled Hosseini berichtet in seinem realistischen Afghanistan-Roman »Tausend strahlende Sonnen« (2007) von einem Maler, der vor allem Flamingos gemalt hatte. Die Taliban fanden die nackten Beine der Vögel anstößig, schlugen dem Maler öffentlich die Füße blutig und stellten ihn vor die Wahl, entweder die Bilder zu zerstören oder die Flamingos in züchtiger Form darzustellen, woraufhin der Maler allen Flamingos Hosen malte – allerdings, was die Taliban nicht wussten, mit Wasserfarben, damit die Hosen für die Zeit nach den Taliban wieder abwaschbar waren. Auch Fariba hatte ihre Freude an selbst gemalten Bildern irgendwie durch die Ära der Verfolgung gerettet, hatte allerdings seit vielen Jahren nicht mehr mit Zeichenpapier und Pinsel hantiert. Die Familie von Fariba war in verschiedene schwierige Situationen geraten. Das Schlimmste war aber folgende Geschichte gewesen: In der Zeit kurz vor der Machtübernahme durch die Taliban war es in Kabul sehr unsicher, weil verschiedene Milizen um die einzelnen Stadtteile kämpften. Eine paramilitärische Gruppe, sogenannte Pachmanen (Leute aus der Bergregion von Pachman), führte sich als eine Art Schutztruppe für das Stadtviertel auf, in dem Fariba mit ihrer Familie wohnte. In Wirklichkeit waren sie aber auch darauf aus, die Bewohner des Viertels auszuplündern. An einem Abend donnerte es an die Tür des Familienhauses, und als nicht gleich geöffnet wurde, brach eine Bande von Pachmanen die Tür auf und trieb die Familie gewaltsam in das Obergeschoss. Zur Familie gehörten, neben Fariba und ihrem Mann, ihre zwei kleinen Kinder und eine junge Schwägerin, eine Schwester des Mannes. Die Situation muss grauenvoll gewesen sein. Die Pachmanen wollten Geld. Als sie keines bekamen – weil keines im Haus war –, begannen sie Faribas Mann die Beine zu brechen. Fariba selbst musste vor allem die Kinder schützen. Als sich die Männer der Schwägerin näherten, sprang diese aus dem Fenster und und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie starb. Die Pachmanen zogen wieder ab. Ihnen passierte nichts. Sie arrangierten sich später mit den Taliban und wurden ein Teil von ihnen. Der Anführer der Bande wurde einige Jahre später umgebracht, und die Situation wurde für Faribas Familie noch einmal gefährlich, weil die Taliban annahmen, dass Faribas Mann etwas damit zu tun habe. Die Flucht wurde unumgänglich. Nach dieser ersten Erzählung des hauptsächlichen traumatischen Ereignisses war es nicht mehr sehr schwer, den Sinn der meisten Symptome zu verstehen, unter denen Fariba litt. Die Bilder von den Männern, die sie über den Balkon, durch die Tür oder gar aus dem Fernsehgerät kommen sah, waren in der Sprache der Traumadiagnostik »intrusive Symptome«, eindringende, unerwünschte Bilder der Erinnerung an die traumatische Situation, welche in unserem Falle die Patientin als verbrecherische »Eindringlinge« tagsüber und wohl auch nachts im Zusammenhang mit dem Schlafwandeln verfolgten. Zugleich waren sie Symptome der »Hypervigilanz«, der Überwachsamkeit, die für Traumatisierte typisch sind. Die Sache von damals war überhaupt nicht erledigt, quälte Fariba immer noch – so als ob eine (weitgehend unbewusste) Instanz in ihr sagen würde: »Solche Dinge können in unserer Welt jederzeit passieren, Fariba, hüte deine Kinder, sperre alle Türen ab, sei immer wachsam, schreckliche Verbrecherfilme, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, können jederzeit in die Wirklichkeit kommen!« Irgendwie hatte diese Instanz ja sogar recht. Ein gelassenes Leben ohne Wachsamkeit und Angst, vielleicht auch eine Freude über das neue Leben in Österreich, war für Fariba fast nicht mehr möglich. Ähnlich wie bei der Angst vor Bergen und Schnee und um ihren Sohn war es nicht schwer, Fariba diese Zusammenhänge zu erklären. Sie war nicht verrückt. Nachdem wir eine erste Klarheit über Faribas quälende Symptome und ihren Hintergrund hatten, schrieb ich einen psychotherapeutischen »Befundbericht« mit einer entsprechenden Traumadiagnose samt einer Darstellung der traumatisierenden Ereignisse für den sogenannten Unabhängigen Asylsenat. Bei diesem lag damals der Asylantrag von Fariba und ihrem Mann, nachdem er in der ersten Instanz beim Bundesasylamt abgewiesen worden war. Ich verfasse solche Befundberichte grundsätzlich so, dass ein Fachkollege es versteht, dass die Juristen oder Beamten bei den Asylbehörden es verstehen und dass die PatientInnen es in übersetzter Form verstehen. Ich übergebe den Bericht formell der Patientin, die ihn dann weiterleiten kann. (Im Juristendeutsch: Die Patientin bleibt die »Geheimnisherrin«; die Schweigepflicht des Therapeuten bleibt gewahrt.) Mit ihren Symptomen erfüllte Fariba alle Kriterien für die klassische Diagnose Posttraumatische Belastungsstörung: A. Vorliegen eines lebensbedrohlichen Ereignisses, B. Symptome der Intrusion (Überflutung), C. Symptome des Vermeidens, D. Symptome der Übererregung (vgl. Saß u. a. 2003, S. 530 f.). An der Glaubhaftigkeit von Faribas Erzählung (für die Asylbehörden eine wichtige Frage) hatte ich nicht die geringsten Zweifel. Das österreichische Asylgesetz enthält immerhin einen Paragraphen, der traumatisierten Flüchtlingen einen besonderen Schutz zusichert – wenngleich diese Bestimmung in anderen Bestimmungen und in der Behördenpraxis wieder unterlaufen wird. In Faribas Fall hatten wir das Glück, dass die Behörde nicht auf die Idee kam, sozusagen als Gegenstück zu meinem Bericht aus der Psychotherapie, eines jener hanebüchenen und unwissenschaftlichen psychiatrischen Gutachten zur Frage der Traumatisierung anzufordern, die damals in Österreich verbreitet waren und die es teilweise auch heute noch gibt (vgl. Ottomeyer 2006). Traumatherapie hat üblicherweise drei Phasen (die sich überlappen können): Die Phase der Stabilisierung, in der man neben dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung Kraftquellen, sogenannte »Ressourcen«, der Patientin sucht und verstärkt, dann eine Phase, in der das Trauma in einer für die Patientin erträglichen Weise rekonstruiert und in die Lebenserzählung besser eingefügt (»bearbeitet«) wird, und schließlich die Phase der Wiedereingliederung, der Integration der Patientin in ein »normales« Alltags- und Sozialleben, in welchem das Trauma und die Folgesymptome nicht mehr das beherrschende Thema sind. Das Element einer beruhigenden Aufklärung über den Sinn der Traumasymptome (»Normale Reaktionen ...«) gehört an den Beginn der Stabilisierungsphase. Fariba hatte, wie schon deutlich geworden ist, einige Kraftquellen. Das war ihre gute Bildung, das war ihr Humor, das waren ihre festen Freundschaften mit einigen afghanischen Frauen – gemeinsam hatten sie es geschafft, durch einen wohlformulierten Protestbrief dafür zu sorgen, dass es in der Flüchtlingspension nicht nur eine halbe Stunde am Tag warmes Wasser gab. Eine weitere Kraftquelle war die in der Therapie wiederentdeckte Freude am Malen. In der Stabilisierungsphase machen wir meistens einige bekannte Imaginationsübungen, die hauptsächlich von Luise Reddemann stammen. Sie sollten, wenn möglich, mit einer leichten (immer noch kontrollierten) körperlichen Entspannung der Patientin verbunden sein. Eine Übung ist die vom »Inneren Helfer«, das Üben einer Imagination von einer hilfreichen Figur aus Märchen, Literatur, aus momentaner fantasievoller Eingabe, aus dem Film oder aus dem spirituellen Bereich. Eine zweite ist die Übung vom »Sicheren Ort« oder »Wohlfühl-Ort«. Die Patientin wird eingeladen, sich einen Ort vorzustellen, an dem sie sich ganz sicher fühlt. Sie darf so lange die Elemente dieses Ortes in der Vorstellung herumrücken, gestalten, austauschen, bis sie sich wirklich wohl und sicher fühlt (vgl. Reddemann 2001). Das funktioniert (mit Varianten) auch quer durch die Kulturen. Die Anhänger von C. G. Jung würden hier von einem »Archetyp« sprechen. Man darf die mit Entspannung verbundenen Imaginationsübungen mit TraumapatientInnen nicht zu früh machen. Sie können Angst auslösen, wenn die angespannte Aufmerksamkeit nach außen – als subjektiv sinnvolles Traumasymptom – noch gebraucht wird. Es sollten auch die Augen immer offen bleiben, weil sonst intrusive Bilder, »flash backs«, vom Trauma einschießen können. Ein mehrmaliges tieferes Ausatmen (Fischer 2003) kann hilfreich sein. Manchmal müssen wir auf die beliebten Übungen auch ganz verzichten. Fariba gefiel die Übung vom »Sicheren Ort« besonders gut. Da es in meinem Büro immer Malsachen und Zeichenblöcke gibt, lud ich sie ein, den vorgestellten Ort aufzumalen. Sie freute sich, weil sie lange nicht mehr gemalt hatte und das Bild recht gut gelang. Das erste Bild vom »Sicheren Ort« zeigte ein Haus mit einem Garten, in dem drei Kinder mit einem Ball spielten und eine Frau gerade aus der Haustür gekommen ist. Es gibt große Bäume und Vögel, die in den Himmel fliegen. Es ist wichtig, erklärt sie Shanaz und mir, dass man sich Geräusche dazu vorstellt. Vor allem das Rufen der Kinder, die »Modarjan« oder »Mamijan« rufen, die Zärtlichkeitsform für »Mutter« oder »Mami«. Sie rufen das aber nicht, weil sie Hilfe brauchen oder etwas wollen, sondern einfach aus Freude über die Situation. Fast alle Menschen aus islamischen Ländern, mit denen ich bisher gearbeitet habe, können kaum anders, als sich ihren »Sicheren Ort« im Kontakt mit Menschen vorzustellen, die ihnen lieb und wichtig sind. Die Akustik ist oft von Bedeutung. Macht man die Übung mit orientalischen Menschen, so kann man kaum dem Rat von Luise Reddemann folgen, möglichst keine realen Menschen oder Bekannten in den vorgestellten »Sicheren Ort« hereinzuholen, weil diese oft wieder als anstrengend oder enttäuschend erlebt werden könnten. Bei einer iranischen Patientin, die – wegen der politischen Betätigung ihrer Eltern – als Jugendliche mehrere Jahre im Gefängnis gesessen hatte und nun in einer schmutzigen, isolierten Flüchtlingspension auf das Ende des Asylverfahrens wartete, sah der »Sichere Ort« zum Beispiel so aus: Sie befindet sich mit Ehemann und Kind in einer hellen Wohnung mit geöffneten Fenstern mitten in einem belebten und geräuschvollen Stadviertel, das zwar europäisch ist, aber doch gewisse Ähnlichkeiten mit einem beliebten Viertel in Teheran hat. Bei Fariba war klar: Sie brauchte einen »Sicheren Ort«, vor allem auch für ihre Kinder. Ich gab ihr nach unserem ersten Versuch die Malsachen mit nach Hause. In den nächsten Wochen wunderten sich die Kinder erneut über ihre Mutter. Vorher hatten nur sie in der Schule und manchmal zu Hause Bilder gemalt. Jetzt malte die Mutter, und das kleine Familienzimmer war bald voll von ihren Produkten. Einige davon brachte sie mir wieder mit in die Therapie, wo ich sie bewunderte, mich aber jeder tiefenpsychologischen Deutung enthielt. Die Bilder ließ ich farbkopieren und durfte sie für mich behalten. Auf einem sieht man eine Frau, die ein Kind in einer Wiege hütet (wobei das Kind selbst hinter der Wand der Wiege nicht sichtbar ist). Um die zentrale Szene herum gibt es noch einen wolkigen Rahmen, der Abgeschlossenheit und Sicherheit für die beiden vermittelt. Es ist das, was Fariba an jenem furchtbaren Abend für sich und die Kinder, zu denen auch die ihr anvertraute junge Schwägerin zählte, am meisten gefehlt hatte. Nach ein paar Wochen änderten sich die Motive der Bilder. Beeindruckend war besonders ein Bild, auf dem links ein schwarzes Haus und rechts ein schwarzer, teilweise verdorrter oder verbrannter Baum zu sehen sind. Beide stehen aber auf einer Wiese, die ein schönes Grün hat, und vom Betrachter aus führt ein Weg über die Wiese auf eine aufgehende Sonne zu. Wir hatten zuvor über das Traurige und Zurückgelassene gesprochen. Das neue Bild machte auf mich den Eindruck, dass das Traurige nun eingebettet und besser abgegrenzt in einer Welt der Hoffnung und des Lichts war. Vielleicht war es nun Zeit, die traumatische Geschichte tiefergehend zu bearbeiten. Die Sonne ist in Afghanistan wie bei uns ein Symbol der Hoffnung und Wärme. Im Nachhinein könnte man sagen: Es zeigte sich so etwas wie eine erste »Gestaltbildung« um das Trauma herum. »Die traumatische Situation hat eine ›Gestalt‹, einen Umriss und eine Grenze gewonnen. Während der Patient zunächst in der Situation steckt, hat er nun eine gewisse Distanz dazu gewonnen und steht ihr gleichsam gegenüber.« (Reddemann und Fischer 2010, S. 268) Für die sogenannte »Traumaexposition« oder »Traumakonfrontation«, die gemeinsame und dosierte Rekonstruktion der Traumageschichte mit dem Ziel einer besseren Integration und Kontrolle der belastenden Gefühle und Erinnerungsbilder, wählte ich die »Bildschirmtechnik«. Es gibt noch andere Expositionstechniken: vom dosierten »co-narrativen« Erzählen der Ereignisse über das Zeichnen von Bilderfolgen und die anspruchsvolle »Beobachtertechnik« (Reddemann 2004, S. 158 ff.) bis hin zum berühmten »EMDR«, der Technik der gelenkten Augenbewegungen, auf die ich in einem späteren Kapitel eingehe. Wer die Bildschirmtechnik erfunden hat, ist nicht ganz klar, sie scheint in ihren verschiedenen Varianten aber recht wirksam zu ein (vgl. Gurris und Wenk-Ansohn 1997; Sachsse 2004; Reddemann 2004, S. 176 ff.). Auch Gottfried Fischer verwendet sie unter dem Namen »Videoübung« (kombiniert mit Rollenspiel) als Technik des »emotionalen Durcharbeitens« (Reddemann und Fischer 2010, S. 269). Man sitzt mit der Patientin vor einem vorgestellten Bildschirm, der an einer Wand des Arbeitsraumes sein kann, um sich den belastenden »Trauma-Film« – welcher die Patientin im Alltag immer wieder in einer fragmentierten, unkontrollierten Form überfällt – diesmal gemeinsam in einer kontrollierten und gegebenenfalls auch poetisch umgestalteten Form anzuschauen. Dazu haben wir eine »magische Fernbedienung«, mit der man den Film anhalten, vor- und zurückspulen, verlangsamen, farblich verändern usw. und auch nach einem neuen Skript ablaufen lassen kann. Man kann sich die magische Fernbedienung in der Hand der Patientin gemeinsam vorstellen oder auch durch einen Gegenstand symbolisieren. Man sollte die Filmerzählung mit einer noch sicheren Situation, vor dem Einbruch des Bedrohlichen, beginnen, und die Protagonistin, die Hauptdarstellerin sollte von sich zunächst in der dritten Person reden. Wenn es aufregend wird, kippen die meisten Patientinnen in die erste Person; es kann dann beruhigend oder distanzierend sein, auf Anregung des Therapeuten wieder in die dritte Person zurückzuwechseln. Man kann auch Pausen machen, in denen ein Schluck Tee oder Wasser getrunken wird. Und man sollte vorher einen »Sicheren Ort« in der Vorstellung gut installiert haben, zu dem man gemeinsam zurückgehen kann, wenn die Bilder der Traumageschichte zu belastend werden. Im Falle von Fariba schlug ich vor, zwei ihrer wunderbar gemalten »Sicheren Orte« als reale Bilder rechts und links neben den vorgestellten Bildschirm zu hängen. Damit war das Schreckliche gewissermaßen wie in einem »Triptychon« eingefasst. (Zum Triptychon in der Gestaltungstherapie vgl. Reddemann 2001, S. 125 ff.) Links neben Fariba saß ich, rechts daneben Shanaz, die übersetzte. Wir ließen den Film mit dem Nachmittag jenes schlimmen Tages in einem Vorort von Kabul beginnen. Erst war alles friedlich. Die Kinder spielten, Fariba war mit ihrer Schwägerin in der Küche. Dann die schrecklichen Ereignisse, die wir Schritt für Schritt unter Einbeziehung von scheinbar auch unwichtigen Details, nach denen ich fragte, rekonstruierten. Das Fragen nach Details dient u. a. dem Abbremsen einer unkontrollierten Überflutung mit schrecklichen Bildern und Gefühlen, welche mit der spontanen Traumaerzählung oder Traumaerinnerung zumeist verbunden ist. Die Gefühle des Schreckens, der Hilflosigkeit und Angst sind aber spürbar. Fariba zittert manchmal, bekommt schreckgeweitete Augen. Zwischendrin wünscht sie sich (entsprechend unserer früheren Absprache) Pausen, in denen der Film ausgeschaltet ist und in denen wir mit unserer Aufmerksamkeit zwischen den beiden Bildern vom »Sicheren Ort« hin- und herpendeln. Dann schafft sie es, wieder in den Film hineinzugehen und ihn zu Ende zu erzählen bis zu der Stelle, wo die Räuber wieder abgezogen sind und sich Fariba um die Verletzungen ihres Mannes und die tote Schwägerin kümmern konnte. Das war natürlich entsetzlich, aber Fariba hat irgendwie gehandelt. Die Schwägerin konnte allen Schwierigkeiten zum Trotz am nächsten Tag ordnungsgemäß beerdigt werden. Ich frage Fariba dann, ob sie nun den Film bis zu einer Stelle zurückspulen möchte, von welcher aus wir dann das Skript gemeinsam neu schreiben könnten. Dieses Umschreiben in Richtung auf eine für die Patientin passende »Wunschszene« kommt aus dem Psychodrama. Fariba sagt Ja und scheint auch gleich eine Idee zu haben, wie das neue Skript aussehen könnte. Wir gehen zurück bis zu der Stelle, wo die Räuber damit beginnen, gewaltsam die Tür aufzubrechen. Fariba hat nun ein funktionierendes Telefon und ruft eine Polizeiwache im Stadtviertel an. Bewaffnete Polizisten erscheinen innerhalb kurzer Zeit am Tatort und nehmen die Mitglieder der Pachmanenbande fest. Fariba kann sich sehr genau deren Gesichter vorstellen, in denen sich Schrecken, Angst und Hilflosigkeit abbilden. Diese Vorstellung tut ihr gut, sie muss sogar etwas lachen. Wir beenden hier die Bildschirmübung, spulen die Videokassette mit beiden Varianten zurück und gehen zur sogenannten »Tresorübung« über. Fariba wird eingeladen, sich vorzustellen, wie sie die Videokassette in einen Tresorraum bringt, wo auch andere Filme aus ihrem Leben gelagert sind, sie an einer bestimmten Stelle ablegt und wieder hinausgeht. »Sie hören, wie sich die Tür schließt, wie Sie den Schlüssel umdrehen ... Sie legen den Schlüssel an einen bestimmten Ort, den nur Sie kennen. Normalerweise bleibt die Kassette im Tresor. Nur dann, wenn Sie wollen, und nur dann holen Sie sich den Schlüssel und schauen sich die Kassette oder Teile daraus, die Sie interessieren, an ...« Diese Übung soll gegen das Überfallartige helfen, welches dem Traumfilm anhaftet. Nach dieser abschließenden imaginativen Übung war Fariba erschöpft, aber, wie sie sagte, erleichtert. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass einzelne Bilder aus dem Film in den nächsten Tagen vielleicht doch wiederkommen könnten. Wir würden dann die Bildschirmübung und die Tresorübung so lange wiederholen, bis das Belastungsgefühl für sie deutlich schwächer wird. Ganz am Ende der Stunde gab es einen harmlosen Small Talk über das Befinden von Faribas Kindern. In der Tat ist die Wiederholung der Bildschirmübung (oder auch einer anderen Form der Traumaexposition) in vielen Traumatherapien erforderlich. Man kann vor und nach jeder Bildschirmarbeit zusammen mit der Patientin die Schwere der empfundenen Belastung in Bezug zur Traumageschichte auf einer Skala von zehn bis null messen. Der Verhaltenstherapeut Wolpe hat einst die »SUD-Skala« eingeführt. (SUD steht für Subjective Units of Disturbance. 10 steht für die höchstmögliche Belastung, 0 wäre gar keine Belastung.) In meinem Uni-Arbeitszimmer nehme ich oft meine zehnbändige Sigmund-Freud-Studienausgabe oder zehn aufgestapelte Hefte der »Zeitschrift für Psychotraumatologie« als Skala und frage die PatientInnen, wie viele Bände ich nun wegnehmen soll, damit sich die momentan gespürte Belastung bzw. Erleichterung abbildet. Bei Fariba habe ich keine Skala verwendet. Und wir hatten das Glück, dass sie bereits bei unserem nächsten Treffen von einer starken Abschwächung der Symptome und ihrer psychischen Belastung berichtete. Etwas später hatte Fariba einen Traum, in welchem ihr ihre verstorbene Schwägerin erschien. Sie brachte Orangen zu Faribas Familie in die Flüchtlingsunterkunft. Fariba bekam von ihr eine Orange überreicht. Die Kinder und ihr Mann bekamen zwei. Ich hatte den Gedanken, dass es sich um einen wichtigen Schritt in Richtung auf eine Kontaktaufnahme oder innere Aussöhnung mit der Schwägerin handeln könnte, gleichzeitig kam mir aber auch in den Sinn, dass Fariba vielleicht noch eine gewisse »Überlebensschuld« gegenüber der umgekommenen jungen Frau empfinden würde. Die Überlebensschuld ist ein wichtiges Element oder Konstrukt in unseren traumatheoretischen Lehrbüchern, und sie kommt auch wirklich vor. Aber ich habe diese Spur damals nicht weiterverfolgt. Vielleicht war ich zu erschöpft, vielleicht war es aber auch nicht nötig. Immerhin wirkte Fariba bei ihrer Erzählung vom Traum nicht beunruhigt, sondern eher neugierig und erstaunt. Möglicherweise war die eine Orange bereits ein Symbol für den Beginn eines wichtigen Prozesses. Faribas Situation und Befinden beruhigten sich. Ein paar Wochen später kam uns im Zusammenhang mit Ereignissen in Faribas Flüchtlingsunterkunft gewissermaßen Therapeut Zufall zu Hilfe. In der Unterkunft war an einem Abend ein tschetschenischer Mann laut und fast gewalttätig geworden. Fariba bekam Angst um ihre Familie. Jemand rief die Polizei, die auch prompt kam und den Randalierer mitnahm, der davon offenbar so beeindruckt war, dass er sich beruhigte und am nächsten Tag wieder freikam. Ich war froh, dass unsere Polizei in diesem Fall so reagiert hatte, wie man es sich für ein zivilisiertes Land nur wünschen kann. Es ist oft so, dass die afghanischen Flüchtlinge in Bezug auf die (manchmal wirklich etwas impulsiven) tschetschenischen Mitbewohner ganz ähnliche Ängste erleben wie in Bezug auf die wilden und gewalttätigen Männer in ihrer Heimat, welche sie dort bedroht hatten. Bei Fariba beruhigten sich diese Ängste in der Folge so weit, dass sie sich mit einer tschetschenischen Frau anfreundete, die als Mutter ganz ähnliche Sorgen hatte wie sie selbst. Sie tauschten sich in der Küche und bei anderen Aktivitäten aus. Es kam Fariba zugute, dass sie einmal Russisch gelernt hatte, das ja (neben ihrer Muttersprache) auch die erwachsenen Tschetscheninnen und Tschetschenen gut beherrschen. Faribas Symptome klangen weiterhin ab, und zwar noch bevor sie den positiven Asylbescheid erhielt, der natürlich eine große Freude brachte. Fariba wollte die Therapie nach knapp einem Jahr beenden, weil ein alleinstehender afghanischer Mann, den sie gut kannte und sehr bedauerte, aus ihrer Sicht meine frei werdenden therapeutischen Kapazitäten nun viel dringender brauchen würde als sie. Zur Verabschiedung kamen auch ihre Kinder mit. Ich erhielt eine große Packung mit »Merci«-Pralinen, zu denen Faribas größere Tochter sorgenvoll anmerkte, davon würde der Professor nun aber wirklich zu dick, sowie ein schönes Hemd und eine passende Krawatte. Andreas Geschichte Andreas Geschichte handelt von Menschen aus einer anderen Kultur und in einem anderen therapeutischen Kontext. Die traumatherapeutische Arbeit mit ihr ergab sich in einem Gruppenprozess. Andrea nahm an einer Selbsterfahrungs- und Therapiegruppe teil, die etwas länger als ein Jahr dauerte, acht Frauen und einen Mann umfasste und in der vor allem mit der Methode des Psychodramas gearbeitet wurde. Alle zwei oder drei Wochen fuhr ich zu den mehrstündigen Gruppentreffen in ein benachbartes Land. Andrea kam vor einem Gruppentreffen zu mir und berichtete davon, dass sie sich seit dem letzten Treffen oft schlecht gefühlt habe. Das habe wohl mit der unsanften Landung auf dem Fußboden zu tun, die in der Szene passiert sei, wo sie im Spiel der Gruppenkollegin M. als Darstellerin von deren Mutter vom »Vater« umarmt worden sei. Sie habe von ihrer Verletzung in der Nachbesprechung des Spiels von M. nicht berichtet, weil sie M.'s Spiel und Vorstellung von einer stürmisch-verliebten Begegnung der Eltern nicht kaputt machen wollte. M. war über diese Szene im Rollenspiel und das neue Gefühl, »ein Kind der Liebe« zu sein, sehr glücklich gewesen, weil der Vater später mehr oder weniger verschwunden war. Andrea wusste auch jetzt nicht, ob es richtig sei, ihre Verstörung in die Gruppe einzubringen. Ich ermutigte sie, es zu tun. Vielleicht hätten wir dieses Mal eine Möglichkeit, ihre Verletzung besser zu verstehen. In der verbalen Befindlichkeitsrunde nach dem Start der Gruppe berichtete Andrea dann von ihrem Gefühl der Verletztheit. Was die anderen lustig gefunden hätten und was M. geholfen habe, habe sie wie einen sexuellen Übergriff erfahren. Und ihr seien in der Zeit danach sehr unangenehme Erinnerungen an einen sexuellen Übergriff durch einen Verwandten gekommen, den sie als Kind erlitten hatte. Für die Anwärmphase, die am Beginn jedes psychodramatischen Treffens steht, schlug ich den Gruppenmitgliedern die Imaginationsübung »Innerer Helfer« vor. Es war klar, dass die Gruppenmitglieder und vor allem Andrea etwas brauchen würden, das Unterstützung angesichts der angesprochenen Traumageschichte geben konnte. Die Ressourcen-Übung vom »Inneren Helfer« wurde oben, in Faribas Geschichte, schon kurz erwähnt. Die PatientInnen werden eingeladen, sich auf ihrem Sitz etwas zu entspannen, den Atem zu spüren und sich aus dem entstehenden angenehmen Körpergefühl heraus einen »Inneren Helfer« vorzustellen, der aber möglichst keine reale Figur, sondern eher märchenhaft und fantastisch sein soll. Im Falle unserer Psychodramagruppe kamen alle mit einer Helferfigur in Kontakt und wurden dann eingeladen, kurz darüber zu berichten. Andrea hatte sich einen schwarzen, pudelartigen Hund, groß wie ein Wolf, vorgestellt, der bei Bedarf Zähne zeigen und bedrohlich werden kann. Die Gruppe ist an der Geschichte von Andrea und der Idee, ihr zu helfen, sehr interessiert. Eine andere junge Frau deutet an, dass sie in der letzten Zeit öfters mit der vagen Erinnerung an einen Missbrauch beschäftigt sei. Für sie selbst sei es allerdings zu früh, sich damit intensiver zu befassen. Andrea war also von der Aufmerksamkeit der anderen gut gehalten. Mir kommt eine Inszenierung in den Sinn, die eine Kombination aus Psychodrama und der Bildschirmtechnik ist. Ich frage Andrea, ob sie sich das traumatische Ereignis von einem geschützten Platz aus und begleitet von unterstützenden Figuren auf einem vorgestellten Bildschirm anschauen und es dann vielleicht auch umgestalten möchte. Andrea riskiert es. Sie darf sich ein Gruppenmitglied als ihren großen Pudelwolf aussuchen und noch ein zweites als ein »Double« für sich, als eine »zweite Andrea« zur zusätzlichen Verstärkung. (Die Arbeit mit einem ichstärkenden Double ist im Psychodrama eine altvertraute Technik.) Die beiden gewählten Frauen übernehmen gern die Rollen. Jetzt sind sie schon zu dritt. Zwischen den beiden Helfe rinnen sitzt Andrea bequem mit Kissen auf dem Boden und mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Ein Holzbrettchen, das wir im Raum finden, dient als die fabelhafte Fernbedienung für einen Film, den wir uns gemeinsam auf der gegenüberliegenden Leinwand ansehen. Andrea wird gebeten, zunächst in der dritten Person und von einer noch sicheren Situation ausgehend zu berichten, wie sich die belastenden Ereignisse zugetragen haben. Andrea drückt auf die Fernbedienung, weiß, dass sie jederzeit unterbrechen, den Ablauf verändern kann, und beginnt zu erzählen. An manchen Stellen frage ich nach, und es entsteht eine Präzisierung: Andrea ist zehn oder elf. Wie jedes Jahr freut sie sich auf die Sommerferien, die sie allein bei den Großeltern in schöner Umgebung in der Nähe eines Flusses verbringen darf. Das ist besonders wichtig, weil es zu Hause schwierig ist, da der Vater die Familie verlassen hat und die Mutter mit den Kindern oft überfordert ist. Bei den Großeltern ist außerdem ein Onkel mit seiner Frau zu Besuch, der wie bereits öfters aus der Ferne zum Urlaubmachen gekommen ist. Andrea interessiert sich sehr für die Tiere auf dem kleinen Anwesen. Die Hündin, ein Pudel mischling, hat Junge bekommen, und der Onkel bietet Andrea an, die Jungen in der Scheune, wo sie noch ziemlich hilflos herumkrabbeln, zu besuchen, damit sie sie streicheln und mit ihnen spielen kann. In dieser Situation nähert sich der Mann dem Mädchen, und es kommt zum sexuellen Übergriff. Andrea muss den Übergriff nicht weiter beschreiben, wir gehen mit der Fernbedienung etwas nach vorne, und Andrea berichtet von der Situation danach. In den folgenden Tagen tat der Onkel, als sei nichts passiert. Andrea wurde von seiner Frau freundlich in das Gästezimmer eingeladen. Aber sie schämte sich furchtbar. Von da an waren ihr die Ferien bei den Großeltern verdorben. Andrea fährt verwirrt und traurig nach Hause. Sie kann niemandem von dem schlimmen Erlebnis erzählen. Auch ging sie später im Sommer nicht mehr zu den Großeltern, wo der Täter weiterhin jedes Jahr Ferien machte. Damit war ihr ein »Sicherer Ort« zum Wohlfühlen abhanden gekommen. Ich frage Andrea, ob sie sich vorstellen könne, mithilfe unserer Fernbedienung den Film noch einmal zurücklaufen zu lassen, um an der Stelle, wo für die junge Andrea Schlimmes passiert ist, die Geschichte zu verändern, dem Mädchen von damals als Erwachsene von heute die Hilfe zu schicken, die es gebraucht hätte. Andrea stellt sich nun vor, dass sie nach dem Übergriff mit dem Pudelwolf in die Scheune geht und beide den Onkel zur Rede stellen. Man sieht, dass die Pudelwolf-Darstellerin und Andreas Double innerlich richtig mitgehen, aber alle drei bleiben auf ihrem Platz gegenüber dem Bildschirm sitzen. Der Pudelwolf zeigt seine großen Zähne und bedroht den Onkel, der furchtbare Angst bekommt. Die große Andrea im »neuen Film« attackiert ihn verbal, er solle sich schämen für das, was er getan habe. Ich ermutige die zwischen ihren Helferinnen auf dem Boden sitzende Andrea, das ganz laut zu sagen: »Du bist ein gemeiner Mensch, du hast dich zu schämen, zu schämen ...!« Andrea wird laut und deutlich. Die Angst des Onkels wird immer größer, er packt seine Sachen, flüchtet mit seinem Auto und ward nie wieder gesehen. Allgemeines Aufatmen in der Gruppe. – Ich schlage Andrea noch die abschließende Tresorübung vor. Sie scheint eine Beruhigung zu bringen. Wir setzen uns gemeinsam in die Runde, um das Erlebte nachzubesprechen. Das ist die im Psychodrama und auch in anderen Gruppentherapien so wichtige »Integrationsphase«. Zuerst geht es um die »Rollenfeedbacks« der beiden Mitspielerinnen. Ihnen (dem »Pudelwolf« und dem Double von Andrea) hat es zunächst gefallen, bei Andrea zu sein, sie auch körperlich zu stützen und zu trösten. Und die Aggression gegen den Täter war sehr lustvoll gewesen. Im Gespräch wird betont, wie wichtig es war, das Gefühl der Scham dorthin zu schicken, wo es hingehört, nämlich zu dem Mann, der seine Missbrauchshandlung zu verantworten hat. Auf keinen Fall darf die Scham beim Kind, beim Opfer bleiben. – Alle Gruppenmitglieder geben Andrea ihr persönliches »Sharing«. Die junge Frau, die zu Beginn der Sitzung von einer vagen Missbrauchs-Erinnerung gesprochen hatte, berichtet, dass die vorgestellte Attacke und Klarstellung gegenüber dem Täter für sie sehr bewegend, aber irgendwie auch entlastend gewesen sei. M., deren Spiel Andreas Beunruhigung ausgelöst hatte, fühlt sich Andrea sehr nahe und spürt gleichzeitig, dass ihr Bild von der positiven Umarmung der Eltern von Andreas traumatischer Erinnerung nicht berührt ist. Andrea selbst sagt, dass sie sehr erleichtert sei. Erstens, weil sie die Geschichte zum erstenmal erzählt habe, und zweitens, weil alle in der Gruppe so reagiert hätten, dass sie sich überhaupt nicht habe schämen müssen. Das Gefühl der Scham, etwas Schmutziges getan zu haben, sei in der Tat in all den folgenden Jahren in ihr geblieben. Jetzt spüre sie deutlich, dass sie sich in keiner Weise zu schämen habe. Am Ende unserer Gruppentreffen, ein knappes Jahr nach jener Sitzung, wurden alle Teilnehmerinnen und unser männliches Gruppenmitglied im Zuge der Abschlussreflexion gebeten, sich zu erinnern und mitzuteilen, welches Spiel oder welche Szene aus dem gesamten Gruppenprozess für sie im Nachhinein die wichtigsten seien. Dazu sollte mit Farbstiften ein Bild gemalt werden. Andrea war auf ihrem Bild in Begleitung eines großen schwarzen Pudelwolfs mit beeindruckenden Zähnen vor einem Fernsehapparat zu sehen. Sie berichtete, dass die Wirkung ihres Spiels nachhaltig gewesen sei. Sie habe in Gruppen eigentlich immer ein diffuses Gefühl der Scham gehabt, dessen Ursprung ihr nicht klar gewesen sei. Daraus waren Rede- und Lernhemmungen entstanden. Diese seien nun ganz und gar verschwunden. Sie fühle sich in Gruppen, auch außerhalb der Psychodramagruppe, mittlerweile freier und sicherer. Das Kapitel des Missbrauchs schien für sie zunächst abgeschlossen.
Vorwort Das Anteilnehmen an extrem belastenden Erfahrungen hat in den letzten Jahren zugenommen, und das ist erfreulich. Das Bedürfnis, Schlimmes von sich fernzuhalten, um davon nicht "angesteckt" zu werden, ist ja verständlich. Denn vieles spricht inzwischen dafür, dass die meisten Menschen gar nicht anders können, als das Leiden anderer auch mitzufühlen. In der Beschäftigung mit traumatischen Lebenserfahrungen und deren Folgen scheint es jedoch eine unbewusste Hierarchie im öffentlichen Diskurs zu geben. Zunächst stoßen Naturkatastrophen und deren Folgen auf breites öffentliches Interesse, danach kommen, zumal in letzter Zeit, die Opfer von Gewalt und sexueller Gewalt in der Familie und im familiären Umfeld, siehe im Frühjahr 2010 die Anteilnahme der Öffentlichkeit an den Folgen von Traumatisierungen von Kindern in Schulen, Heimen etc. Doch wer weiß, auch unter Fachleuten, um das Grauen, das Menschen, die als Asylsuchende oder als hochbetagte Opfer des NS-Terrors zu uns kommen, erlitten haben? Wenn man bedenkt, dass Terrence des Prés wichtiges Buch "Der Überlebende Anatomie der Todeslager", das auf Englisch 1976 erschien, auf Deutsch erst im Jahr 2008 herauskam, so kommt man nicht umhin, eine Scheu und Vermeidungstendenzen im Umgang mit kollektiv zugefügtem Leid zu vermuten. Vielleicht weil die Opfer von staatlichem und politischem Terror uns an unsere Geschichte als Tätervolk erinnern? Umso wichtiger erscheint es mir, dass Klaus Ottomeyer und sein Team bei Aspis in Klagenfurt sich der Opfer staatlicher und politischer Gewalt annehmen, so wie es einige ähnlich ausgerichtete Beratungsstellen in Deutschland ebenfalls tun. Die Zahl dieser engagierten Kolleginnen und Kollegen ist nicht groß im Vergleich mit den vielen, die sich heute um Psychotraumata kümmern. Es könnte allerdings auch ihnen widerfahren, dass ein Mensch, der Opfer von Krieg, Vertreibung und Folter ist, in die Praxis kommt. Und dann werden sie sich vor die Herausforderung gestellt sehen, dass ihr Handwerkszeug zum Umgang mit den speziellen Traumafolgen bei Weitem nicht ausreicht. Das Buch von Klaus Ottomeyer fordert uns heraus, uns mit der Geschichte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert genauer zu befassen und zur Kenntnis zu nehmen, dass nicht weit entfernt von uns Menschen gequält und gefoltert werden. Klaus Ottomeyer zeigt, wie er und sein Team mit diesen Menschen arbeiten. Es wird deutlich, dass vieles gebraucht wird, vor allem aber mitfühlende Menschlichkeit und ein weit über das übliche professionelle Engagement hinausgehender Einsatz. Die Fallgeschichten in Klaus Ottomeyers Buch werden wohl kaum jemand kalt lassen. Ich habe mich immer wieder bei der Lektüre geschämt, eine Europäerin zu sein und Teil eines Systems, das alles tut, um Menschen mit diesen und ähnlichen Geschichten nicht die notwendige Fürsorge angedeihen zu lassen. Mit breitem psychoanalytischem Hintergrund und tiefem Verständnis für seine Patientinnen und Patienten gelingt es Klaus Ottomeyer, die Leserin und den Leser auf eine Reise in die innere und äußere Welt der Opfer mitzunehmen. Von ihm ist zu lernen, wie man den Opfern begegnen kann: als Mensch und als professionell handelnde Therapeutin. Das Buch vermittelt sowohl tiefenhermeneutisches wie sozialpsychologisches Wissen und Verstehen und zeigt, wie man dieses Wissen praktisch und kreativ umsetzen kann. Ich wünsche diesem Buch viele Leserinnen und Leser. Denn seine Lektüre hilft, schwer traumatisierten Menschen mit weit mehr als Technik zu begegnen. Luise Reddemann Wozu dieses Buch? Der Titel des vorliegenden Buches "Die Behandlung der Opfer" klingt zunächst mehrdeutig oder vielleicht auch anmaßend. Aber seine Mehrdeutigkeit ermöglicht es mir zu erklären, worum es mir geht. Es geht erstens darum zu zeigen, dass es möglich ist, Menschen, die traumatisiert sind, die großen Schrecken und tiefe Verzweiflung erlebt haben, mit den Mitteln der Psychotherapie zu behandeln; und dass
| Erscheint lt. Verlag | 6.5.2011 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Leben lernen ; 240 |
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Gewicht | 366 g |
| Einbandart | kartoniert |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Psychologie ► Traumatherapie |
| Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Psychiatrie / Psychotherapie | |
| Studium ► 2. Studienabschnitt (Klinik) ► Psychiatrie / Psychotherapie | |
| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |
| Schlagworte | Akuttrauma • Aspis • Asyl • Asylsuchende • Flüchtling • Gesundheitswissenschaft • Gewalt • Jugendhilfe • Kinderppsychotherapie • Migration • Misshandlung • Opfer • Psychiatrie • Psychologie • Psychologische Beratung • Psychologische Notfallseelsorge • Psychotherapie • Psychotraumatologie • retraumatisiert • Rettungswesen • Salutogenese • Sexueller Missbrauch • Sozialarbeit • Sozialpädagogik • Sozialpsychologie • Trauma • Traumaforschung • Traumaopfer • Trauma (psych.) • Trauma (Psychologie) • Traumatherapie • Traumatisiert |
| ISBN-10 | 3-608-89107-2 / 3608891072 |
| ISBN-13 | 978-3-608-89107-2 / 9783608891072 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich