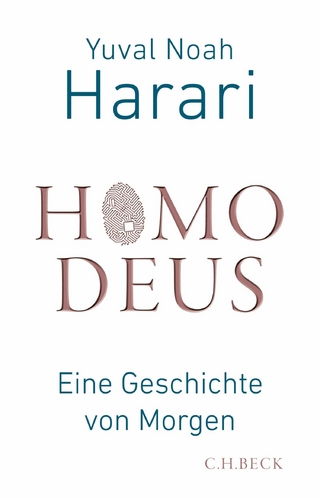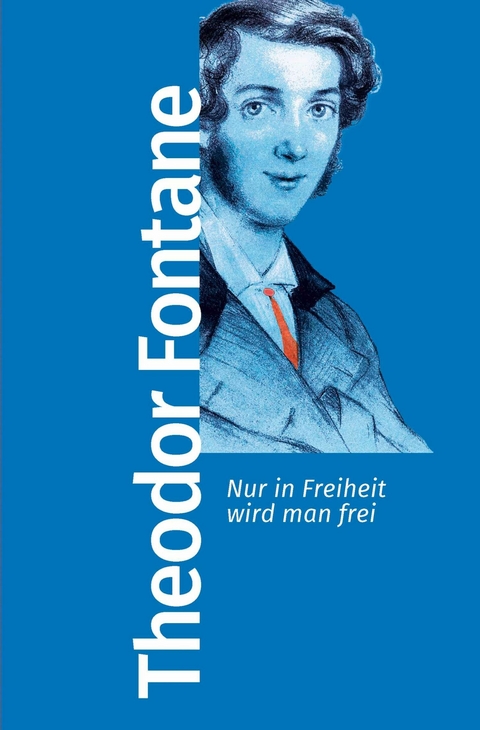
Nur in Freiheit wird man frei (eBook)
192 Seiten
Kiwi Bibliothek (Verlag)
9783462510027 (ISBN)
Dass Theodor Fontane heute den bekanntesten Schriftsteller*innen zuzuordnen ist, war zu seinen Lebzeiten lange nicht absehbar. Seine Hauptwerke, etwa »Irrungen und Wirrungen«, »Effi Briest« oder »Der Stechlin«, die ihn zu einem der bedeutendsten Vertreter des literarischen, poetischen "Realismus« machen, sind allesamt erst in späteren Lebensjahren entstanden.
Viel weniger bekannt ist der junge, der »politische« Fontane, dessen frühe Texte hier erstmals versammelt werden. Im Revolutionsjahr 1848 ist er ein glühender Vertreter der durch die Februar-Revolution in Paris auch in Deutschland enorm an Auftrieb gewinnenden demokratischen Kräfte. Überall in den deutschen Ländern gärt es, natürlich auch in Berlin, wo der 29-jährige inzwischen als Angestellter in der Apotheke »Zum schwarzen Adler« am Georgenkirchplatz arbeitet.
Mehr taumelnd als zielgerichtet gerät er in die am 18. März des Jahres ausbrechenden Gefechte und Barrikadenkämpfe. Im autobiografischen Eingangstext des zweiten Bandes der »Bibliothek der frühen Demokratinnen und Demokraten« schildert Fontane seine Erlebnisse der Revolution. Erstmals sind hier auch seine radikaldemokratischen Artikel aus den Jahren 1848 bis 1850, die er für die »Berliner Zeitungshalle« und als »Berlinkorrespondent« für die »Dresdner Zeitung« schrieb, sowie seine politische Korrespondenz versammelt.
Theodor Fontane (1819–1898) schrieb mit »Irrungen und Wirrungen«, »Effi Briest« oder »Der Stechlin« einst Werke, die zur Weltliteratur geworden sind, und gilt als bedeutendster Vertreter des literarischen »Realismus«. In jungen Jahren war er Teil der Märzrevolution 1848 in Berlin und publizierte radikaldemokratische Artikel. Iwan-Michelangelo D'Aprile, geboren1968, ist ein deutscher Historiker und Literaturwissenschaftler. Seit 2015 hat er an der Universität Potsdam die Professur für Kulturen der Aufklärung.
| Erscheint lt. Verlag | 9.2.2023 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Bibliothek der frühen Demokratinnen und Demokraten | Bibliothek der frühen Demokratinnen und Demokraten |
| Vorwort | Prof. Dr. Iwan-Michelangelo D'Aprile |
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik |
| Schlagworte | Anfänge der Demokratie • Berliner Zeitungshalle • Bibliothek der frühen Demokratinnen und Demokraten • Demokratiebewegung • Demokratische Legion • deutsche demokratie • Deutsche demokratische Gesellschaft • Deutsche Revolution • Fontane politische Texte • Fontane Texte • Frankfurter Nationalversammlung • Frankfurter Paulskirche • Nationalversammlung • Paulskirche |
| ISBN-13 | 9783462510027 / 9783462510027 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
E-Book Endkundennutzungsbedinungen des Verlages
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich