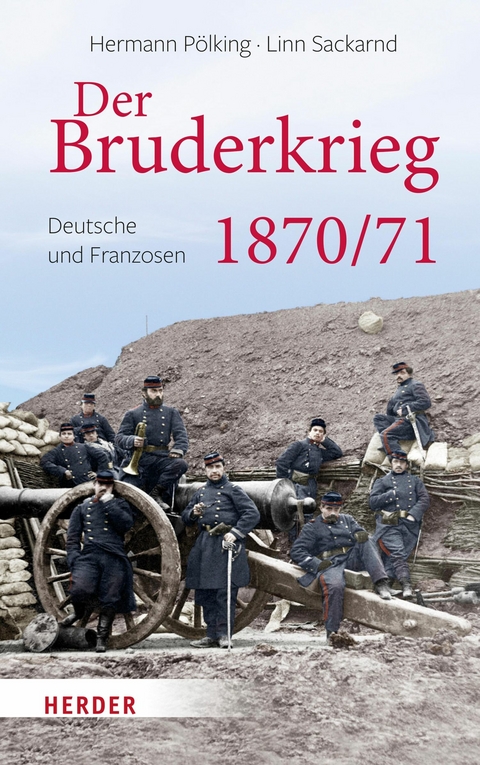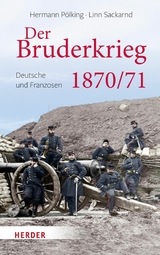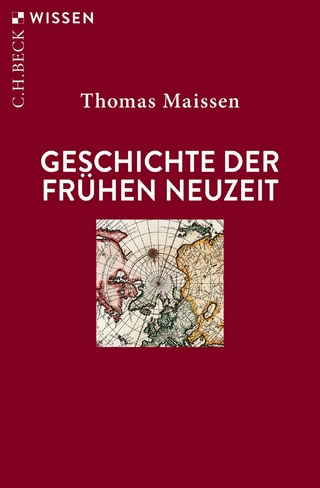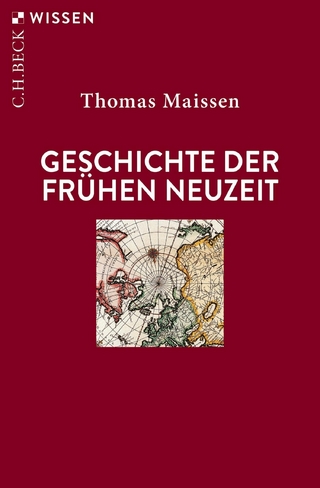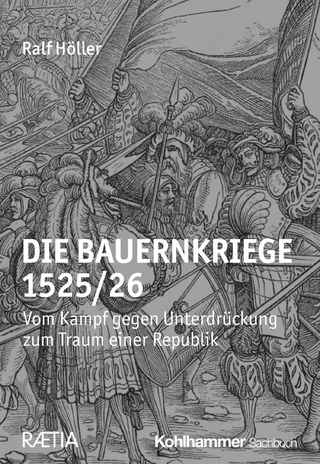Der Bruderkrieg (eBook)
640 Seiten
Verlag Herder GmbH
978-3-451-81942-1 (ISBN)
Hermann Pölking, geboren 1954, Studium der Publizistik; seit 1983 Lektor, Herausgeber und Autor von Büchern zu Technikgeschichte und Alltagskultur. Sein besonderes Interesse gilt der Geschichte deutscher Länder. Multimediale Projekte zur Geschichte, u. a. 'Die Deutschen 1815 bis heute' oder 'Wer war Hitler'. Linn Sackarnd, geboren 1978 in Münster, Studium der Frankreichwissenschaften, Diplom in europäischer Filmfinanzierung (INA/Sorbonne). Autorin, Dokumentarfilmregisseurin und Rechercheurin für historische Filmdokumentationen in Deutschland und Frankreich.
Hermann Pölking, geboren 1954, Studium der Publizistik; seit 1983 Lektor, Herausgeber und Autor von Büchern zu Technikgeschichte und Alltagskultur. Sein besonderes Interesse gilt der Geschichte deutscher Länder. Multimediale Projekte zur Geschichte, u. a. "Die Deutschen 1815 bis heute" oder "Wer war Hitler". Linn Sackarnd, geboren 1978 in Münster, Studium der Frankreichwissenschaften, Diplom in europäischer Filmfinanzierung (INA/Sorbonne). Autorin, Dokumentarfilmregisseurin und Rechercheurin für historische Filmdokumentationen in Deutschland und Frankreich.
ZEITVERSCHIEBUNGEN
Prolog
150 Jahre liegt der Beginn des Krieges von 1870/71 im Jahr 2020 zurück. Ist das wirklich eine lange Zeit? In persönlicher Erinnerung scheint es so. Wir kennen die Namen unserer Eltern und Großeltern, vielleicht noch die unserer Urgroßeltern. Aber schon bei den Mädchennamen der Urgroßmütter dürften die meisten passen. Die auf anthropologischen und statistischen Methoden beruhende Ahnenforschung geht heute davon aus, dass über den Zeitraum von 200 Jahren Menschen in der männlichen Linie im Durchschnitt sechs und in der weiblichen Linie sieben Generationen Vorfahren haben.1 Ein junger Mann aus Deutschland oder Frankreich, aus dem heutigen Algerien, Belgien, Dänemark, Italien, Litauen oder Polen, der 1870 in den Krieg zog und Nachkommen hinterlassen hat, ist also der Ur-ur-ur-großvater junger Menschen von heute. Eine junge Frau, deren Heimat 1870 verwüstet wurde, die ihren Verlobten in den Krieg ziehen und heimkehren sah, ihn kurze Zeit später heiratete und mit ihm eine Familie gründete, wäre heute vielleicht schon deren Ur-ur-ur-ur-großmutter. Zeitgeschichte ist »die Geschichte der Mitlebenden«. Sie reicht äußerst selten über ein Jahrhundert zurück. Aus der familiären Überlieferung dürften den meisten von uns unsere Vorfahren, die vor 15 Jahrzehnten gelebt haben, völlig unbekannt sein. Aber entlang individueller und familiärer Lebenslinien führt der Krieg, den sie in den Jahren 1870 und 1871 erlebt haben, bis weit ins 20. Jahrhundert und wirkt nach bis in unsere heutige Zeit.
Siebzehnhundertsiebenundneunzig – In Potsdam wird im Jahr 1797 August Graf von Dönhoff geboren – im selben Jahr wie Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen, der spätere preußische König und erste deutsche Kaiser. 1843 heiratet Graf Dönhoff, mittlerweile preußischer Diplomat und im Nebenberuf Großgrundbesitzer, Pauline von Lehndorff. Am 3. August 1870 schreibt Pauline Gräfin von Dönhoff geborene Lehndorff auf Schloss Friedrichstein, dem Familiensitz der Dönhoffs in Ostpreußen, 20 km östlich der Stadt Königsberg (heute Kaliningrad), einen Brief an ihre Schwägerin Anna Gräfin von Lehndorff. August, der erstgeborene Sohn der Dönhoffs, ist Major der preußischen Landwehr, also Offizier der Reserve. Der Zweitälteste, der 21-jährige Friedrich, ist Leutnant bei der preußischen Garde. »Meine geliebte Änny! Für zwei liebe Briefchen habe ich zu danken, die ich von Dir erhielt, seitdem die welterschütternden Ereignisse über uns hereingebrochen sind wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Als unser Fritzchen am 10. Juli zu Euch nach Steinort ging, lebten wir noch im tiefen Frieden, und schon am 16. kam die Mobilmachungs-Ordre, welche ihn zu seinem Regiment zurückrief, weil Frankreich uns den Krieg erklärt. Unser lieber Fritz konnte nicht einmal 24 Stunden hierbleiben, und August stürmte schon am 18. von Berlin fort nach Bonn in der Sorge, zu spät zu kommen. Wenn es in meiner Macht gestanden, so wäre ich gleich am 17. mit Fritz nach Berlin gegangen, um bis zum Augenblick des Ausmarsches bei meinen geliebten Söhnen zu sein, und es wäre mir ein unaussprechlicher Trost gewesen, noch mit ihnen vereint zum Heiligen Abendmahl zu gehen, vor ihrem Auszug zu dem blutigen Krieg. Mein Mann aber konnte sich nicht entschließen, mir die Reise zu gestatten, in der Meinung, dass wir uns nur gegenseitig den Abschied noch erschweren würden – und so musste ich mit blutendem Herzen darauf verzichten.«2 August und Fritz von Dönhoff ziehen im Sommer 1870 in den Kampf gegen Frankreich. Ihr Vater, August Graf von Dönhoff, hatte bereits im Jahr 1815 als 18-jähriger Freiwilliger unter Feldmarschall Leberecht von Blücher bei Ligny und Waterloo gekämpft. Er war unter den preußischen Soldaten gewesen, die am 7. Juli 1815 Paris besetzt hatten. Er starb im Jahr 1874 auf Schloss Friedrichstein. 35 Jahre später, im Jahr 1909, kommt dort seine Enkelin Marion Gräfin Dönhoff zur Welt. Sie ist das jüngste von acht Kindern seines erstgeborenen Sohnes August, der 1870 als Major der Reserve im Deutsch-Französischen Krieg gekämpft hat. Marion Gräfin Dönhoff stirbt im Jahr 2002 im Alter von 92 Jahren. Da ist sie in der deutschen Gesellschaft bereits eine Legende. Die spät zum Journalismus berufene war 30 Jahre Herausgeberin der Wochenzeitung »Die Zeit«, mit der sie ganz entscheidend das politische und geistige Leben der Bundesrepublik Deutschland beeinflusst hat, unter anderem die Aussöhnung mit Polen und Russland, auf deren Territorium der einst riesige Grundbesitz der Dönhoffs seit 1945 liegt. Die Dönhoffs sind allerdings eine Ausnahme. Nur drei Generationen – Marion Gräfin Dönhoff, ihr Vater und ihr Großvater – überspannen einen Zeitraum von 205 Jahren. In drei Generationen erleben sie die Napoleonischen Kriege, die innerdeutschen Kriege von 1848 und 1866, den Krieg von 1870/71, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg sowie den Kalten Krieg und dessen Ende.
Achtzehnhundertvierzehn – Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen ist 17 Jahre alt, als er am 31. März 1814 mit der siegreichen Koalitionsarmee in Paris einzieht. Sein Vater, Preußens König Friedrich Wilhelm III., hat ihn schon im Jahr 1807 zum Leutnant befördert. 1814 ist er bereits Hauptmann und hat im Februar 1814 bei Bar-sur-Aube erstmals im Feuer gestanden. Ein Jahr später führt der 18-Jährige – jetzt schon Major – das 1. Garderegiment nach Frankreich. Als es im Feindesland eintrifft, ist Napoleon I. beim belgischen Waterloo schon endgültig geschlagen. Wilhelm von Preußen ist 1814/15 das, was er immer wird sein wollen: Soldat. Einen Königsthron hat er zu dieser Zeit nicht zu erwarten. Denn er hat einen zwei Jahre älteren Bruder, den Kronprinzen Friedrich Wilhelm, der 1839 Preußens Thron besteigen wird, aber kinderlos bleibt. So beerbt Wilhelm von Preußen seinen älteren Bruder – nach dessen schwerer Krankheit 1858 zunächst als dessen Prinzregent, 1861 im Alter von 64 Jahren als König. Wilhelms einziger Sohn Friedrich Wilhelm ist damit Kronprinz. Dessen erstgeborener Sohn Wilhelm, der 1859 zur Welt kommt, ist genannt nach dem Großvater und darf erwarten, Vater und Großvater eines Tages nachzufolgen. Als der zwölfjährige Wilhelm am 18. Januar 1871, mitten im Krieg von 1870/71, an seinen Großvater einen Brief richtet, lockt ein neuer Titel, den er 17 Jahre später als Wilhelm II. selbst tragen wird. »Lieber Großpapa! Es sind in dieser Zeit so viele wunderbare Dinge passiert und so viele große Ereignisse vorgefallen, dass ich meine, Dir wohl einen Brief schreiben zu dürfen; besonders um Dir dafür zu danken, dass Du so gnädig gewesen, an mich zu denken und mir zu meinem Geburtstage zu gratulieren. So gratuliere ich Dir denn auch von Herzen und mit Ehrfurcht dazu, dass Du Deutscher Kaiser geworden bist, und ich hoffe, dass Du diese Würde noch lange Jahre bekleiden wirst. Ich jubelte vor Freude, als ich hörte, dass es so gekommen war. Man hatte mir erzählt, wie der König von Bayern Dir den Antrag gemacht, wie die übrigen Fürsten ihm beigestimmt hätten und wie Du dann zuletzt die Krone angenommen hättest. Es scheint nun ein großes Glück, dass Du Deutscher Kaiser geworden bist, denn jetzt sind alle kleinen deutschen Fürsten zu einem einzigen großen und mächtigen Staate verbunden. Jetzt ist endlich die kaiserlose Zeit vorbei und das Deutsche Reich einig.«3
Achtzehnhundertsechsundsechzig – Im August 1866 schreibt ein ehemaliger Kadett der Königlich Preußischen Hauptkadettenanstalt in Berlin, der sieben Monate zuvor im Alter von 18 Jahren als Leutnant in das preußische 3. Garderegiment zu Fuß in Danzig einberufen worden war, aus dem ersten Feldzug seines Lebens an seine Eltern in Westpreußen. Der junge preußische Leutnant ist kriegsbegeistert, auch wenn der Krieg ein Krieg unter Deutschen ist: »Es ist die höchste Zeit, dass die Hindenburgs mal wieder Pulver riechen. Unsere Familie ist darin leider seltsam vernachlässigt.« In Schlesien, Böhmen, Thüringen und Nordbayern kämpft Preußen im Jahr 1866 mit verbündeten deutschen Staaten gegen das Reich der Habsburger und dessen Alliierte, die sich auch als Deutsche verstehen. Nach dem Sieg Preußens über Österreich findet der kriegsbegeisterte Leutnant sich gestählt und begnadet für weitere Waffengänge. »Mein Ziel auf dem Kriegsfelde ist erreicht, das heißt ich habe Pulver gerochen, die Kugeln pfeifen gehört, alle Arten, Granaten, Kartätschen, Schrapnells, Gewehrkugeln, bin leicht verwundet worden, somit eine interessante Persönlichkeit, habe fünf Kanonen genommen etc. etc.!!!« Der Leutnant heißt Paul von Hindenburg. Schon drei Jahre später zieht er im Sommer 1870 erneut in einen Krieg, dieses Mal gegen Frankreich. Am 19. August 1870 schreibt er »auf dem Schlachtfeld« beim lothringischen Sainte-Marie-aux-Chênes an seine Eltern: »Im Anschluss an meine heute abgeschickte Karte wiederhole ich noch einmal, dass ich Gott Lob und Dank nur durch ein Wunder erhalten bin. Wir waren gestern sehr scharf im Gefecht und haben besonders beim Sturm auf Saint-Privat-la-Montagne ganz entsetzliche Verluste. … Was meine Ansicht über die Franzosen anbetrifft, so haben sie sich gestern mit enormer Bravour und Wut geschlagen«.4 In seinen Erinnerungen »Aus meinem Leben« berichtet Hindenburg 50 Jahre später über diese Schlacht bei Saint-Privat und Gravelotte. »Als ich spätabends die Reste unseres Bataillons zählte und dann am andern Morgen die noch viel schwächeren Trümmer der übrigen Teile meines Regimentes wiedersah, als die innere Abspannung eintrat, da kamen weichere Seiten menschlichen Gefühles zu ihrer Geltung. Man denkt dann nicht nur an das, was im Kampfe gewonnen wurde, sondern auch an das, was dieser Erfolg gekostet hat.«5 1920, als sein Buch erscheint, hat...
| Erscheint lt. Verlag | 10.8.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Neuzeit bis 1918 |
| Schlagworte | 1870/71 • Bismarck • Deutsches Reich • Deutsch-französischer Krieg • Einigungskrieg • Elsass-Lothringen • Emser Depesche • Kaiser Wilhelm • Napoleon • Preußen • Reichsgründung |
| ISBN-10 | 3-451-81942-2 / 3451819422 |
| ISBN-13 | 978-3-451-81942-1 / 9783451819421 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich