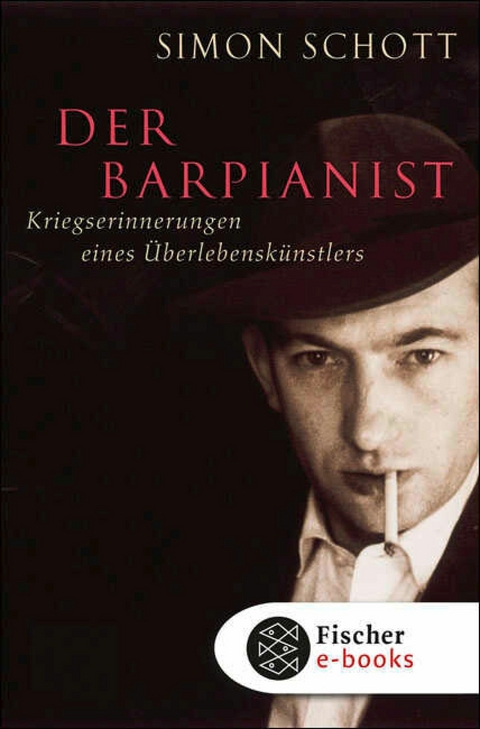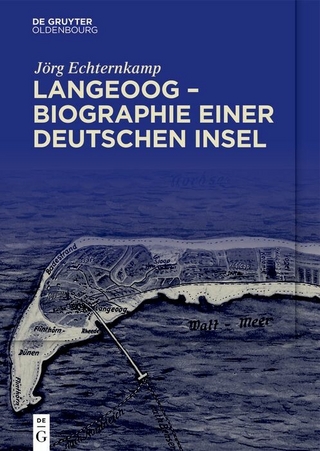Der Barpianist (eBook)
320 Seiten
S. Fischer Verlag GmbH
978-3-10-400257-6 (ISBN)
Simon Schott wurde 1917 geboren. Schon als Schüler liebte er Jazz. Klavierspielen lernte er »bei Ohr«. Nach dem Abitur wurde er sofort als Soldat eingezogen und nach Frankreich beordert. Als der Krieg vorbei war, blieb er in Paris und spielte viele Jahre lang Klavier in Harry's New York Bar. Simon Schott verstarb am 30.01.2010 in München.
Simon Schott wurde 1917 geboren. Schon als Schüler liebte er Jazz. Klavierspielen lernte er »bei Ohr«. Nach dem Abitur wurde er sofort als Soldat eingezogen und nach Frankreich beordert. Als der Krieg vorbei war, blieb er in Paris und spielte viele Jahre lang Klavier in Harry's New York Bar. Simon Schott verstarb am 30.01.2010 in München.
2. Kapitel
Tatsächlich rührte sich der Zug irgendwann nicht mehr von der Stelle. Als der Morgen dämmerte und in der ländlichen Umgebung die Vögel zu singen begannen, mussten alle die Waggons räumen. Ich ging ein paar Schritte in eine Wiese hinein, um mich von dem Haufen Landsern abzusetzen, die ein wenig ratlos auf der kleinen Bahnstation herumstanden. Nachdem ich eine Bodenwelle hinter mir gelassen hatte und der Bahnhof außer Sicht war, legte ich mich ins Gras und hörte dem munteren Vogelgesang zu. Dazwischen lauschte ich aufmerksam in die Ferne. Doch die Artillerie schien im Augenblick zu schweigen. Irgendwie berührte mich das fröhliche Gezwitscher der Vögel, die dankbar die aufgehende Sonne begrüßten, indes der Mensch eifrig und höchst erfindungsreich mit der Vernichtung anderer, ihm völlig unbekannter Menschen beschäftigt war, die ihm nicht das Geringste getan hatten.
Nach einer Weile zog ich meinen Marschbefehl aus der Tasche und studierte ihn. Der Ort, in dem sich meine Einheit im Augenblick aufzuhalten schien und zu dem ich in Marsch gesetzt worden war, hieß Bastogne und befand sich in Belgien. Ich musste also zusehen, dass ich irgendwie dorthin kam. War ich schon in Belgien? Oder war das hier noch Luxemburg? Wie dem auch sei, am logischsten schien mir, weiter die Bahngleise entlangzumarschieren, denn der Zug wäre ja in diese Richtung gefahren.
So spazierte ich denn neben dem Bahndamm die Wiesen entlang, wobei mehrere Stunden vergingen, in denen ich zwar einer Menge Kühe, aber keinem einzigen Menschen begegnete. Ich quälte mich nicht ab, sondern machte Pausen, nahm die Landschaft in Augenschein oder legte mich ins Gras, um die Federwölkchen am blauen Frühlingshimmel zu studieren. Ich hatte ja keine Eile und auch kein Gepäck zu schleppen. Der Krieg würde mir nicht davonlaufen. Da die Sonne bereits in Mittagshöhe stand, zog ich meine Dienstmütze über die Augen und hielt im Gras ein Schläfchen.
Ich träumte irgendetwas Angenehmes, aber Verworrenes, und wachte von stoßweise abgegebenen Maschinengewehrsalven auf. Wenige hundert Meter über mir verfolgten sich zwei Kampfflugzeuge in kurven- und trickreichem Aufwärtsflug und verschwanden schließlich in einem weißen Wolkenband am westlichen Horizont. Nun vernahm ich auch viel deutlicher als in der Nacht aus der gleichen Richtung das grollende Wummern von schweren Geschützen und als Antwort den hohlen, gedämpften Donner der gegenüberliegenden Artillerie. Dort hinten wütete also tatsächlich der Krieg.
Ich stand auf, klopfte die Grashalme von meiner Uniform und machte mich wieder auf den Weg in Richtung Front. Ich fühlte tiefe Dankbarkeit gegenüber meinen Sternen, die mir durch die unverhoffte Reise zu meinen Eltern einen behutsamen, sanften Einstieg in den wirklichen Krieg bereitet hatten. Ich konnte mir das Durcheinander und die nächtliche Hektik unserer Kompanie in Koblenz lebhaft vorstellen, die bangen Gefühle beim Abmarsch der Fahrzeuge zur Front und den Schock des ersten Kontakts mit dem Feind und dem überall lauernden Tod. Ich dagegen schlenderte guten Mutes gemächlich und unbeschwert über blühende Wiesen in Richtung Krieg. Mit der sicheren Empfindung, dass ich stets beschützt sein würde, was immer auch geschehen mochte!
Ja, ich konnte mir beinahe vorstellen, von da oben als einer der Ihrigen beauftragt zu sein, dieses Völkermorden aus nächster Nähe zu beobachten. Sozusagen als kosmischer Kriegsberichterstatter mit der kniffligen Aufgabe und der Verpflichtung, den Krieg zu überleben, ohne selbst jemanden zu töten! Vielleicht hatte ich sogar die Mission zu erfüllen, später ein Buch darüber zu schreiben und so ein Quäntchen dazu beizutragen, dass der angeblich intelligenzbegabten Spezies Homo sapiens einmal ihre brutale Primitivität vor Augen gehalten wird.
Wenn es im Augenblick auch allein Hitler war, der mit deutscher Präzision und Gründlichkeit das Metier der Vernichtung ausübte, so durfte man nicht ganz vergessen, wie emsig seit Tausenden von Jahren das grausame Handwerk des Krieges auch von fast allen anderen Völkern betrieben worden war.
Diese und ähnliche Gedanken gingen mir durch den Kopf, während ich den Gleisen folgend Kilometer um Kilometer zurücklegte. An einem nahen Kirchturm schlug es bereits drei Uhr, doch ich fühlte mich nicht müde. Von irgendwoher kam ein Fußweg, lief den Bahndamm entlang und bog in Richtung Ortschaft ein. Zwei Häuser waren von Geschützen getroffen und eingestürzt und die Bevölkerung anscheinend geflüchtet, denn ich sah keinen Menschen.
Plötzlich hörte ich Motorengeräusch. Ein Jeep kam aus einer Scheune geschossen, näherte sich auf einem holprigen Weg, eine lange Staubwolke hinter sich herziehend, und hielt abrupt vor mir. Ein Leutnant sprang heraus und bellte:
»Mann, Sie sind wohl von allen guten Geistern verlassen! Verschwinden Sie schleunigst von der Straße! Los! Steigen Sie ein!«
»Was ist denn los?«, fragte ich ärgerlich, während ich auf den Rücksitz kletterte.
Aber ich bekam keine Antwort, weil der Jeep eine derart wilde Kehrtwendung hinlegte, dass ich mich festhalten musste, um nicht hinauszufliegen. Er raste den Holperweg zurück und durch das offene Tor in die riesige Scheune. Zwei Soldaten in Stahlhelm und Marschausrüstung machten sofort das Tor zu, sodass ich im Halbdunkel nicht genau erkennen konnte, was hier gespielt wurde. Als ich aus dem Jeep kletterte, empfing mich ein starkes Gelächter von circa dreißig Mann. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, warum sie mich auslachten. Ich fand das gar nicht lustig und sagte ohne den geringsten Respekt zum Leutnant, der auch aus dem Wagen gestiegen war: »Vielleicht ist hier jemand in der Lage, ein Wort der Erklärung abzugeben?«
»Zuerst werden Sie eine Erklärung abgeben müssen!«, entgegnete der Leutnant scharf. »Wer sind Sie, und was haben Sie hier im Kriegsgebiet ohne Stahlhelm und Marschausrüstung zu tun? Spazieren da in Ausgehuniform über die Wiese, legen sich ins Gras und halten ein Mittagsschläfchen! Sagen Sie mal, sind Sie total verrückt? Ich kann Sie nicht einmal für einen feindlichen Spion halten und erschießen, denn so saublöd dürfte der ja wohl nicht sein!« Er schüttelte den Kopf und setzte hinzu: »Zeigen Sie Ihren Wehrpass und erklären Sie, was Sie hier zu suchen haben!«
Ich zog das Wehrpassheft und meinen Marschbefehl aus der Brusttasche und meinte ironisch: »Wie Sie sehen, komme ich aus dem Urlaub, wo’s weder Stahlhelme noch Marschausrüstung zu kaufen gibt. War zwei Tage unterwegs, und um vier Uhr morgens blieb dreißig Kilometer von hier mein Zug stehen. Seitdem latsche ich mir die Flossen wund, um zu meiner Einheit zu kommen. Und es würde mich brennend interessieren, woher Sie wissen, dass ich mich fünf Kilometer von hier ins Gras gelegt habe?«
Er deutete mit dem Kopf zum Scheunendach. Dann gab er mir meine Papiere zurück und sagte: »Na, gut. Sie bleiben hier und rühren sich nicht von der Stelle.«
Ich blickte zum Dachgebälk hoch und sah, dass dort oben zwei Mann mit schweren Feldstechern durch eine Luke in die Umgebung spähten. Die waren also seit Stunden damit beschäftigt zu beobachten, wie ich unsoldatisch lässig in Ausgehuniform durch die Gegend schlenderte, wie ich inmitten von Löwenzahn ein Schläfchen hielt und, nachdem ich aufgewacht war, an den Bahndamm pinkelte. Sicher hatten sie laut nach unten gemeldet, was ich gerade machte. Deshalb das Gelächter bei meinem Eintreffen.
Aber völlig klar war mir die Sachlage immer noch nicht. Das wurde sie erst, als sich meine Augen besser an das Halbdunkel gewöhnten und ich erkannte, was hier eigentlich los war: Die ganze riesige Scheune war von unten bis oben mit schwerer Geschützmunition vollgepackt, Stapel auf Stapel von hochexplosiven Mammutgranaten!
»Vielleicht kapieren Sie inzwischen, was das hier ist?«, meinte der Leutnant eine Spur freundlicher. »Das streng geheime Munitionsdepot unserer Artillerie! Wir können nur nachts aus dem Bau, um das Zeug nach vorn zu bringen, weil es da oben von feindlichen Aufklärungsflugzeugen wimmelt, die uns seit Tagen suchen. Sobald die wissen, wo wir sind, jagen sie uns mit dem ganzen Zeug in die Luft.«
Jetzt verstand ich auch, weshalb keine Menschenseele in dem Dorf geblieben war. Dies sollte meine erste Lektion in puncto Krieg und Überleben sein: Hüte dich vor der Stille! Denn je verlassener eine Gegend zu sein scheint, desto gefährlicher ist sie!
»Darf ich mich wenigstens irgendwo hinsetzen, bis es Nacht wird?«, fragte ich den Leutnant. »Und vielleicht kann mir dann noch jemand sagen, wo Bastogne liegt und wie ich da hinkomme?«
Der Leutnant winkte mit einer Kopfbewegung einen seiner Unteroffiziere herbei, der mich in einen Holzverschlag führte, in dem zwei Tische und einige Stühle standen. Während ich es mir bequem machte, holte der Kamerad einen Laib Kommissbrot, eine offene Dose Streichwurst und eine Kanne Malzkaffee heran und schenkte mir seinen blechernen Feldbecher voll.
»Wann hast du denn den letzten Fraß bekommen?«, fragte er.
»Vorgestern Abend.«
»Hm, dann war’s ja doch ein ganz schöner Schlauch. Leg dich auf die Stühle und penn dich aus, bis es dunkel wird. Wir fahren um zehn Uhr los und nehmen dich mit.«
»Kommt ihr denn an Bastogne vorbei?«, erkundigte ich mich.
»Jaja. Ziemlich in der Nähe.«
Ich langte tüchtig zu. Wer wirklich hungrig ist, dem schmeckt fast alles. Anschließend versuchte ich krampf haft, auf drei zusammengestellten Stühlen liegend einzuschlafen. Aber anscheinend war ich noch zu versnobt, um das fertigzubringen. So setzte ich mich auf und legte den Kopf auf die Tischplatte.
Ich merkte, dass für die Mannschaft offenbar Redeverbot herrschte, denn ich vernahm...
| Erscheint lt. Verlag | 5.10.2009 |
|---|---|
| Verlagsort | Frankfurt am Main |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |
| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► 1918 bis 1945 | |
| Schlagworte | Autobiographie • Besatzung • Bretagne • Erinnerung • Frankreich • Gestapo • Nachkriegsjahre • Normandie • Paris • Peter Ruhstorfer • Pianist • résistance • Sachbuch • Stahlhelm • Wehrmacht • Zweiter Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-10-400257-6 / 3104002576 |
| ISBN-13 | 978-3-10-400257-6 / 9783104002576 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 813 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich