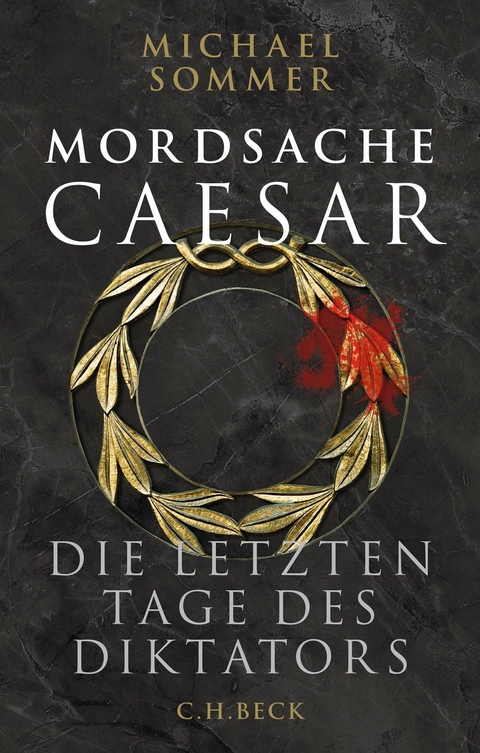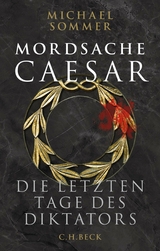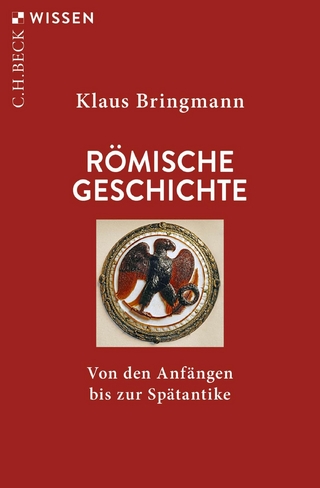Mordsache Caesar (eBook)
323 Seiten
Verlag C.H.Beck
978-3-406-82134-9 (ISBN)
MICHAEL SOMMER ist Professor für Alte Geschichte an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. <br>
Vorbemerkung
des Historikers
Am 15. März 44 v. Chr. vormittags gegen 11.30 Uhr wurde Gaius Julius Caesar, Diktator und römischer Bürger, während der Senatssitzung in der Curia Pompeia auf dem Marsfeld getötet. Der Tat dringend verdächtigt werden Marcus Junius Brutus, Gaius Cassius Longinus, Decimus Junius Brutus, Gaius Trebonius und etwa 60 weitere Männer, ausnahmslos römische Senatoren. Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben oder Informationen über die Planung des Anschlags haben, werden gebeten, sich zu melden.
Wie schreibt man die Geschichte eines historischen Kriminalfalls? Eines Mordes, der über 2000 Jahre zurückliegt und dessen Drahtzieher wir obendrein genau kennen? Das klassische Whodunnit im Stil von Arthur Conan Doyle oder Agatha Christie scheidet jedenfalls als Genre aus. Niemand interessiert sich für eine Mordsache, wenn der Täter von vornherein feststeht. Und bei Caesar wissen wir ja ganz genau, dass die beiden Bruti, Cassius und noch ein paar andere ihn auf dem Gewissen haben. Ist Caesars Ermordung also der falsche Stoff für eine historische Kriminalerzählung?
Keineswegs. Die Aufklärung eines Verbrechens erschöpft sich schließlich nicht in der Feststellung der Delinquenten und ihrer Personalien. An einem Kriminalfall hängt so viel mehr als die Ermittlung des Täters: der Hergang der Tat, die Umstände, das Milieu, die Hintergründe, die Vorgeschichte, das Motiv. Vor allem das Motiv. Warum musste Caesar sterben? Weil er selbst ein Verbrecher war und die Republik auf dem Gewissen hatte? Oder weil er dem grenzenlosen Ehrgeiz der Mörder im Weg stand? Wurden die Täter von Rachedurst getrieben? Handelten sie aus Gemeinsinn? Verfolgten die sechzig Männer alle dasselbe Ziel? Wohl eher nicht. Sie waren alle Individuen, mit eigener Agenda, eigenen Zielen und ihrem je eigenen Verhältnis zu Caesar. Unter den Sechzig waren eingefleischte Gegner des Diktators. Aber auch manche seiner engsten Freunde.
Caesar war kein gewöhnliches Mordopfer. Als er starb, war er Diktator auf Lebenszeit, de facto Alleinherrscher über eine Republik, die schon keine mehr war, in der aber auch keine alleinigen Machthaber vorgesehen waren. Für viele war Caesar ein Hoffnungsträger, eine Lichtgestalt. Für andere war er ein Tyrann. Die Mordsache Caesar ist ein politischer Kriminalfall. Ohne gründliche Kenntnis des politischen Koordinatensystems, in dem die Beteiligten agierten, bleibt sie unverständlich. Wer wissen will, warum Caesar sterben musste, muss zuerst begreifen, was die römische Republik in ihrem Innersten zusammenhielt – und was sie schließlich auseinanderfallen ließ. Um das zu erklären, muss man weit ausholen.
Die Geschichte von Caesars Ermordung beginnt 400 Jahre vor seiner Geburt, mit der Gründung der Republik. Spätere Generationen hatten nur noch eine vage Vorstellung von dem, was damals, um 500 v. Chr., geschehen war. Sie stellten sich ihren letzten König, Tarquinius Superbus, als grausamen Tyrannen vor. Lucius Junius Brutus war der Mann, der ihn stürzte und aus Rom vertrieb. Er trug denselben Familiennamen wie der spätere Caesarmörder Marcus Junius Brutus. Das war Zufall – und doch wieder auch nicht. Nichts geschah in der römischen Geschichte ganz zufällig. Das historische Gedächtnis war lang, und die Ahnen schwebten wirkungsmächtig über allem, was bedeutende Römer an großen Taten vollbrachten. Der Mythos vom Sturz des letzten Königs war eine Geschichte, welche die Republik mit großer Resilienz wappnete, wie man heute sagen würde. Resilienz gegen Tyrannen, Resilienz gegen Einzelne, die zu stark wurden. Der Resilienzvorrat der Republik hielt bis in die Generation Caesars. Dann war er verbraucht.
Wer den Mord verstehen will, muss das Opfer kennen, muss wissen, warum Caesar sich an entscheidenden Stellen seines Lebensweges so entschied, wie er es tat. Als er sich 60 v. Chr. mit Pompeius und Crassus zusammentat, um das freie, republikanische Spiel der Kräfte auszuhebeln. Als er 49 v. Chr. den Rubikon überschritt und damit einen Bürgerkrieg entfesselte. Und als er nach gewonnenem Bürgerkrieg die Gegner nicht mit Hass und Rache verfolgte, sondern mit demonstrativer Milde versuchte, sie in den neuen Staat zu integrieren. Clementia hieß das Zauberwort. Es war die Tugend eines Königs. Man muss die Kluft, die zwischen der alten Republik und dem neuen, von Caesar geschaffenen Staat lag, in ihrer ganzen Tiefe ausmessen, um zu begreifen, warum dieser Mann so vielen ein Dorn im Auge war. Wer Ehrgeiz und Ansehen hatte, sich als Vertreter einer jahrhundertealten Leistungselite verstand, für den stellte Caesar eine Provokation dar. Man fühlte sich herausgefordert, weil nun der Diktator darüber entschied, was Leistung war und wer Karriere machte. Weil er Loyalität belohnen und Untreue bestrafen konnte.
Deshalb haben die letzten Tage des Diktators eine lange Vorgeschichte. Die Mordsache Caesar reicht bis in die ersten Tage der Republik und tief in die Biographie des Opfers zurück. Der Ermittler muss ein Bild von Caesars Persönlichkeit gewinnen und in das Milieu eindringen, in dem in Rom Politik gemacht wurde. In der Diktatur, nach Caesars Sieg über Pompeius, findet er erste Indizien. Sie deuten an, dass sich gegen den Machthaber etwas zusammenbraute. Zuerst sind es vage Anhaltspunkte: Stimmungen, Gesten, Gesprächsfetzen. Dann, in Caesars letztem Winter, gewinnt die Verschwörung Konturen. Immer klarer zeichnet sich die Gruppe um Cassius und Brutus ab, immer mehr Zulauf erhält sie, immer entschiedener verfolgt sie ihr Ziel, den Diktator aus dem Weg zu räumen.
Der historische Ermittler kann sich nicht auf viele Indizien stützen. Erhalten sind nur ein paar Briefe, die Caesarmörder wie Brutus, Cassius und Trebonius geschrieben haben, meist an Cicero, und in denen sie sich, wenn überhaupt, dann nur zwischen den Zeilen über ihre Pläne äußern. Schließlich las der Feind womöglich mit. Der Ermittler ist also auf Zeugenaussagen angewiesen. Sie stammen von Gewährsleuten, die allesamt ein Glaubwürdigkeitsproblem haben. Oft schildern sie ihre eigene Version der Ereignisse, weil sie voreingenommen sind: gegen Caesar, wie Cicero, der Zeitgenosse und genaue Beobachter der römischen Politik; oder für ihn, wie die meisten, die erst zur Feder griffen, nachdem sich Augustus, Caesars Adoptivsohn, im Spiel um die Macht durchgesetzt hatte. Manche Zeugen wollen mit ihrem Bericht in erster Linie unterhalten, einer – Plutarch – ist hauptsächlich an der Moral der Akteure interessiert. Keiner der Zeugen war bei der Tat oder ihrer Vorbereitung dabei: Cicero gehörte nicht zur Verschwörung, und Zeitzeugen wie Nikolaos von Damaskus waren zur fraglichen Zeit nicht in Rom. Andere Gewährsleute, wie Velleius Paterculus, schrieben eine Generation später und wieder andere – Appian, Cassius Dio und wiederum Plutarch – sogar erst Jahrhunderte nach den Ereignissen. Woher also hatten sie ihr Wissen?
Der Ermittler muss Schneisen ins Dickicht der Überlieferung schlagen. Er muss Widersprüche aufdecken und Plausibilitäten gegeneinander abwägen. Er hat damit zu kämpfen, dass die römische Geschichtsschreibung, der er einen Großteil seiner Zeugnisse verdankt, einen besonderen Wahrheitsbegriff pflegte. Ihre Auffassung von Wahrheit weicht fundamental von der moderner Historiker ab. Die Autoren der Antike machten ihren Stoff der Rhetorik gefügig: Ein gut unterhaltender, dramaturgisch brillant gestalteter und mit Stilfiguren auftrumpfender Text war allemal besser als das dröge Referieren von Fakten. Um die Geschichte hinter den Geschichten rekonstruieren zu können, muss der Ermittler zu Theorien greifen und sich Modelle zurechtlegen. Passt das, was an Tatsachen vor uns liegt, dort hinein? Oder brauchen wir eine neue Theorie? Ohne Deutungsrahmen lässt sich den spärlichen Fakten kein Sinn abringen.
War Caesar ein Tyrann und waren seine Mörder Befreier? Oder waren Brutus und Cassius eiskalte Killer, die einen politischen Visionär um persönlicher Vorteile willen umbrachten? Diese Frage wird der Ermittler in seinem Bericht letzten Endes unbeantwortet lassen. Der Leser möge sich selbst ein Urteil bilden. Es ist nicht Aufgabe des Ermittlers, die politische Lebensleistung Caesars zu bewerten. Er kann auch kein Richter über die Mörder und ihre Moral sein. Er versucht, ihre Motive freizulegen und ihr Handeln zu erklären. Wie man die Motive bewertet, steht und fällt mit der Frage, ob man das Urteil der Mörder über ihr Opfer teilt....
| Erscheint lt. Verlag | 19.9.2024 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Vor- und Frühgeschichte / Antike | |
| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Altertum / Antike | |
| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |
| Schlagworte | Akteure • Antike • Attentat • Diktator • Diktatur • Gaius Julius Caesar • Geschichte • Iden des März • Kriminalgeschichte • Mord • Mörder • Motive • Rom • Römisches Reich • Senatssitzung • Tyrannenmord • Verschwörung |
| ISBN-10 | 3-406-82134-0 / 3406821340 |
| ISBN-13 | 978-3-406-82134-9 / 9783406821349 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich