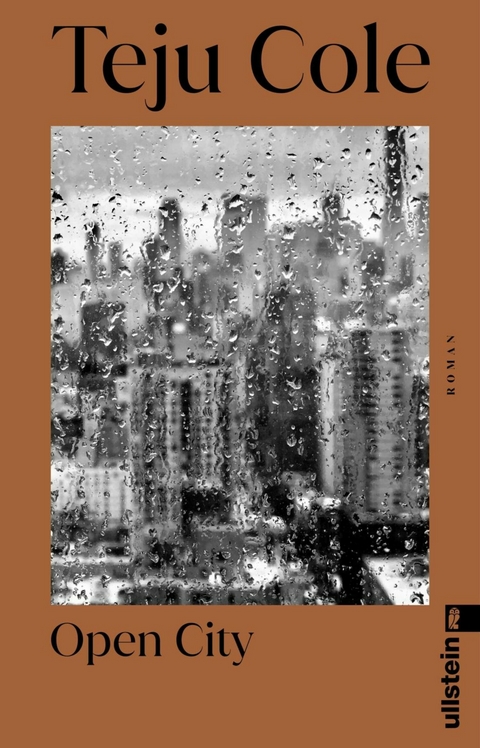Open City (eBook)
430 Seiten
Ullstein (Verlag)
978-3-8437-3119-5 (ISBN)
Teju Cole, geboren 1975, wuchs in Lagos auf. Er ist Schriftsteller, Kritiker, Kurator und Fotograf. Für seine Bücher, darunter der Roman Open City, erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem den PEN/Hemingway Award, den New York City Book Award, den Windham Campbell Prize und den Internationalen Literaturpreis. Teju Cole ist derzeit Professor für Kreatives Schreiben an der Harvard University. Er lebt in Cambridge, Massachusetts.
Teju Cole, geboren 1975, wuchs in Lagos auf. Er ist Schriftsteller, Kritiker, Kurator und Fotograf. Für seine Bücher, darunter der Roman Open City, erhielt er zahlreiche Preise, unter anderem den PEN/Hemingway Award, den New York City Book Award, den Windham Campbell Prize und den Internationalen Literaturpreis. Teju Cole ist derzeit Professor für Kreatives Schreiben an der Harvard University. Er lebt in Cambridge, Massachusetts.
1
Als ich also im vergangenen Herbst begann, abendliche Streifzüge durch die Stadt zu unternehmen, erwies sich Morningside Heights als guter Ausgangspunkt. Der Weg, der ausgehend von der Cathedral of St. John the Divine den Morningside Park durchquert, führt in nur fünfzehn Minuten zum Central Park. In die andere Richtung, nach Westen, sind es ungefähr zehn Minuten zum Sakura Park, und wenn man sich von dort nach Norden wendet, immer am Hudson River entlang, der aber wegen des Straßenlärms jenseits der Bäume nicht zu hören ist, kommt man nach Harlem. Diese Spaziergänge, ein Kontrapunkt zu meinen geschäftigen Tagen im Krankenhaus, wurden länger und länger und führten mich von Mal zu Mal weiter fort. Oft fand ich mich spätabends in großer Entfernung von zu Hause wieder und war gezwungen, die U-Bahn zurück zu nehmen. So drang New York City zu Beginn des letzten Jahres meiner Facharztausbildung zum Psychiater im Schritttempo in mein Leben ein.
Kurz bevor ich meine ziellosen Wanderungen aufnahm, hatte ich mir angewöhnt, Zugvögel zu beobachten, und heute frage ich mich, ob zwischen beidem ein Zusammenhang bestand. An Tagen, an denen ich früh genug zu Hause war, blickte ich aus dem Fenster wie ein Augur, der den Himmel nach Zeichen absucht, und hoffte, das Wunder der natürlichen Immigration zu erleben. Jedes Mal, wenn ich Gänse erspähte, die in Formationen über den Himmel schossen, fragte ich mich, wie unser Leben hier unten wohl aus ihrer Perspektive aussah. Würden sie sich jemals solchen Überlegungen hingeben, dann müssten ihnen, stellte ich mir vor, die Wolkenkratzer als ein Wald dicht aneinandergedrängter Tannen erscheinen. Oft genug sah ich, wenn ich den Himmel absuchte, nur Regen oder den diffusen Kondensstreifen eines Flugzeugs, der das Bild im Fensterrahmen zerteilte, und dann zweifelte etwas in mir, ob diese Vögel mit ihren dunklen Flügeln und Hälsen, ihren blassen Körpern und unermüdlichen kleinen Herzen wirklich existierten. Sie waren so unglaublich, dass ich meiner Erinnerung kaum traute, wenn sie nicht da waren.
Gelegentlich flogen Tauben vorbei, auch Spatzen, Zaunkönige, Pirole, Tangare und Mauerschwalben, aber es war schwierig, anhand der winzigen und meist farblosen Flecken, die vereinzelt am Himmel vorüberzischten, die Vögel zu identifizieren. Manchmal, während ich auf die seltenen Gänsegeschwader wartete, hörte ich Radio. Normalerweise mied ich amerikanische Sender, die für meinen Geschmack zu viele Werbeunterbrechungen machten – Beethoven gefolgt von Skijacken oder Wagner nach Landkäse –, und suchte stattdessen nach Internetradiosendern aus Kanada, Deutschland oder den Niederlanden. Auch wenn ich die Ansager oft nicht verstand, weil meine Kenntnis ihrer Sprachen dürftig war, entsprach das Programm meiner Abendstimmung sehr genau. Da ich damals schon seit über vierzehn Jahren begeistert Klassikradio hörte, kannte ich einen Großteil der Musik, aber einiges war auch neu für mich. Es gab sogar seltene Momente des Staunens, zum Beispiel, als ich auf einem Hamburger Sender ein bezauberndes Stück für Orchester und Alt-Solo von Schtschedrin hörte (vielleicht war es auch von Ysaïe), das ich bis zum heutigen Tag nicht habe zuordnen können.
Ich mochte das Murmeln der Ansager, ihre Stimmen, die aus Tausenden von Kilometern Entfernung gedämpft zu mir sprachen. Ich drehte die Computerlautsprecher leise und schaute hinaus, geborgen im Klang dieser Stimmen, und plötzlich lag der Gedanke an die Analogie zwischen mir in meinem kargen Apartment und dem Radiomoderator in seiner Studiozelle nahe, auch wenn dort, irgendwo in Europa, gerade tiefste Nacht herrschte. Jene körperlosen Stimmen sind in meinem Kopf mit dem Bild der am Himmel ziehenden Gänse verbunden. Dabei habe ich sie gar nicht oft gesehen, vielleicht drei- oder viermal: Meistens musste ich mit dem Farbenspiel der Abenddämmerung vorliebnehmen, dem Taubenblau, dem dreckigen Rouge, dem Rostrot, die allmählich tiefen Schatten wichen. Wenn es dunkel wurde, nahm ich mir ein Buch und las im Schein einer alten Schreibtischlampe, die ich aus einem der Müllcontainer an der Universität gerettet hatte. Ihre Glühbirne war von einer Glashaube bedeckt, die einen grünlichen Lichtschein auf meine Hände, das Buch auf meinem Schoß und die abgenutzten Polster meines Sofas warf. Manchmal las ich mir laut aus dem Buch vor, und dabei fiel mir auf, wie sich meine Stimme auf merkwürdige Weise mit dem Raunen der französischen, deutschen oder niederländischen Radioansager verwob oder mit der dünnen Textur der Violinen im Orchester, eine Wahrnehmung, die dadurch verstärkt wurde, dass der Text, den ich gerade las, zumeist aus einer europäischen Sprache übersetzt worden war. In jenem Herbst verschlang ich ein Buch nach dem anderen: Barthes’ Die helle Kammer, Peter Altenbergs Seelentelegramme, Tahar Ben Jellouns Der letzte Freund und andere mehr.
Diese fugenartige Konstellation brachte mich auf den heiligen Augustinus, der sich über den heiligen Ambrosius gewundert hatte, dem man nachsagte, er habe herausgefunden, wie man lese, ohne die Worte erklingen zu lassen. Es ist tatsächlich eigenartig, das geht mir immer wieder durch den Kopf, dass wir die Worte verstehen können, ohne sie auszusprechen. Augustinus glaubte, Bedeutung und Innenleben der Sätze ließen sich durch laute Aussprache am besten erfahren, aber seitdem hat sich unsere Vorstellung vom Lesen sehr verändert. Man hat uns gründlich gelehrt, dass das Gespräch eines Menschen mit sich selbst als Anzeichen von Exzentrik oder Wahnsinn zu werten sei; wir sind nicht mehr gewohnt, unsere eigene Stimme zu hören, außer in einer Konversation oder in der sicheren Umgebung einer schreienden Volksmenge. Dabei ist ein Buch ein Angebot zum Gespräch: Einer spricht mit dem anderen, und der hörbare Klang ist oder sollte natürlicher Bestandteil dieses Austauschs sein. Also las ich mir selbst laut vor, ich war mein eigener Zuhörer und lieh den Worten eines anderen meine Stimme.
Auf jeden Fall vergingen diese ungewöhnlichen Abendstunden wie im Flug, und oft schlief ich direkt auf dem Sofa ein und schleppte mich erst viel später ins Bett, irgendwann mitten in der Nacht. Nach einem kurzen Schlaf, der sich kaum länger als einige Minuten anfühlte, wurde ich vom Ton meines Handyweckers wach gerüttelt, den ich auf ein kurioses Marimba-Arrangement von »O Tannenbaum« eingestellt hatte. In diesen ersten Augenblicken des Wachwerdens, als mich plötzlich das Morgenlicht blendete, rasten meine Gedanken im Kreis, Traumfragmente vermischt mit Passagen des Buchs, das ich vor dem Einschlafen gelesen hatte. Ich wollte die Monotonie dieser Abende brechen, deswegen machte ich mich zu meinen Spaziergängen auf, zwei- oder dreimal pro Woche nach der Arbeit und mindestens einmal am Wochenende.
Anfänglich erlebte ich die Straßen als eine unaufhörliche Geräuschkulisse, ein Schock nach der Konzentration und relativen Ruhe des Tages, so als zerrisse jemand die Stille einer abgeschiedenen Kapelle mit einem dröhnenden Fernseher. Ich bahnte mir meinen Weg durch die Menge der Kauflustigen und der Angestellten, durch Baustellen und an hupenden Taxis vorbei. Wenn ich durch belebte Teile der Stadt lief, fiel mein Blick auf mehr Menschen, hundert- oder sogar tausendmal mehr Menschen, als ich den ganzen Tag zu sehen gewohnt war, doch der Eindruck dieser zahllosen Gesichter trug nicht dazu bei, mein Gefühl der Isolation zu lindern; es wurde eher noch verstärkt. Auch die Müdigkeit nahm zu, eine Erschöpfung, die ich seit den ersten Monaten als Assistenzarzt drei Jahre zuvor nicht mehr gespürt hatte. Eines Abends lief ich einfach immer weiter, bis zur Houston Street, die ungefähr sieben Meilen entfernt lag, und fand mich schließlich in einem Zustand verwirrter Ermüdung wieder. Ich musste kämpfen, um auf den Beinen zu bleiben. An diesem Abend nahm ich die U-Bahn nach Hause, aber anstatt sofort einzuschlafen, lag ich auf dem Bett, zu müde, um mich vom Wachzustand zu lösen. Und in der Dunkelheit ließ ich noch einmal die zahlreichen Ereignisse und Bilder meines Streifzuges ablaufen und versuchte die Begegnungen zu sortieren, wie ein Kind, das mit Bauklötzen spielt und versucht herauszufinden, welcher Klotz wo hingehört, welcher zu welchem passt. Jedes Viertel schien aus einem anderen Stoff zu bestehen, einen anderen Luftdruck zu haben, eine andere psychische Aufladung: die strahlenden Lichter und verlassenen Läden, die Sozialbauten und Luxushotels, die Feuerleitern und Stadtparks. Ich sortierte weiter, vergeblich, bis die Formen ineinander verschmolzen und abstrakte Gestalten annahmen, die nichts mehr mit der tatsächlichen Stadt zu tun hatten. Erst dann begann mein hektisches Gehirn, endlich Gnade zu zeigen und Ruhe zu geben, und traumloser Schlaf überfiel mich.
Die Spaziergänge erfüllten ein Bedürfnis: Sie erlösten mich von der Atmosphäre strenger Reglementierung bei der Arbeit, und als ich ihren therapeutischen Wert einmal erkannt hatte, wurden sie zur Normalität, und ich vergaß, wie mein Leben gewesen war, bevor ich damit begonnen hatte. Die Arbeit war bestimmt von Perfektion und Kompetenz, für Improvisation war kein Platz, Irrtümer wurden nicht geduldet. Mein Forschungsprojekt – eine klinische Studie über affektive Störungen...
| Erscheint lt. Verlag | 29.2.2024 |
|---|---|
| Übersetzer | Christine Richter-Nilsson |
| Verlagsort | Berlin |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Amerikanisch • Erinnerung • Gegenwart • Großstadt • Internationaler Literaturpreis • Kunst • Literatur • Manhatten • Metropole • New York • Preisgekrönt • Roman |
| ISBN-10 | 3-8437-3119-5 / 3843731195 |
| ISBN-13 | 978-3-8437-3119-5 / 9783843731195 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 2,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich