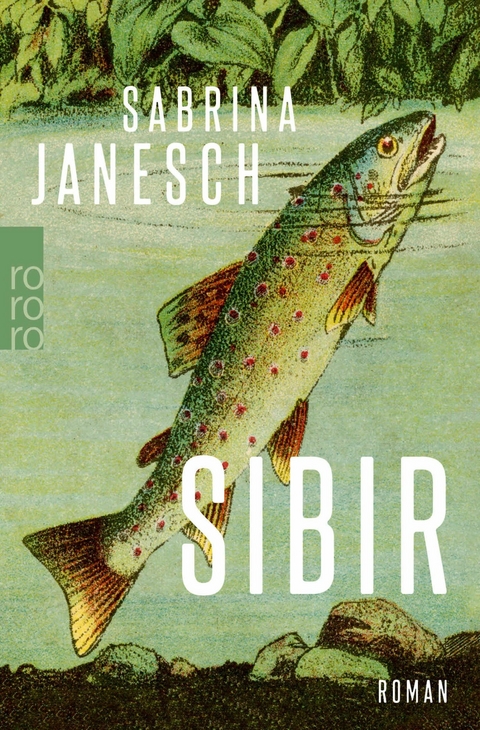Sibir (eBook)
352 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-01310-0 (ISBN)
Sabrina Janesch, geboren 1985 im niedersächsischen Gifhorn, studierte Kulturjournalismus in Hildesheim und Polonistik in Krakau. 2010 erschien ihr Romandebüt «Katzenberge», das u.a. mit dem Mara-Cassens-Preis und dem Anna-Seghers-Preis ausgezeichnet wurde. Über ihren Roman «Die goldene Stadt» (2017), der zum Bestseller wurde, schrieb Sten Nadolny: «Makellos geschrieben, fesselnde Figuren, Reichtum, wohin man sieht - plastisch, farbig und unvergesslich.» Sabrina Janesch, die Stipendiatin des Ledig House, New York, war und Stadtschreiberin von Danzig, lebt mit ihrer Familie in Münster.
Sabrina Janesch wurde 1985 in Niedersachsen geboren. Sie ist die Tochter einer polnischen Mutter und eines Vaters, der als Kind aus dem Wartheland nach Zentralasien verschleppt wurde. Für ihre Romane erhielt Janesch zahlreiche Preise; «Die goldene Stadt» (2017) wurde zum Bestseller. Für die Recherche zu «Sibir» sprach sie mit Zeitzeugen, las Tagebücher, historische Dokumente. Ihre Reise führte sie schließlich bis in das kasachische Steppendorf, in dem ihr Vater seine Kindheit verbracht hat. Sabrina Janesch lebt mit ihrer Familie in Münster.
Fünfzig Jahre später war es die Heide. Hier wuchs ich auf, hier spielte sich mein Leben ab, meine Kindheit. Wie alles, was meine eigenen Lebensumstände und die meiner Freunde anging, schien mir diese Umgebung heruntergerechnet worden zu sein, handzahm gemacht und aus einer Art roher Vorsintflutlichkeit in etwas Gewöhnlicheres, Belangloseres übersetzt. Mein Vater verstärkte diesen Eindruck, indem er von den Heideflächen und dem Wald, der sich hinter der Tangente ausbreitete, zwar mit Sympathie sprach, aber nie mit Begeisterung oder Liebe.
Wieso?, hatte er einmal verblüfft gefragt, als ich ihn darauf ansprach. Es sei doch alles in Ordnung: Heide in Ordnung, Mühlheide in Ordnung, er in Ordnung, ich in Ordnung. Dieser Ordnung der Dinge maß er wohl eine größere Bedeutung zu, als der einfache Wortlaut vermuten ließe; vielleicht war die Ordnung der Dinge jemandem, der erlebt hatte, wie es war, wenn die Dinge in Unordnung kamen, umso heiliger.
Mein Vater liebte es, einzuteilen, zu sortieren, zu systematisieren. Das galt für Daten jeder Art, aber auch für Lebensmittel, insbesondere jene, die man bei uns am Stadtrand selbst anbaute. Jeden Sommer, wenn in den großen Gärten unserer Siedlung die Johannisbeeren reif wurden, die Zucchini und die Gurken, kam man zusammen und half einander bei der Ernte. Ich erinnere mich, wie ich zusammen mit meinem Vater, meiner Mutter, den Kolbs – Arnolds Eltern – und unseren Nachbarn, den Peltzers, bis spät in die Nacht bei meiner Tante im Garten hockte, an einem der Resopaltische, die sie aus dem Schuppen herbeischleppte, und eimerweise Johannisbeeren pulte. Mein Vater hatte die Eimer nach einer bestimmten Systematik aufgestellt, rechts schwarze Johannisbeeren, mittig rote und rosafarbene Früchte, links weiße, daran durfte nicht gerührt werden. Ich wollte immer links sitzen, damit am nächsten Tag meine Hände nicht verfärbt und damit für alle sichtbar gekennzeichnet waren. Gemeinsam saßen wir da und horchten auf die Geräusche der Nacht, die Gesichter ringsum erhellt von einer nackt ins Gewinde gedrehten Glühbirne, an der im Sekundentakt Motten und Mücken verglühten.
Johannisbeersaft, Johannisbeerkompott, Marmelade, Kuchen und Kekse. Bei uns zählte, was an Nahrung selbst gewonnen, erlegt oder gefunden wurde, völlig egal, wie man finanziell gestellt war. Nicht wenige verfügten über ein erstaunliches Vermögen; so wie sie nie eine Beziehung zu Norddeutschland entwickelten, konnten sie auch nie eine Beziehung zu ihrem Ersparten aufbauen und versteckten ihr Geld lieber, horteten es oder kauften so viel Land wie irgend möglich. Der Stadtrand: Von der Mitte her mochte er ärmlich wirken, aber das traf nicht ganz zu – die Umstände, in denen wir lebten, waren nicht ärmlich, sondern provisorisch. Hier glaubte niemand an die Beständigkeit der Verhältnisse. Diese Einsicht verletzte mich, das Kind, und ließ selbst die einfachsten und gewöhnlichsten Dinge begehrenswert, aber unerreichbar erscheinen.
Einmal waren mein Vater und ich von einem langen Streifzug durch den Wald zurückgekehrt. Wir hatten einen größeren Bogen gemacht und erreichten Mühlheide etwas weiter westlich als sonst, in einem der betuchteren Stadtviertel, wo sich Bungalow an Bungalow reihte und der Rasen aussah wie kostbares, erlesenes Gewebe. Im Mischwald am Schrevensee hatten wir einen fußballgroßen Riesenbovist gefunden. Wir waren beide euphorisch, und übervoll von Glück und Stolz auf unseren Fund – noch am selben Abend sollte er in Scheiben geschnitten, paniert und gebraten werden – trug ich ihn vorbei an den Bungalows, glänzenden VW-Jahreswagen und sanft plätschernden, künstlichen Wasserläufen. So bezaubert war ich von meinem kugelrunden Bovist, dass ich nicht bemerkte, wie aus einem der Autos die Familie einer Schulkameradin stieg. Plötzlich stand ich, ohne es zu wollen, Jeanette Hasenjäger gegenüber: ich mit verdreckten Schuhen und dem schneeweißen Riesenbovist, Jeanette mit Strohhütchen und einem schneeweißen Riesenteddy. Es war Schützenfest, die wichtigste Feier in Mühlheide, und meinen Eltern war es schlicht entgangen. Ich starrte auf den Riesenteddy, irgendetwas schnürte mir die Kehle zu.
Was ist das denn?, fragte Jeanette Hasenjäger.
Ja, was ist das denn?, erkundigte sich auch ihr Vater, sichtlich angetrunken.
Calvatia gigantea, sagte mein Vater. Das kann man essen.
Ich liebte gebratene Pilze, hegte aber gegen bestimmte andere Speisen eine starke Abneigung. Meine Klassenkameradinnen verkündeten auf Nachfrage unserer Grundschullehrerin Frau Frerick stets, am Wochenende zu ihren Großeltern zu gehen und Zuckerkuchen zu essen, eine nach der anderen, reihum. Bei Feldmanns, Paukstätts, Jansens, Hansens, selbst bei Dycks und Seilers gab es Zuckerkuchen. Ich stellte mir vor, sie würden ihn an alten Eichentischen mit selbst gehäkelten Spitzendeckchen verspeisen, malte mir kleine Butterlachen aus, die auf dem Gebäck standen und sich mit den Zuckerkristallen zu Übelkeit erregender Süßlichkeit verbanden.
Als ich einmal an der Reihe war, von meinen Wochenendplänen zu erzählen, hielt ich es nicht mehr aus und schrie: Meine Oma ist im Zweiten Weltkrieg gestorben! Und mein Opa! Und mein Onkel! Alle tot, tot, tot – ich hasse Zuckerkuchen!
Ich echauffierte mich so sehr, dass ich mich auf den Teppichboden des Klassenzimmers erbrach. Danach sank ich, blass und matt, auf meinem Stuhl zusammen. Es war eine Tatsache, ich hasste Zuckerkuchen. Frau Frerick erkundigte sich danach nie wieder nach unseren Wochenendplänen.
Trotz seiner vielen Geschäftsreisen und seiner feinen, italienischen Kammgarnanzüge haftete meinem Vater der Makel des Stadtrandbewohners an. Unsere Siedlung war verschrien als Hort von Sonderlingen und Eigenbrötlern. Dieser Ruf strahlte auf uns Kinder ab, noch bevor wir wussten, was das überhaupt bedeutete.
Ich erinnere mich daran, wie mein Vater mich zu einem Eltern-Kind-Treffen der zweiten Klasse begleitete. Stolz bemerkte ich, wie die anderen seinen Anzug musterten, seinen Hut, seine Ledertasche. Nachdem er etwas umständlich Frau Frerick begrüßt hatte, wollte ich ihm meinen Platz im Klassenzimmer zeigen: erste Reihe links, zwischen Waschbecken und Fensterfront. Mein Vater zögerte. Mit leicht entrücktem Blick betrachtete er den Raum, die Fenster und die bereits besetzten Plätze gleich neben der Tür. Man sah ihm wohl an, dass er lieber hinten sitzen wollte, und um es ihm leichter zu machen, sagte Frau Frerick, er solle sich nur setzen, es werde sicherlich nicht lange dauern. Sie dachte vielleicht, mein Vater wolle sich vor der Zeit hinausschleichen; wie hätte sie auch wissen können, dass er in Fluchtwegen und Notausgängen dachte. Widerwillig ließ er sich neben mir auf einen Stuhl sinken, die Hände um den Griff der Tasche geklammert.
Wovon Frau Frerick dann erzählte, weiß ich nicht mehr, ich weiß nur noch, dass ihr Blick immer wieder wohlwollend bei der eleganten, wenn auch angespannten Gestalt meines Vaters hängen blieb. Er war gerade dabei, etwas in seiner gestochen scharfen Schrift zu notieren – auf Millimeterpapier, wie ich, peinlich berührt, registrierte –, da geschah es: Jemand klopfte laut an der Tür. Das Bollern drang durch den gesamten Klassenraum, alle Köpfe fuhren herum, und schon zog und ruckelte es heftig an der Klinke. Manchmal klemmte die Tür ein wenig, man musste sie dann etwas anheben, nichts weiter. Da wurde aber nichts angehoben, da wurde weiter geklopft, nun noch fordernder, eindringlicher. Noch bevor jemand die Tür von innen öffnen konnte, stand mein Vater auf, warf dabei seinen Stuhl um, öffnete hektisch das Fenster neben uns und sprang hinaus. Das Millimeterpapier segelte Richtung Tafel und blieb vor Frau Frericks Füßen liegen. Aus dem Hochparterre war es bloß ein knapper Meter bis zum Boden des Waldes, der die Schule umgab, und doch schrien einige Mütter auf, Frau Frerick stand mit offenem Mund da, und die, die ebenfalls am Fenster gesessen hatten, sprangen auf, um zu verfolgen, was vor sich ging. Ich musste mich erst zwischen ihnen hindurchzwängen, um ihn zu sehen, wie er da an einer Fichte lehnte, leicht vorgebeugt, mit weit aufgerissenen Augen.
Papa, rief ich, Papatschka!
Aber es war, als würde er mich überhaupt nicht hören oder erkennen. Er stand einfach da und starrte weiter auf das geöffnete Fenster, aus dem er eben gesprungen war, reagierte nicht auf Frau Frerick, die seinen Namen rief. Während die Erwachsenen ihrerseits nach draußen starrten, hörte ich, wie meine Klassenkameraden anfingen zu kichern. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie sie nach dem Millimeterpapier angelten. Ich rutschte auf die Fensterbank und wollte mich schon zu meinem Vater hinabgleiten lassen, da setzte er sich in Bewegung und rannte über den Schulhof davon. Frau Frerick nahm das Blatt an sich und betrachtete mit hochgezogener Augenbraue die kyrillischen Schriftzeichen, die mein Vater darauf hinterlassen hatte.
Peinlich berührt, räusperte ich mich und sagte: Mein Papa erschrickt sich leicht. Er ist als Kind mit seiner Familie nach Sibirien verschleppt worden.
Stille im Klassenzimmer. Dann hörte ich, wie sich einer der anderen Väter auf seinem Stuhl bewegte und murmelte: … und das wird sicher seine Gründe gehabt haben.
Seine Gründe. Was dem Rest der Elternschaft bodenlos sonderbar erschien und sich für immer in ihr Gedächtnis einbrannte, wäre in unserer Siedlung kaum weiter aufgefallen. Am östlichen Stadtrand wohnten beinahe ausschließlich Menschen, die es entweder drinnen oder draußen schlecht aushielten, die nicht lange an ein und...
| Erscheint lt. Verlag | 31.1.2023 |
|---|---|
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | 1950er • Aussiedler • Bücher Neuerscheinungen 2023 • Deutschland • Familiengeschichte • Familienroman • Fünfziger Jahre • Heimat • Identität • Kasachstan • Literatur • Nomaden • Osteuropa • Romane • Russlanddeutsche • Sibirien • Sowjetunion • Steppe • Trauma • Vater-Tochter-Geschichte • Verschleppung • Zweiter Weltkrieg |
| ISBN-10 | 3-644-01310-1 / 3644013101 |
| ISBN-13 | 978-3-644-01310-0 / 9783644013100 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 9,0 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich