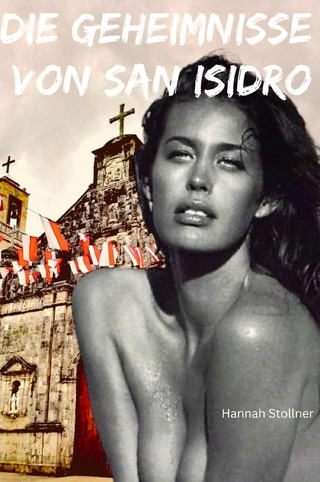Abschied ohne Worte
Bonn, September 1845
Als ich die Arscotts kennenlernte, ahnte ich nicht, wie diese Begegnung mein Leben verändern würde. Wie viele ihrer englischen Landsleute bereisten sie das Rheintal, das mit seinen Burgen und dem milden Klima ein beliebtes Ziel war, nachdem wenige Wochen zuvor Königin Victoria dieselbe Reise in die Heimat ihres Ehemannes unternommen hatte.
Wir trafen vor der Statue Beethovens zusammen. Iseuld spielte mit ihren Kindern Fangen, was ihre Mitreisenden empörte. Ich aber freute mich, wie die beiden Kleinen lachten, und beneidete sie sogar, denn ein solch ausgelassenes Miteinander kannte ich von meiner Familie nicht.
Vielleicht sollte ich dort beginnen: bei meiner Familie. Papa und ich lebten bei meinem Bruder Carl und seiner Gattin Bertha, ständig bemüht, ihnen nicht zur Last zu fallen. Deshalb hatte ich es übernommen, ihren verwöhnten Kindern Englisch, Französisch und Klavierspiel beizubringen. Weshalb Bertha die Gouvernante entlassen hatte; wenn sie auch nur einen Taler einsparen konnte, dann sagte sie nicht Nein. Als Schwägerin oder gar Schwester hatte sie mich eh nie betrachtet und so fiel es ihr leicht, in mir nichts weiter als eine Angestellte zu sehen. Eine, die nicht mehr kostete als einen Platz am Tisch und ein abgelegtes Kleid dann und wann.
Dafür erwartete sie viel: Luise und Alexander sollten manierlich schreiben, plaudern, musizieren und singen, niemandem außer mir auf die Nerven fallen und vor Gästen Eindruck machen. Beide waren hübsch, eitel und ließen sich gerne vorführen; sie spielten die Bescheidenen und taten so, als hingen sie an mir. Und ich tat so gut mit, dass mein Bruder nicht begriff, wie es wirklich um seine glückliche Familie stand.
Carl war es ein echtes Bedürfnis, Papa und mir zu helfen. Er betrachtete mich als seine Schwester, ohne Wenn und Aber, obwohl Bertha versucht hatte, mich als ferne Verwandte hinzustellen. Der Altersunterschied zwischen uns und dann noch meine Mutter – wie könne er da von Schwester sprechen? Überhaupt, meine Mutter! Was der alte Füssenich sich nur gedacht habe! Doch wie sie sich auch bemühte, in diesem Punkt ließ Carl sich nicht reinreden: Es habe sein Vater, wie jeder andere Mann, das Recht, seinem Herzen zu folgen, und er als sein Sohn habe die heilige Pflicht, sich um ihn und die Schwester zu kümmern. Oder wolle Bertha etwa die Frau eines Sünders sein?
Das wollte Bertha nicht, das hätte sich im Kreis ihrer vornehmen Freundinnen nicht gut gemacht. Vor ihnen sprach sie von mir als ihrer lieben Schwester, ohne deren Hilfe sie nicht leben könne. Dennoch wollte sie mich zu gerne loswerden und gelegentlich nahm sie mich zur Seite, um mir irgendeinen Mann schmackhaft zu machen. Sie ließ mich spüren, wie mein Vater und ich eine Belastung darstellten. Täglich klagte sie, dass sie nicht Herrin ihres Hauses sei und ständig Rücksicht auf einen Kranken nehmen müsse. Ebenso oft erklärte sie mir, wie schlecht es um die Finanzen der Füssenichs stünde: »Meine liebe Anna, Rücklagen haben wir keine und träfe uns ein Unglück, so wüssten wir kaum noch unser Essen zu bezahlen. Wenn du dich nur ein wenig freundlicher geben wolltest, dann würde der Herr Kommerzienrat Weber dir einen Antrag machen.«
Mit Kommerzienrat Weber kam sie mir seit Wochen ständig. Weit über fünfzig war der und drei Ehefrauen hatte er bereits unter die Erde gebracht. Allgemein ging man davon aus, dass sie es dort besser hatten. Er war ein Schwätzer und Vielfraß und verstand von nichts etwas außer vom Handel. Und als einen Handel sah er auch die Ehe an. In seinem Haus standen ein ungenutztes Klavier und ein leeres Bett – weshalb nicht eine vierte Frau nehmen und sich an Klavier wie Bett wieder erfreuen? Und warum nicht die Schwester vom Carl Füssenich? Schadete nicht, einem Bankier die Last abzunehmen, das konnte sich mal als nützlich erweisen. Und als Tochter vom alten Füssenich würde ich seine kulturbeflissenen Freunde am Klavier beeindrucken können.
Ja, bestimmt hatte Kommerzienrat Weber eine solche Rechnung aufgestellt und Bertha darauf hingewiesen, dass ich ein gutes Geschäft machen würde. Dass ich mit meinem hellen Haar, der fehlenden Mitgift und meinem Alter weder der herrschenden Mode noch dem Geschmack der meisten Herren entsprach, das erwähnte Bertha dauernd. »Meine liebe Anna, Kommerzienrat Weber ist ein reizender Herr in den besten Jahren und sehr verständnisvoll. Er wird dich gut versorgen und sogar deinen lieben Papa aufnehmen. Wie glücklich wir alle dann wären.«
Ich wäre glücklicher, wenn Papa mir erlaubt hätte, anderswo als Gouvernante zu arbeiten. Doch davon wollte er nichts hören. »Familie, Anna«, sagte er dann immer und zeigte mir auf, wie Carl dastünde, wenn ich mich so weit unter Stand begeben würde. Und selbst für seine eigensüchtige Schwiegertochter hatte Papa Verständnis; jede Frau wolle doch ihr Heim für sich und ihre Familie haben. »Und unter ihrer Anleitung sind deine Aussichten auf einen Ehemann höher als anderswo. Nimm mir diese Hoffnung nicht, mein Kind, ich möchte dich glücklich sehen. So glücklich, wie ich mit deiner Mama war.«
Manches Mal ging seine Rede im Husten unter, der ihn heftiger schüttelte mit jedem Monat. Heute denke ich, mein Vater wusste, wie wenig Zeit ihm blieb, ich aber träumte weiterhin von seiner Genesung. Um seinetwillen hielt ich durch.
An diesem Nachmittag Mitte September war Bertha mit den Kindern zu einer Feier geladen und so unternahm ich einen Spaziergang durch die Stadt. Es war ein sonnig warmer Tag und ohne festes Ziel ließ ich mich treiben. Ich hing meinem Lieblingstraum nach: Wenn Papa wieder gesund wäre, wollte ich mit ihm einen Musikalienhandel eröffnen. Sein Name galt etwas und vielleicht würden uns seine früheren Auftraggeber mit einem Kredit auf die Beine helfen. Wie viel die Musiker Bonns zuwege brachten, hatten sie mit dem Denkmal für unseren guten Beethoven bewiesen – da würden sie auch etwas für Papa tun können, der ihnen viele Jahre treu zur Hand gegangen war. Immer hieß es, es gäbe keinen besseren Notenstecher im gesamten Rheinland und keinen, der mehr Liebe zur Musik habe als Georg Friedrich Füssenich.
In diese Träumerei drangen Iseulds Lachen und das fröhliche Glucksen ihrer Kinder. Und die Stimme Caradocs, der sie amüsiert anfeuerte. Erst als ihre Reisegesellschaft sich um den älteren Herrn versammelte, der ihnen die Schönheiten meiner Stadt erklärte, unterbrachen die Arscotts ihr Spiel. Ich trat näher heran; es war lange her, dass ich Englisch hatte sprechen hören. Als aber dieser wichtigtuerische Mann mit Jahreszahlen und Geschichten um sich warf, die falscher kaum sein könnten, da musste ich sehr an mich halten.
Vermutlich las Iseuld an meiner Miene ab, was ich dachte. Sie zwinkerte mir zu und sprach mich an, als würden wir uns seit Kindertagen kennen. »Mr. Goodwill gibt wohl argen Unsinn von sich? Ich vermute das schon seit Tagen, aber ich habe nicht das Herz, ihn darauf anzusprechen.«
Es erstaunte mich, wie freimütig sie mit einer Fremden sprach, und schwieg überrascht.
»Oh, entschuldigen Sie, ich wollte mich nicht aufdrängen.«
»Aber nein.« Rasch hielt ich sie zurück. »Und Sie haben recht; Ihr Mr. Goodwill weiß nicht, wovon er spricht. Was verzeihlich wäre, wäre er dabei amüsant.«
»Amüsant? Himmel, nein. Jede Anekdote trägt er so ernst vor, dass es schmerzt. Aber sehen Sie, wie meine Mitreisenden an seinen Lippen hängen. Als verkünde er das Evangelium.« Sie beugte sich vertraulich an mein Ohr. »Wir reisen mit Dummköpfen.«
»Nicht dümmer, als es die meisten Menschen sind«, flüsterte ich zurück.
Leise lachte sie. »Nun, so ist es eben, wenn man sich einer Gruppe anschließt, weil man glaubt, es mache das Reisen einfacher. Aber denken Sie bitte nicht, ich wäre boshaft. Ich bin nur enttäuscht.«
»Nicht zu sehr, hoffe ich? Es täte mir leid, nähmen Sie keine freundliche Erinnerung an meine Stadt mit.«
»Wenn Sie uns Bonn zeigen, dann wird das nicht geschehen.« Sie wartete meine Antwort nicht ab, sondern winkte ihren Mann heran und erklärte, sie würden nun mit mir die Stadt besichtigen.
Er schien daran gewöhnt zu sein, die Wünsche seiner Frau zu erfüllen. Lächelnd verbeugte er sich. »Ich nehme an, Sie wissen nicht einmal, mit wem Sie es zu tun haben. Wenn ich uns vorstellen darf: Caradoc Arscott aus London. Meine Gattin hört auf den Namen Iseuld. Manchmal zumindest.«
Caradoc war charmant und wie Iseuld frei von Förmlichkeit; er war mir auf Anhieb sympathisch. Ganz, wie es sich gehörte, knickste ich und stellte mich vor. »Anna Füssenich.«
»Ach herrje«, rief Iseuld aus, »Fussänisch? Sie können nicht erwarten, dass wir diesen Namen aussprechen. Lassen Sie mich Anna sagen, ja?«
Ich stimmte zu, denn längst kam es mir so vor, als wären wir langjährige Vertraute. Iseuld schien mir kaum älter als ich zu sein und als auch noch ihr Töchterchen, ein Mädchen von vier Jahren etwa, nach meiner Hand griff, schmolz ich dahin.
»Das ist Jenefer. Sie hat ein gutes Gespür für Menschen.«
Ich bückte mich zu Jenefer, dankte für ihre Aufmerksamkeit und fragte nach dem Namen ihres Bruders. Mit wichtiger Miene zog sie den Jungen heran und stellte ihn als ihren Zwillingsbruder Petrok vor. Beide waren sie so zart und dunkelhaarig wie ihre Mutter, doch der Namen wegen und weil Caradoc groß, breit und rothaarig war, hielt ich die Arscotts für Schotten. Doch ich irrte mich Aus Cornwall stammten sie und sowohl in Caradocs wie auch in Iseulds Familie...