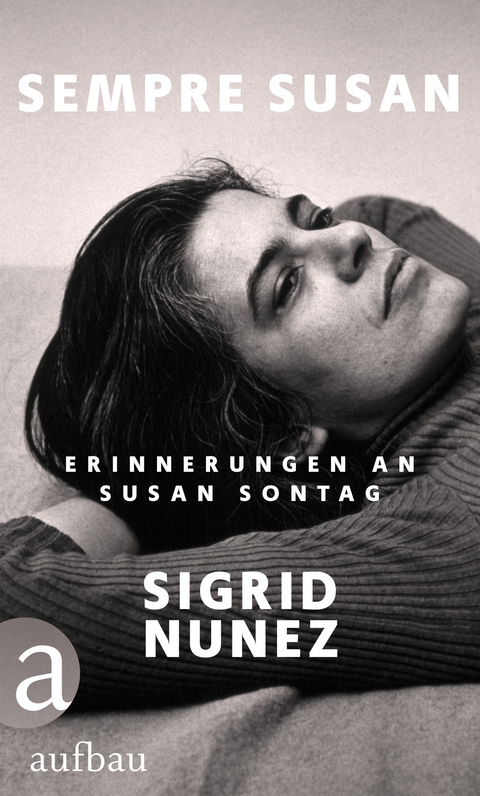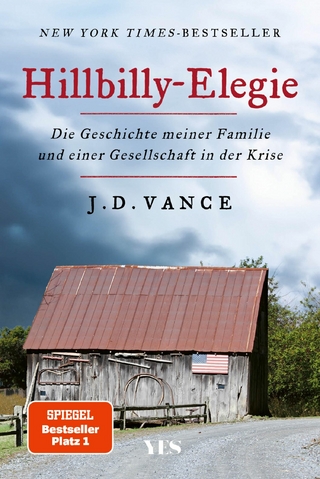Sempre Susan (eBook)
144 Seiten
Aufbau digital (Verlag)
978-3-8412-2591-7 (ISBN)
Sigrid Nunez ist eine der beliebtesten Autorinnen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Für ihr viel bewundertes Werk wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Für »Der Freund« erhielt sie 2018 den National Book Award und erreichte international ein großes Publikum, es wurde auch im deutschsprachigen Raum ein Bestseller. Sigrid Nunez lebt in New York City.
Bei Aufbau und im Aufbau Taschenbuch sind von ihr außerdem lieferbar: »Eine Feder auf dem Atem Gottes«, »Was fehlt dir«, »Sempre Susan. Erinnerungen an Susan Sontag« und »Die Verletzlichen«.
Mehr zur Autorin unter sigridnunez.com
Es war das erste Mal überhaupt, dass ich von einer Schriftstellerkolonie eingeladen war, und aus einem Grund, den ich vergessen habe, verzögerte sich meine Ankunft dort. Ich machte mir Sorgen, dass meine verspätete Ankunft Stirnrunzeln hervorrufen würde. Doch Susan bestand darauf, dass es nicht schlecht wäre. »Es ist immer gut, alles mit einem Regelbruch anzufangen.« Für sie war Unpünktlichkeit die Regel. »Nur wenn ich ein Flugzeug erwischen muss oder in die Oper gehe, schaue ich, dass ich nicht zu spät komme.« Wenn sich jemand beschwerte, dass er immer auf sie warten musste, blieb sie hart. »Wenn die Leute nicht schlau genug sind und sich etwas zum Lesen mitbringen …« (Aber wenn bestimmte Personen schlau genug waren und Susan auf sich warten ließen, war sie nicht amüsiert.)
Meine eigene pingelige Pünktlichkeit ging ihr manchmal auf die Nerven. Als ich einmal mit ihr beim Mittagessen war und mir klar wurde, dass ich zu spät zur Arbeit zurückkehren würde, und vom Tisch aufsprang, machte sie sich über mich lustig. »Bleib sitzen! Du musst nicht auf die Sekunde dort sein. Sei nicht so servil.« Servil war eins ihrer Lieblingswörter.
Einzigartigkeit. War es wirklich eine gute Idee, dass wir drei – Susan, ihr Sohn, ich – zusammenwohnten? Sollten David und ich uns nicht eine eigene Wohnung suchen? Sie sagte, sie sehe keinen Grund, warum wir nicht alle zusammenleben könnten, auch wenn David und ich ein Kind bekommen sollten. Sie würde uns freudig unterstützen, wenn sie müsste, sagte sie. Und als ich Zweifel äußerte: »Sei doch nicht so konventionell. Wer sagt, dass wir wie alle anderen leben müssen?«
(Auf dem St. Mark’s Place wies sie mich einmal auf zwei exzentrisch aussehende Frauen hin, eine mittleren Alters, die andere älter, beide gekleidet wie Hippies mit langen, fließenden grauen Haaren. »Alte Bohemiennes«, sagte sie. Und fügte scherzhaft hinzu: »Wir in dreißig Jahren.«
Über dreißig Jahre sind vergangen, und sie ist tot, und es gibt keine Bohème mehr.)
Sie war dreiundvierzig, als wir uns kennenlernten, doch auf mich wirkte sie sehr alt. Das lag zum einen daran, dass ich fünfundzwanzig war und mir in diesem Alter alle über vierzig alt erschienen. Andererseits erholte sie sich gerade von einer radikalen Mastektomie. (Brich eine Regel: Als das Krankenhauspersonal sie dafür tadelte, dass sie die empfohlene Krankengymnastik nicht machte, flüsterte ihr eine mitfühlende Krankenschwester ins Ohr: »Happy Rockefeller hat sie auch nicht gemacht.«) Ihre Haut war fahl, und ihr Haar – es sollte mich immer wundern, dass so viele Leute glaubten, die weiße Strähne in ihrem Haar wäre entfärbt, da doch auf der Hand lag, dass es die wahre Farbe ihres Haars war. (Ein Friseur hatte gemeint, dass es weniger künstlich aussähe, eine Partie nicht zu färben.) Die Chemotherapie hatte ihr extrem dickes schwarzes Haar überwiegend, wenn auch nicht komplett ausgedünnt, doch die Haare, die nachwuchsen, waren vor allem weiß.
Es war demnach merkwürdig: Als wir uns kennenlernten, sah sie älter aus als zu der Zeit, als ich sie schon besser kannte. Während sie genas, wirkte sie zunehmend jünger, und als sie beschloss, ihr Haar zu färben, sah sie noch jünger aus.
Es war im Frühjahr 1976, fast ein Jahr, nachdem ich meinen Master of Fine Arts an der Columbia University gemacht hatte, und ich wohnte in der West 106th Street. Susan, die an der Ecke 106th Street und Riverside Drive lebte, wollte einen Stapel unbeantworteter Korrespondenz, der sich während ihrer Krankheit angesammelt hatte, abarbeiten. Sie bat Freunde, die Herausgeber der New York Review of Books, ihr jemanden zu empfehlen, der ihr dabei helfen könnte. Ich hatte bei der Review zwischen dem College und der Universität als Assistentin gearbeitet. Die Herausgeber wussten, dass ich Schreibmaschine schreiben konnte und in der Nähe wohnte, und schlugen Susan vor, mich anzurufen. Es war genau die Sorte Gelegenheitsjob, die ich suchte: ein Job, der mich nicht am Schreiben hindern würde.
Am ersten Tag, als ich zu 340 Riverside Drive ging, schien die Sonne, und in der Wohnung – einem Penthouse mit vielen großen Fenstern – war es blendend hell. Wir arbeiteten in Susans Schlafzimmer, ich saß an ihrem Schreibtisch und tippte auf ihrer massiven IBM Selectric, und sie diktierte, ging dabei durchs Zimmer oder lag auf dem Bett. Der Raum war wie der Rest der Wohnung karg eingerichtet; die Wände waren weiß und nackt. Später erklärte sie, dass sie so viel weißen Raum wie möglich um sich haben wollte, wenn sie arbeitete, und sie versuchte, das Zimmer weitgehend frei von Büchern zu halten. Ich erinnere mich an keine Fotos von der Familie oder Freunden (ja, ich erinnere mich überhaupt an keine Bilder dieser Art in der Wohnung); stattdessen waren da ein paar Schwarz-Weiß-Fotos (wie sie in Pressemappen von Verlagen zu finden sind) von einigen ihrer literarischen Helden: Proust, Wilde, Artaud (von dem sie gerade einen Band ausgewählter Schriften herausgegeben hatte), Walter Benjamin. An anderen Orten in der Wohnung befanden sich Fotos von alten Filmstars und aus berühmten alten Schwarz-Weiß-Filmen. (Soweit ich mich erinnere, hatten diese zuvor in der Lobby des New Yorker Theater gehangen, des Kinos Ecke 88th Street und Broadway, in dem alte Filme liefen.)
Sie trug einen lockeren Rollkragenpullover, Jeans und Ho-Chi-Minh-Sandalen aus Reifengummi, die sie, glaube ich, von einer ihrer Reisen nach Nordvietnam mitgebracht hatte. Wegen des Krebses versuchte sie, mit dem Rauchen aufzuhören (sie sollte es versuchen und scheitern und wieder versuchen, viele Male). Sie aß ein ganzes Glas gerösteter Maiskörner und spülte sie mit Schlucken aus einer großen Flasche Wasser hinunter.
Der Stapel Briefe war entmutigend; es waren viele Stunden notwendig, um ihn abzuarbeiten, doch was unser Weiterkommen absurd verlangsamte, war, dass ständig das Telefon klingelte, und sie nahm jedes Mal ab und plauderte (manchmal ziemlich lang), während ich dasaß, wartete und natürlich zuhörte und manchmal den großen Schlittenhund ihres Sohnes streichelte, der Aufmerksamkeit suchte. Die meisten Anrufer waren Leute, deren Namen ich kannte. Ich nahm an, dass sie entsetzt war, auf welche Weise viele Menschen auf ihre Krebserkrankung reagierten. (Obwohl ich es noch nicht wusste, beschäftigte sie sich bereits mit Ideen für ihren Essay »Krankheit als Metapher«.) Ich erinnere mich, dass sie einem Anrufer gegenüber »Krebs« als »imperiale Krankheit« bezeichnete. Ich hörte sie zu mehreren Personen sagen, dass sie sich aufgrund der kurz zurückliegenden Tode von Lionel Trilling und Hannah Arendt »verwaist« fühle. Heftige Empörung, als sie berichtete, jemand habe über Trilling gesagt, es sei kein Wunder gewesen, dass er an Krebs erkrankt sei, da er seine Frau wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr gevögelt habe. (»Und das war ein Akademiker, der das gesagt hat.«) Sie gab es nur äußerst ungern zu, aber sie tat es tapfer: Einer ihrer ersten Gedanken nach der Krebsdiagnose war gewesen: »Hatte ich zu wenig Sex?«
Einmal rief ihr Sohn an. David, ein Jahr jünger als ich, hatte das Studium in Amherst aufgegeben, studierte jedoch seit Kurzem wieder in Princeton. Er hatte dort ein Zimmer, aber die meiste Zeit wohnte er bei seiner Mutter. Sein (bald unser) Schlafzimmer war direkt neben ihrem.
Die Arbeit langweilte sie. Nachdem wir erst ein paar wenige Briefe erledigt hatten, schlug sie eine Mittagspause vor. Ich folgte ihr durch Flure, die mit Büchern gesäumt waren, ein Esszimmer, in dem ich einen langen eleganten Tisch aus Holz mit dazu passenden Holzbänken (ein alter französischer Tisch aus einem Bauernhof, erklärte sie mir) und ein gerahmtes altes Olivetti-Poster (»la rapidissima«) an der Wand dahinter bewunderte, ans andere Ende der Wohnung. Auf dem Esstisch lagen normalerweise Bücher und Papiere, und die meisten Mahlzeiten wurden an einer dunkelblau gestrichenen Holztheke in der Küche eingenommen.
Ich saß unsicher auf einem Hocker an der Theke, während sie eine Dose Campbell’s Pilzcremesuppe aufwärmte. Gab man Milch dazu, reichte es für zwei. Es überraschte mich, dass sie so gesprächig war. Ich war an die hierarchische Welt der New York Review gewöhnt, deren Herausgeber nie mit den Mitarbeitern sprachen. An diesem Tag erfuhr ich, dass der Vormieter der Wohnung ihr Freund Jasper Johns gewesen war; ein paar Jahre zuvor, als Johns beschlossen hatte, woanders hinzuziehen, hatte Susan den Mietvertrag übernommen. Doch sie glaubte, dass sie nicht mehr lange dort würde wohnen dürfen; der Hausbesitzer wollte die Wohnung für sich selbst. Es war offensichtlich, warum Susan sie behalten wollte: ein großes Penthouse mit zwei Schlafzimmern in einem schönen Vorkriegsgebäude – ein großartiges Schnäppchen für, soweit ich mich erinnere, ungefähr 475 Dollar im Monat. Das riesige Wohnzimmer wirkte noch größer, weil so wenig darin stand (es hallte sogar leicht). Aber am meisten würde sie die Aussicht vermissen: den Fluss, die Sonnenuntergänge. (Die grandiose Aussicht wäre im Freien noch besser gewesen, doch die Terrasse war ein Saustall: Der Hund erledigte dort sein Geschäft.) Am anderen Ende der Wohnung von den beiden Schlafzimmern aus gesehen, waren ein viel kleineres Zimmer, einst ein Dienstmädchenzimmer, und eine Gästetoilette. Damals schlief ein Freund von David dort. Nach meinem Einzug fungierte es als mein Arbeitszimmer. (»Du bist die einzige in der Wohnung mit zwei Zimmern«, sagte Susan, gekränkt, vorwurfsvoll, als ich ihr mitteilte, dass...
| Erscheint lt. Verlag | 22.9.2020 |
|---|---|
| Übersetzer | Anette Grube |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Sempre Susan |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Literatur ► Essays / Feuilleton | |
| Schlagworte | 1976 • AIDS • Autorin • Beziehung • Boheme • David Rieff • Denkerin • Exzentrik • Gesellschaft • Krebs • Liebe • Menage à trois • New York City • New York Review of Books • Philosophie • Schreiben • Schreibmaschine • Schriftstellerin • sigrid nunez • Sohn • Susan Sontag • Upper West Side • USA • Zusammenleben |
| ISBN-10 | 3-8412-2591-8 / 3841225918 |
| ISBN-13 | 978-3-8412-2591-7 / 9783841225917 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,9 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich