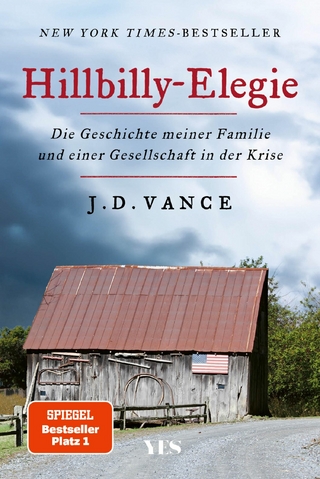Panikrocker küsst man nicht (eBook)
256 Seiten
Goldmann Verlag
978-3-641-26656-1 (ISBN)
Mitte der Achtzigerjahre in der deutschen Provinz: Die junge Krankenschwester Maria sehnt sich nach einem Leben voller Freiheit und Erfüllung. Als sie auf einem Konzert Udo Lindenberg kennenlernt, landet sie erst im Tourbus der Band, dann in seinen Armen. Schnell erliegt sie dem rebellischen, wilden und kompromisslosen Charme des »Panikrockers«. Doch es knirscht zwischen ihnen, und während sie vom Ankommen träumt, will er radikale Unabhängigkeit. Maria braucht Jahre und viele schöne, aber auch schmerzliche Erfahrungen, bis sie sich von ihm löst und ihren eigenen Weg findet. In der aktualisierten Neuauflage dieses 1992 erstmalig erschienenen Buches erzählt die bekannte Schauspielerin und Autorin Maria Bachmann eindrucksvoll und inspirierend die leidenschaftliche Geschichte einer lebenshungrigen Frau, die ausbricht und erst Udo Lindenberg, dann die große weite Welt und schließlich ihr eigenes Leben erobert.
Die Schauspielerin und Autorin Maria Bachmann ist seit 1993 einem großen Publikum aus zahlreichen Kino- und TV-Produktionen bekannt. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie Trainerin für persönlichen Ausdruck und Präsenz und unterstützt Menschen dabei, ihre wahre Motivation zu finden. Mit ihrem letzten Buch »Du weißt ja gar nicht, wie gut du es hast« stand sie auf der Spiegel-Bestsellerliste. Maria Bachmann lebt in München.
Ich stehe fast während der ganzen Frühschicht im »Ausguss«. Das ist der Raum, den man nur betritt, wenn es unbedingt sein muss, um die vollgepissten Bettpfannen zu desinfizieren oder die vielen Blumen der Patienten auszusortieren. Was noch nicht verwelkt ist, kommt zurück in die Vase. Auch wenn’s ein bisschen mickrig aussieht: zwei einzelne Blütenstängel. Ich zähle die Stunden bis zur Übergabe. Wenn die gelben Lampen über den Türen aufleuchten, gehe ich in die Krankenzimmer, auch das ist mein Job. Zu manchen Patienten geh ich sehr gern. Die nennen mich »ihren Sonnenschein«. Ich muntere sie auf, hole ihnen Tee oder gehe mit ihnen auf dem sterilen, weißen Gang spazieren. Dafür ist aber wenig Zeit. Bei den Schwerkranken gebe ich mir jedes Mal vor der Tür einen Ruck. Vielleicht bin ich tatsächlich zu zart für diesen Beruf, was viele schon von mir behauptet haben. Ich kann zumindest nicht sachlich und nüchtern mit den Kranken umgehen. Da schwingt immer noch etwas anderes mit, eine Ahnung dessen, was sie vielleicht wirklich wollen: eine Umarmung, Ruhe, ein ehrlich gemeintes Lachen, sterben können, Verständnis. Ich habe Angst, diesem Sog, der aus einem einzigen unausgesprochenen »Hilfe« besteht und mich erfasst, sobald ich nur die Tür aufmache, überwältigt zu werden. Ich wünschte, ich wäre professioneller, robuster, und hätte meine Gefühle mehr im Griff. Der weiße Kittel ist zwar ein Schutz, aber er ist dünn.
Frau Schneider hat Dünndarmkrebs. Sie kann nicht mehr essen. Auch nicht, wenn ich sie füttere. Ich sitze an ihrem Bett und sehe ab und zu auf die Parkanlagen mit den Hagebuttensträuchern am Wegrand. Einige Patienten gehen in Bademantel und Schal spazieren. Ein warmer Aprilmorgen.
»Ich hab gar kein Appetit, Schwester …« – »Aber ein bisschen können Sie bestimmt noch …« Ich weiß, dass sie nicht mehr kann. Ihre knochige Hand krallt sich in meiner fest: »Ich möcht sterbe, des is kei Lebe!« Sie lässt mich nicht los, und ich sterbe von der Hand aufwärts bis zum Ellenbogen ein bisschen mit ihr. Am liebsten rauslaufen, sie ihrem Leiden überlassen, ihrem Kot, in dem sie oft liegt. Was weiß ich schon vom Sterben? Ich weiß ja noch nicht mal was vom Leben. Das alles denke ich in Sekundenschnelle, und dabei möchte ich sie um Entschuldigung bitten. Das passiert mir immer wieder. Ich mag sie doch, Frau Schneider, die liebe Frau Schneider, die mir immer ihren Nachtisch aufhob, als sie noch selbstständig essen konnte, ihn im Nachtschränkchen versteckte und ihn rausholte, wenn wir allein im Zimmer waren. Die Zeit ist lange vorbei. Jetzt ist Sterbenszeit. »Wissen Sie was, Schwester«, reißt sie mich aus meinen Gedanken, »… ich hätt gern was zu trinken.« Ich bringe ihr Kamillentee. Sie ist dankbar, und ich schäme mich. Weil es so wenig ist, was ich ihr gebe, und sie sich so sehr darüber freut. Ich kann doch in diesem Job nicht immer mit einem schlechten Gewissen rumlaufen? Tue ich nicht das, was alle anderen auch tun? Ich gehe zurück zum »Ausguss« und sortiere die Blumen weiter, umnebelt von Sagrotanspray und dem beißenden Uringeruch aus Zimmer 52.
Ich sollte diese Arbeit lieben! Aber jeden Tag gehe ich unzufrieden von Station. Ich schäme mich vor mir selbst. Ich vermisse die Leidenschaft in fast allem, was ich tue. Dafür sind die Momente, in denen sie aufflammt, geradezu heilig. Wenn ich tanze. Wenn ich »Forever young« höre. Wenn ich Tagebuch schreibe. Wieder leuchtet das Licht über dem Zimmer von Frau Schneider. »Gehn Sie, Schwester Maria? Nehmen Sie Waschzeug mit.« Die Kollegin klingt tonlos. Als habe sie schon viele Leichen gesehen. »Ja«, sage ich und öffne die Tür. Es stinkt erbärmlich nach Kot. Im selben Moment, da der Gestank in meine Nase dringt, sehe ich die Glasscherben auf dem Boden. »Ich hab’s nur nehmen wolle, i kann net …« Ihre Augen werden nass und suchen einen Fixpunkt an der Zimmerdecke. »Ist ja gut, Frau Schneider, ich mach das schon.« Der Geruch bringt mich fast um. Ich drehe Frau Schneider vorsichtig von einer Seite auf die andere, wasche sie, wechsele das Bettlaken und lagere sie neu, damit sie nicht wundliegt. Wie lange muss sie noch so daliegen? Ohne Besuch von Verwandten? Ich stehe da und denke: Stirb doch endlich! Hoffentlich hält sie nicht wieder meine Hand fest – und greife doch selbst nach ihrer, um sie zu drücken, nicht zu stark, ganz leicht. Um sie zu streicheln. »Sie sind so lieb, Schwester«, flüstert sie, und Tränen rinnen über ihr faltiges Gesicht. »Sie haben alles noch vor sich. Sie sind jung!« Ja.
Jung und mutig, oder nicht? Ich habe mein bayrisches Heimatdorf verlassen, um die Welt kennenzulernen, und bin in der Nähe von Freiburg im Schwarzwald als Krankenschwester gelandet. Vorher war ich Arzthelferin beim Urologen und beim Internisten. Den Arzthelferinnenjob wollte ich unbedingt machen, weil er mich herausforderte. Er war eine Mutprobe. Ich weiß es noch genau, wie es dazu kam: Ich saß fünfzehnjährig in der Küche meiner Eltern an der Schreibmaschine und tippte meine Bewerbung an die Gemeindeverwaltung in unserem Ort. Ich hoffte schon während des Tippens, dass sie mich nicht nehmen würden. Aber ich hatte immer gute Noten. Wahrscheinlich würden sie ganz wild auf mich sein. Bei uns gab es keine große Auswahl an Berufen. Das Außergewöhnlichste war »Drogistin«. Eine aus meiner Klasse hatte den Platz schon ergattert. Mit den Drogen hatte sie allerdings nichts zu tun. Aber mit »4711, echt Kölnisch Wasser.« In der Gemeinde müsste ich »aufs Büro« gehen. Das würde bedeuten: ein Weg von drei Minuten zur Arbeit, denn das Rathaus war gleich um die Ecke; pünktlich zum Mittagessen zu Hause sein; dann wieder Büroarbeit; nachmittags um drei Kaffeetrinken mit den langweiligen Kolleginnen; und um vier Uhr zurück nach Hause zu Mutter und Vater. Ich bekam Atemnot bei dem Gedanken, bis zum Rentenalter in dieser Öde so langsam zu verrecken. Genau so sollte mein Leben nicht aussehen, auch wenn meine Eltern mir die – nach ihrer Meinung – wohl schönste Seite davon schilderten: »Im Büro hast du früh Feierabend.« Was hatte ich davon, wenn nach dem Feierabend nichts los war? Wenn der Punk immer genau da abging, wo ich nicht war? Vorzugsweise in großen Städten. Die kannte ich nur vom Schulatlas. Aber mit fünfzehn unseren Ort zu verlassen war unmöglich. Wo hätte ich hingehen sollen? Deshalb begann ich das Wagnis in einer urologischen Arztpraxis in der Nachbarstadt. Ich wollte was tun, was andere vielleicht nicht so leicht hinkriegten. Ich musste für die große Welt üben. Und ich wollte, dass man auch mal mich fragt, und wenn es nur nach dem Blutergebnis der letzten Woche ist.
Die Ausbildung zur Arzthelferin dauerte nur zwei Jahre. Danach konnte ich gleich Geld verdienen. Zu Hause gab es nicht so viel davon. Früh eigenes Geld haben war das Allerwichtigste für meine Eltern. Studieren war ohnehin nur was für die Kinder reicher Leute, zu denen wir niemals gehören würden. Für unsereins war »Zeit verplempern mit unnötigem Zeug« keine Option. Das war nur was für Faule und Nichtsnutze. Ich staunte ungläubig, wenn ich in unserem Fernseher Leute sah, die keine festen Arbeitszeiten hatten, sondern sie sich selbst einteilten. Sie arbeiteten nachts oder sogar am Sonntag, wo ich zwei Mal in die Kirche ging. Einmal in die Heilige Messe und einmal in die Nachtmittagsandacht. Das waren Künstler. Maler oder Musiker. Sie unterschieden auch nicht zwischen Alltags- und Sonntagskleidung.
Schnell merkte ich, dass mir die Arbeit im weißen Kittel nicht das große Lebensgefühl brachte, das ich gern gehabt hätte. Und es kam mir so vor, als sei ich in der Arztpraxis auch die Einzige, die es suchte. Freitags nachmittags putzte ich stundenlang das Labor und sortierte Röntgenbilder ins Archiv. Abends holte mich die Enge meines Dorfes wieder ein; sie legte sich wie ein Nebel über mich und machte mich ganz schwach und willenlos, so dass ich nur noch träumen konnte … von der Flucht, von der Flucht … Manchmal war ich mir sicher, dass in mir eine ganz andere steckte, die nur nicht rauskonnte. Wie gern hätte ich sie losgelassen, die freie Maria, die schöne, die tut, was sie will, weil sie weiß, was sie will, die aufrecht im Leben steht, die geliebt wird, und die vor nichts und niemandem Angst hat.
Der Ausweg – so schien es – eröffnete sich mit einem Besuch beim Arbeitsamt. Man bot mir eine Umschulung zur Krankenschwester in Freiburg an. Wieder ein weißer Kittel. Wieder ein Kompromiss. Aber ich hörte nur noch »Freiburg« und dachte daran, dass Freiburg eine viel größere Stadt als unser Kaff und ganze dreihundert Kilometer weg war; das hieß, ich musste dort hinziehen, eigene Bude; das hieß, ich würde den Absprung wagen; das hieß, die Ausbildung so nebenbei und hauptberuflich das große Lebensziel finden. Also packte ich meinen Koffer. »Mädle, mach des net, du kannst des net, des is doch so weit weg …« Ich hörte meine Mutter gar nicht mehr. Und meinen Vater auch nicht. Ich musste die Chance ergreifen.
In einer Stunde ist die Frühschicht zu Ende.
»Hast du Lust, morgen Abend auf ein Konzert zu gehen?« Barbara hat Nachtdienst und kann nicht hinfahren. »Ich schenk dir die Karte!« Sie hat sie gleich dabei und fängt an, in ihrer Handtasche danach zu kramen.
»Ich war noch nie auf einem Konzert.« – »Du, Zimmer 51 blinkt, gehst du?« – »Mhm.« Doch, ich war schon auf Konzerten. Ich denke an die Open-Air-Veranstaltungen in meinem Heimatort. Laute Musik von lauten Bands und immer den Blick in die Menge schweifen lassen. Irgendein Schwarm war immer dabei, in den man sich für einen Tag möglichst hoffnungslos verlieben konnte. Je mehr...
| Erscheint lt. Verlag | 13.1.2020 |
|---|---|
| Verlagsort | München |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Schlagworte | Ablenkung • Biografie • Biographien • Dating • eBooks • Einsamkeit • Gefühle • Große Gefühle • Isolation • Kunst • Liebesgeschichte • Musik • Quarantäne • Sehnsucht • Sonderzug • Tagebuch • tinder • Tour • Udo Lindenberg • Wahre GEschichte |
| ISBN-10 | 3-641-26656-4 / 3641266564 |
| ISBN-13 | 978-3-641-26656-1 / 9783641266561 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 915 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich