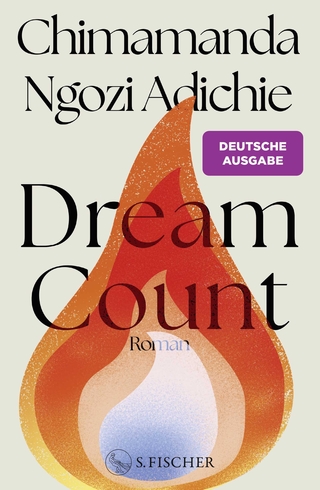Sie kam aus Mariupol (eBook)

368 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-00056-8 (ISBN)
Natascha Wodin, 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth/Bayern geboren, wuchs erst in deutschen DP-Lagern, dann, nach dem frühen Tod der Mutter, in einem katholischen Mädchenheim auf. Auf ihr Romandebüt Die gläserne Stadt, das 1983 erschien, folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter die Romane Nachtgeschwister und Irgendwo in diesem Dunkel. Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Brüder-Grimm-Preis und dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet, für Sie kam aus Mariupol wurden ihr der Alfred-Döblin-Preis, der Preis der Leipziger Buchmesse und der Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil 2019 verliehen. 2022 wurde sie mit dem Joseph-Breitbach-Preis für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Natascha Wodin lebt in Berlin und Mecklenburg.
Natascha Wodin, 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter in Fürth/Bayern geboren, wuchs erst in deutschen DP-Lagern, dann, nach dem frühen Tod der Mutter, in einem katholischen Mädchenheim auf. Auf ihr Romandebüt Die gläserne Stadt, das 1983 erschien, folgten zahlreiche Veröffentlichungen, darunter die Romane Nachtgeschwister und Irgendwo in diesem Dunkel. Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Brüder-Grimm-Preis und dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet, für Sie kam aus Mariupol wurden ihr der Alfred-Döblin-Preis, der Preis der Leipziger Buchmesse und der Hilde-Domin-Preis für Literatur im Exil 2019 verliehen. 2022 wurde sie mit dem Joseph-Breitbach-Preis für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Natascha Wodin lebt in Berlin und Mecklenburg.
Erster Teil
Dass ich den Namen meiner Mutter in die Suchmaschine des russischen Internets eintippte, war nicht viel mehr als eine Spielerei. Im Lauf der Jahrzehnte hatte ich immer wieder versucht, eine Spur von ihr zu finden, ich hatte ans Rote Kreuz und andere Suchdienste geschrieben, an einschlägige Archive und Forschungseinrichtungen, an wildfremde Leute in der Ukraine und in Moskau, ich hatte in verblichenen Opferlisten und Karteien gesucht, aber es war mir nie gelungen, auch nur die Spur einer Spur zu finden, einen noch so vagen Beweis für ihr Leben in der Ukraine, ihre Existenz vor meiner Geburt.
Im Zweiten Weltkrieg hatte man sie als Dreiundzwanzigjährige zusammen mit meinem Vater aus Mariupol zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert, ich wusste nur, dass beide in einem Rüstungsbetrieb des Flick-Konzerns in Leipzig eingesetzt waren. Elf Jahre nach Kriegsende hatte meine Mutter sich in einer westdeutschen Kleinstadt das Leben genommen, unweit einer Siedlung für Heimatlose Ausländer, wie man die ehemaligen Zwangsarbeiter damals nannte. Außer meiner Schwester und mir gab es wahrscheinlich auf der Welt keinen einzigen Menschen mehr, der sie noch gekannt hatte. Und auch wir, meine Schwester und ich, hatten sie eigentlich nicht gekannt. Wir waren Kinder, meine Schwester gerade erst vier, ich zehn Jahre alt, als sie an einem Oktobertag im Jahr 1956 wortlos die Wohnung verließ und nicht wiederkam. In meiner Erinnerung war sie nur noch ein Schemen, mehr ein Gefühl als eine Erinnerung.
Inzwischen hatte ich meine Suche nach ihr längst aufgegeben. Sie war vor über neunzig Jahren geboren und hatte nur sechsunddreißig Jahre gelebt, nicht irgendwelche Jahre, sondern die Jahre des Bürgerkriegs, der Säuberungen und Hungerkatastrophen in der Sowjetunion, die Jahre des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus. Sie war in den Reißwolf zweier Diktaturen geraten, zuerst unter Stalin in der Ukraine, dann unter Hitler in Deutschland. Es war eine Illusion, Jahrzehnte später in dem Ozean vergessener Opfer die Spur einer jungen Frau zu finden, von der ich nicht viel mehr wusste als den Namen.
Als ich diesen Namen in einer Sommernacht des Jahres 2013 ins russische Internet eingegeben hatte, lieferte mir die Suchmaschine prompt ein Resultat. Meine Verblüffung dauerte nur wenige Sekunden. Ein erschwerender Umstand meiner Suche hatte immer schon darin bestanden, dass meine Mutter einen ukrainischen Allerweltsnamen hatte, es gab Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Ukrainerinnen, die hießen wie sie. Zwar trug die mir auf dem Bildschirm angezeigte Person auch den Vatersnamen meiner Mutter, sie war ebenfalls eine Jewgenia Jakowlewna Iwaschtschenko, doch auch Jakow, der Name des Vaters meiner Mutter, war so verbreitet, dass mein Fund nichts zu bedeuten hatte.
Ich öffnete den Link und las: Iwaschtschenko, Jewgenia Jakowlewna, Geburtsjahr 1920, Geburtsort Mariupol. Ich starrte auf den Eintrag, er starrte zurück. So wenig ich über meine Mutter auch wusste, ich wusste, dass sie 1920 in Mariupol geboren war. Sollte es möglich sein, dass in einer kleinen Stadt wie dem damaligen Mariupol in einem Jahr zwei Mädchen mit demselben Vor- und Nachnamen zur Welt gekommen waren, deren Väter beide Jakow hießen?
Obwohl das Russische meine Muttersprache war, die ich im Lauf meines Lebens nie ganz verloren hatte und die ich seit meinem Umzug ins Nachwende-Berlin wieder fast täglich sprach, war ich nicht sicher, ob ich wirklich den Namen meiner Mutter auf dem Bildschirm las oder ob mir dieser Name vielleicht nur wie eine Fata Morgana in der Wüste erschien, die das russische Internet für mich war. Hier wurde ein Russisch gesprochen, das ich beinah als Fremdsprache erlebte, ein Newspeak, das sich rasant veränderte, ständig neue Vokabeln hervorbrachte, sich täglich mit neuen Amerikanismen vermengte, deren Herkunft sich nach der Transkription ins Kyrillische oft kaum noch erkennen ließ. Auch die Seite, die mich jetzt von meinem Bildschirm ansah, hatte einen englischen Namen, sie hieß «Azov’s Greeks». Ich wusste, dass Mariupol am Asowschen Meer lag, aber woher kamen plötzlich die «Asowschen Griechen»? Noch nie hatte ich von irgendeinem Zusammenhang zwischen der Ukraine und Griechenland gehört. Wäre ich Engländerin gewesen, hätte ich sehr treffend sagen können: It’s all Greek to me.
Über Mariupol wusste ich zu dieser Zeit so gut wie nichts. Auf der Suche nach meiner Mutter war es mir nie in den Sinn gekommen, mich über die Stadt kundig zu machen, aus der sie stammte. Mariupol, das vierzig Jahre lang Shdanow hieß und erst nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder seinen alten Namen erhielt, blieb ein innerer Ort für mich, den ich niemals dem Licht der Wirklichkeit aussetzte. Seit jeher war ich im Ungefähren zu Hause, in meinen eigenen Bildern und Vorstellungen von der Welt. Die äußere Wirklichkeit bedrohte dieses innere Zuhause, und deshalb wich ich ihr nach Möglichkeit aus.
Mein ursprüngliches Bild von Mariupol war davon geprägt, dass in meiner Kindheit niemand zwischen den einzelnen Staaten der Sowjetunion unterschied, alle Bewohner ihrer fünfzehn Republiken galten als Russen. Obwohl Russland im Mittelalter aus der Ukraine hervorgegangen war, aus der Kiewer Rus, die man die Wiege Russlands nannte, die Mutter aller russischen Städte, sprachen auch meine Eltern so über die Ukraine, als wäre sie ein Teil von Russland – dem größten Land der Welt, sagte mein Vater, ein gewaltiges Reich, das von Alaska bis nach Polen reichte und ein Sechstel der gesamten Erdoberfläche einnahm. Deutschland war dagegen nur ein Klecks auf der Landkarte.
Das Ukrainische ging für mich im Russischen auf, und wenn ich mir meine Mutter in ihrem früheren Leben in Mariupol vorstellte, sah ich sie immer im russischen Schnee. Sie ging in ihrem altmodischen grauen Mantel mit dem Samtkragen und den Samtstulpen, dem einzigen Mantel, den ich je an ihr gesehen hatte, durch dunkle, eisige Straßen in irgendeinem unermesslichen Raum, durch den seit Ewigkeiten der Schneesturm fegte. Der sibirische Schnee, der ganz Russland und auch Mariupol bedeckte, das unheimliche Reich der ewigen Kälte, in dem die Kommunisten herrschten.
Meine kindliche Vorstellung vom Herkunftsort meiner Mutter überdauerte Jahrzehnte in meinen inneren Dunkelkammern. Auch als ich längst wusste, dass Russland und die Ukraine zwei verschiedene Länder waren und die Ukraine rein gar nichts mit Sibirien zu tun hatte, berührte das mein Mariupol nicht – obwohl ich nicht einmal Gewissheit darüber besaß, ob meine Mutter wirklich aus dieser Stadt kam oder ob ich ihr Mariupol angedichtet hatte, weil mir der Name so gut gefiel. Manchmal war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob es eine Stadt dieses Namens überhaupt gab oder ob sie eine Erfindung von mir war wie so vieles andere auch, das meine Herkunft betraf.
Eines Tages, als ich beim Blättern in einer Zeitung auf den Sportteil stieß und schon weiterblättern wollte, fiel mein Blick auf das Wort Mariupol. Eine deutsche Fußballmannschaft, so las ich, war in die Ukraine gereist, um gegen Iljitschewez Mariupol zu spielen. Allein die Tatsache, dass die Stadt eine Fußballmannschaft hatte, war so ernüchternd, dass mein inneres Mariupol sofort zerbröckelte wie ein modriger Pilz. Nichts auf der Welt interessierte mich weniger als Fußball, aber ausgerechnet der stieß mich zum ersten Mal auf das wirkliche Mariupol. Ich erfuhr, dass es sich um eine Stadt mit ausgesprochen mildem Klima handelte, eine Hafenstadt am Asowschen Meer, dem flachsten und wärmsten Meer der Welt. Es war von langen und weiten Sandstränden die Rede, von Weinhügeln, endlosen Sonnenblumenfeldern. Die deutschen Fußballer stöhnten unter den Sommertemperaturen, die sich der Vierzig-Grad-Marke näherten.
Die Wirklichkeit erschien mir viel unwirklicher als meine Vorstellung von ihr. Zum ersten Mal seit ihrem Tod wurde meine Mutter zu einer Person außerhalb von mir. Statt im Schnee sah ich sie plötzlich in einem leichten, hellen Sommerkleid auf einer Straße von Mariupol gehen, mit nackten Armen und Beinen, die Füße in Sandalen. Ein junges Mädchen, das nicht am kältesten und dunkelsten Ort der Welt aufgewachsen war, sondern in der Nähe der Krim, an einem warmen südlichen Meer, unter einem Himmel, der vielleicht dem über der italienischen Adria glich. Nichts erschien mir so unvereinbar wie meine Mutter und Süden, meine Mutter und Sonne und Meer. Ich musste alle meine Vorstellungen von ihrem Leben in eine andere Temperatur, in ein anderes Klima übertragen. Das alte Unbekannte, es hatte sich in ein neues Unbekanntes verwandelt.
Ein reales Winterbild von Mariupol aus der Zeit, als meine Mutter dort lebte, zeigte mir Jahre später eine russische Novelle, deren Titel ich vergessen habe: Hinter dem Fenster des Hotels Palmyra fiel nasser Schnee. Hundert Schritte weiter das Meer, von dem ich nicht zu sagen wage, dass es rauschte. Es gluckste, röchelte, das flache, unbedeutende, langweilige Meer. Ans Wasser angeschmiegt das unscheinbare Städtchen Mariupol mit seinem polnischen Kos´ciół und seiner jüdischen Synagoge. Mit seinem stinkenden Hafen, seinen Lagerschuppen, mit dem löchrigen Zelt eines Wanderzirkus am Strand, mit seinen griechischen Tavernen und der einsamen, matten Laterne vor dem Eingang des erwähnten Hotels. Es kam mir vor wie eine intime Mitteilung über meine Mutter. Das alles hatte sie mit eigenen Augen gesehen. Bestimmt war sie irgendwann einmal am Hotel Palmyra vorbeigegangen, vielleicht in ihrem grauen Mantel, vielleicht in demselben nassen Schnee, mit dem Gestank des Hafens in der Nase.
Auf der Internetseite, auf der ich nun gelandet war, erfuhr ich erneut Erstaunliches über Mariupol. Zu der...
| Erscheint lt. Verlag | 17.2.2017 |
|---|---|
| Zusatzinfo | Mit 7 s/w Fotos |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |
| Schlagworte | Arbeitslager • Deutschland • Faschismus • Franken • Fürth • Holocaust • mariupol • Russland • Stalinismus • Ukraine • Zwangsarbeit |
| ISBN-10 | 3-644-00056-5 / 3644000565 |
| ISBN-13 | 978-3-644-00056-8 / 9783644000568 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 7,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich