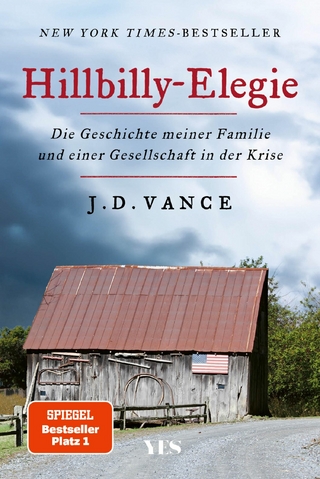Meine Davidwache (eBook)
256 Seiten
Rowohlt Verlag GmbH
978-3-644-47541-0 (ISBN)
Kriminal-Hauptkommissar i.R. Waldemar Paulsen war 41 Jahre und 150 Tage lang als Polizist in Hamburg unterwegs, die meiste Zeit davon an der Davidwache auf St. Pauli, wo er in den 70ern und 80ern unter anderem als Zivilfahnder zum «Fachmann» in Sachen Prostitution, Zuhälterei und Nepp in Stripteaselokalen avancierte. Nach einer Schießerei in einer Kiezkneipe, die Paulsen nur knapp überlebte, wechselte er die Dienststelle. Er lebt heute an der Nordseeküste.
Kriminal-Hauptkommissar i.R. Waldemar Paulsen war 41 Jahre und 150 Tage lang als Polizist in Hamburg unterwegs, die meiste Zeit davon an der Davidwache auf St. Pauli, wo er in den 70ern und 80ern unter anderem als Zivilfahnder zum «Fachmann» in Sachen Prostitution, Zuhälterei und Nepp in Stripteaselokalen avancierte. Nach einer Schießerei in einer Kiezkneipe, die Paulsen nur knapp überlebte, wechselte er die Dienststelle. Er lebt heute an der Nordseeküste. Harald Stutte, Jahrgang 1964, studierte Politikwissenschaft und Geschichte. Er arbeitet als Redakteur im Medienverlag RedaktionsNetzwerk Deutschland. Texte von ihm sind in diversen überregionalen Zeitungen wie der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", der "Süddeutschen Zeitung" oder der "Welt am Sonntag" erschienen. Geboren in Leipzig, lebt er seit 1985 in Hamburg.
Als Nachwuchspolizist in Hamburg
Am 4. April 1966 begann ich meinen Dienst bei der Polizei. Wir Neulinge waren drei Lehreinheiten – Klassen – zugeordnet, jede Einheit war dreißig Mann stark. In meiner Klasse waren die einzigen sechs Frauen unseres Einstellungsjahrganges – ein Novum: Bis zu diesem Zeitpunkt gab es ausschließlich männliche Polizisten. Die Frauen wurden für den Dienstzweig «Weibliche Schutzpolizei» ausgebildet, ohne jedoch Waffenträgerinnen zu sein. Sie hatten sich ausschließlich um Kinder und Jugendliche zu kümmern. Ich war froh, nicht allein unter Kerlen zu sein, das lockerte die Stimmung auf. Natürlich begutachteten wir die Frauen ausgiebig, fanden aber schnell heraus, dass der Flirtfaktor nicht sonderlich hoch war. Sie waren weit über dreißig und für uns damit alte Schachteln.
Mein Opa, bei dem ich in Hamburg-Barmbek zunächst untergekommen war, fuhr mich am Einstellungstag mit seiner Vespa nach Hamburg-Alsterdorf in die Carl-Cohn-Straße 39, dort befand sich die Polizeischule. In der Tasche hatte ich meinen Kaufmannsgehilfenbrief von Mercedes-Benz. Mit meinem Koffer in der Hand meldete ich mich schüchtern beim Torposten.
«Guten Morgen, ich heiße Waldemar Paulsen und fange heute meine Ausbildung bei der Polizei an», spulte ich brav herunter und händigte ihm mein Einladungsschreiben zum Polizeianwärter aus. Ein paar Schritte nach links um die Ecke, und ich war in meiner Unterkunft, wo sich heute das Kriminalmuseum befindet.
Das Gebäude ist dreistöckig wie die anderen beiden auf dem Gelände. Im Parterre und in den beiden Obergeschossen befanden sich die Unterkünfte der Lehreinheiten. Meine Lehreinheit war in der zweiten Etage einquartiert. Die Stuben hatten unterschiedliche Größen und waren für zwei, drei oder vier Personen gedacht. Es handelte sich um typische Wehrmachtsunterkünfte, wie sie in den dreißiger Jahren gebaut wurden: einfach, unpersönlich, zweckorientiert. Von Wohnqualität keine Spur. Im Dachgeschoss waren Teile der Waffenkammer untergebracht.
Wir teilten uns zu dritt ein Zimmer. Bereits nach kurzer Zeit sagte einer: «Paulsen? Für uns bist du Pauli.»
Ich hatte einen neuen Spitznamen, bis heute bin ich ihn nicht losgeworden. Ehrlich gesagt, gefällt er mir auch ganz gut – besser als Waldi, Paulus oder andere Abwandlungen meines Namens. Und ich mochte Pauli auch lieber als Rotfuchs, wie ich später auf dem Kiez genannt wurde, in Anspielung auf meine rotblonden Haare. Vermutlich war mit Pauli mein Schicksal vorgezeichnet: Ich konnte nur in einem einzigen Hamburger Stadtteil landen – alles andere hätte keinen Sinn ergeben.
Zu einer ersten Herausforderung wurde für mich ein Besuch in der Pathologie des Instituts für Rechtsmedizin. Der Sektionssaal hatte Ähnlichkeit mit einem Operationssaal in Krankenhäusern. Der Fußboden und die Wände waren weiß gefliest, von der Decke leuchteten helle Neonröhren den Raum aus. Die Sektionstische waren aus Edelstahl und höher als normale Tische, sodass der Pathologe und seine Mitarbeiter bequem im Stehen daran arbeiten konnten. Man hatte uns geraten, ein mit Aftershave oder Parfüm getränktes Taschentuch unter die Nase zu halten, um zu verhindern, dass uns übel wurde. Trotzdem war der Leichengeruch überall, er setzte sich in Haaren, Mund und Nase fest.
«Meine Damen und Herren», mahnte der Pathologe, «aus Pietätsgründen bitte ich Sie, während der Sektion keine Witze oder anzügliche Bemerkungen zu machen.»
Wir waren jung, die Atmosphäre war irgendwie gespenstisch. In solchen Situationen lässt sich mit Humor mitunter Angst oder Unsicherheit überspielen. Doch wir hielten uns zurück und verfolgten mit Schaudern die Arbeit des Pathologen.
Die Leiche auf dem Obduktionstisch war männlich und im Alter von siebenundsechzig Jahren verstorben. Als man ihn fand, ließ sich kein zuständiger Hausarzt ermitteln. Kein Mediziner war bereit, einen Totenschein auszustellen und damit zu bescheinigen, dass der Mann eines natürlichen Todes gestorben war.
Der Pathologe machte mit seinem Skalpell zuerst den Y-Schnitt. Zwei Schnitte führten von den Schlüsselbeinen bis zum Brustbein und von dort senkrecht hinab zum Schambein. Dann wurde der Brustkorb aufgeklappt, mit einer Zange wurden die Rippen durchtrennt und anschließend die Organe aus der Brust- und Bauchhöhle entnommen. Herz, Lunge und Magen wurden dann zur Feststellung der Todesursache von dem Rechtsmediziner begutachtet.
«Ich lege jetzt die Schädeldecke frei …», kündigte der Pathologe an und durchtrennte mit einem kleinen elektrischen Winkelschleifer, einer sogenannten Flex, die Kopfhaut im Halbkreis von einer Stirnseite über den Hinterkopf zur anderen Stirnseite. Nun zog er die Haare des Hinterkopfes in Richtung Gesicht und trennte somit Haar und Haut vom Schädel. In etwa so müssen die Indianer ihre Opfer skalpiert haben. Das Haar samt Haut überdeckte nun das Gesicht der Leiche.
Der Rechtsmediziner griff erneut zum Winkelschleifer und trennte die Schädeldecke vom Rest des Kopfes. Das Gehirn lag jetzt frei und wurde von dem Pathologen untersucht. Es war eine Grenzerfahrung, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Mit kalter Mechanik wurde hier ein Mensch, der vermutlich noch vor wenigen Tagen mitten im Leben gestanden hatte, in seine Einzelteile zerlegt. Ich hatte ein beklemmendes Gefühl. Der Tod war in jeder Ecke des Raumes gegenwärtig. Besonders schlimm waren die sich überlagernden Gerüche. Kurz vor seinem Tod hatte der Verstorbene offensichtlich Erbsensuppe gegessen – der Geruch mischte sich mit dem verdorbenen Fleisches, einer undefinierbaren süßlichen Note und dem Gestank nach septischen Lösungsmitteln. Ich habe diese Gerüche bis heute nicht vergessen.
Niemand sprach, lediglich die routinierte Arbeit des Pathologen sowie das Krachen, Sägen und Fiepen seiner Arbeitsgeräte erfüllten den Raum. Für die meisten von uns angehenden Polizisten war das die erste Begegnung mit dem Tod. Und darin lag auch der Sinn der Veranstaltung: Ziel war es, uns mit dem Tod zu konfrontieren, damit sich bei uns einmal so etwas wie Routine im Umgang mit Leichen einstellen konnte.
Die Sektion ergab, dass der Mann an einem Herzinfarkt gestorben war. Doch als das verkündet wurde, hatte bereits ein Drittel unseres Lehrganges den Raum verlassen. In späteren Jahren bemerkte ich, dass viele Kollegen der Leichen- und Vermissten-Dienststelle Trinker waren.
Wir Lehrgangsteilnehmer waren ein buntgemischter Haufen, mit ganz unterschiedlichen Ambitionen. Meine zwei Zimmergenossen gaben schnell auf, kündigten.
Horst, ein Polizeianwärter von überdurchschnittlicher Intelligenz, fiel mir auf, weil er ständig meckerte: «Ist doch alles scheiße, was machen wir hier eigentlich? Wir sind doch nur die Erfüllungsgehilfen für die machthungrigen Politiker! Uns fragt eh keiner, ob wir mit den Maßnahmen einverstanden sind, wir haben nur wie Marionetten zu reagieren!»
Später absolvierte er einen Kriminalbeamtenanwärter-Lehrgang, brach ab und ging zurück zur Schutzpolizei. Eines Morgens hörte ich, dass er am Tag zuvor festgenommen worden war, weil er in Hamburg-Dehnhaide eine Sparkasse überfallen hatte. Er wurde zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, lebte nach seiner Haftentlassung einige Jahre im St.-Pauli-Milieu, bis er starb. Manchmal sind die Grenzen zwischen Gesetzeshütern und -brechern fließend.
1967 wurde ich zum Wachtmeister ernannt und wechselte auf die gegenüberliegende Straßenseite des Komplexes in Hamburg-Alsterdorf. Dort, auf dem Gelände der Hindenburgstraße, waren die Bereitschaftspolizei, mein neuer Arbeitgeber, und später das Mobile Einsatzkommando untergebracht. Die Bereitschaftspolizei ist der Landespolizei unterstellt, fungiert aber als Großverband beinahe schon militärisch und ist stets bei sogenannten Großlagen gefragt – Krawallen, Protesten, Massenaufläufen. Und solche Ereignisse gab es damals viele, denn es war die Geburtsstunde der APO, der Außerparlamentarischen Opposition. Der alte Obrigkeitsstaat, geprägt durch die Erfahrungen der Kriegsniederlage und des Kalten Krieges, begann sich zu verändern. In der Bevölkerung gab es nicht wenige, die den Staatsapparat als autoritär empfanden. Vor allem Intellektuelle. Als im Juni 1967 bei einer Großdemonstration in Berlin der Student Benno Ohnesorg mit einem Schuss in den Hinterkopf vom Kriminalbeamten Karl-Heinz Kurras getötet wurde, war das wie eine Initialzündung für die kommenden Unruhen. Die Radikalisierung und zunehmende Gewaltbereitschaft waren spürbar, vor allem für uns, die wir an vorderster Front standen.
Zugegebenermaßen hatte ich anfangs Probleme, die politische Entwicklung zu verstehen und die Geschehnisse einzuordnen. Ich war naiv, politisch «unschuldig», kam ich doch aus der heilen Welt eines Dorfes, wo dem Bürgermeister, dem Pastor und dem Polizisten stets Respekt entgegengebracht worden war. Sitte und Anstand waren die Koordinaten meines Handelns, ich hielt gewisse Regeln ein, Aufbegehren und Opposition waren für mich Fremdwörter.
Anfangs hegte ich begrenzte Sympathien für diese frechen, rebellischen Studenten, weil sie den autoritären Staat auf die Schippe nahmen – mit friedlichen, manchmal spaßigen Mitteln. Überall waren noch Alt-Nazis in Amt und Würden, das empfand ich als empörend. Darüber hinaus hatte ich Probleme mit der autoritären Struktur bei der Bereitschaftspolizei, der militärische Drill war nicht meine Welt.
Polizeilichen Drill und Schikane bekam vor allem mein damals bester Freund Ferdie zu spüren. Er stammte ursprünglich aus...
| Erscheint lt. Verlag | 1.10.2012 |
|---|---|
| Co-Autor | Harald Stutte |
| Verlagsort | Hamburg |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |
| Schlagworte | Hamburg • Kiez • Polizei • Reeperbahn • St. Pauli |
| ISBN-10 | 3-644-47541-5 / 3644475415 |
| ISBN-13 | 978-3-644-47541-0 / 9783644475410 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 871 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich