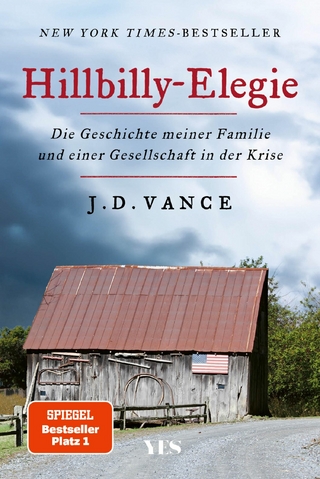Talking Jazz (eBook)
208 Seiten
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH
978-3-462-30117-5 (ISBN)
Till Brönner, geboren 1971 in Viersen. Aufgewachsen in Rom. Nach einer klassischen Ausbildung auf dem Instrument Studium der Jazztrompete an der Musikhochschule Köln bei Malte Burba und Bobby Shew. Von 1991-1998 Mitglied der RIAS-Bigband. Für seine Tourneen und Alben erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Preise, darunter vier Echo-Musikpreise.
Till Brönner, geboren 1971 in Viersen. Aufgewachsen in Rom. Nach einer klassischen Ausbildung auf dem Instrument Studium der Jazztrompete an der Musikhochschule Köln bei Malte Burba und Bobby Shew. Von 1991–1998 Mitglied der RIAS-Bigband. Für seine Tourneen und Alben erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Preise, darunter vier Echo-Musikpreise.
Als Jazzfan wird man ja nicht geboren
Es kann allerdings sehr früh anfangen. Meine Eltern waren nicht das, was man Jazzfans nennen würde. Sie hatten eine ganz bescheidene Schallplattensammlung, das meiste war Klassik. Sie waren einfach musikalische Menschen, sie haben Radio gehört, und vielleicht war es, ohne dass ich damals schon einen Plan gemacht hätte, das, warum ich Trompeter geworden bin: Wenn Louis Armstrong im Radio kam, hat mein Vater das Gerät sofort lauter eingestellt. Er liebte Louis Armstrong, und ich liebte ihn auch. Der erste Jazz, an den ich mich erinnern kann, war Louis Armstrong. Er war der erste Jazzmusiker, den ich beim Namen kannte. Der erste, den ich am Klang seiner Trompete und natürlich an seiner Stimme sofort erkannte.
Ein Glück, wenn einer musikalische Eltern hat
Der Musikgeschmack meiner Eltern hatte seine Wurzeln noch in den Fünfzigerjahren. Meine Mutter fand Gilbert Becaud schon sehr modern. Die Beatles, die mochte sie auch, aber was dann nach 1968 kam, Männer mit Gitarren und langen Haaren, das mochten sie beide nicht. Mein Vater hat gemäßigte Musik gehört. Im Radio, sonntagmorgens, kam eigentlich immer klassische Mu sik, etwas Jazziges zwischendurch. Im WDR gab es eine Sendung, die hieß »Swing und Balladen«, die hat mein Vater fast immer gehört. Und ich habe fast immer mitgehört.
Die erste Platte
Es gab eine Platte, die liebte mein Vater heiß und innig. Sie war von André Previn, den heute die meisten nur als den Exmann von Anne-Sophie Mutter kennen und die meisten anderen als klassischen Pianisten und Dirigenten. Aber Previn hat als Jazzmusiker angefangen, und mein Vater hatte eine Platte von ihm, da gefiel mir schon das Cover extrem gut. Ein Frauengesicht, eine Blondine, die so herausfordernd schaut, dass auch der Weichzeichner diese Provokation kaum mildern konnte. Und in großen Buchstaben steht da: »Soft and Swinging«. Es war mehr Easy Listening als Jazz, aber immer noch Jazz genug, Previns Piano, mal mit Trio, mal mit Orchester; die Platte ist verloren gegangen, aber das Cover habe ich noch genau vor Augen, und die Songs, glaube ich, waren einfach und heiter, »I Can’t Give You Anything But Love«, oder »On the sunny Side of the Street«.
Mein Vater hat diese Platte gehütet wie nichts anderes, und diese Wertschätzung habe ich dann von ihm gelernt. Diese Platte rief ein Gefühl hervor, ein starkes Gefühl – von heute aus betrachtet, ist es vielleicht gar nicht so interessant, dieses Gefühl zu beschreiben. Wichtiger war das: zu lernen, wie stark die Gefühle sind, die die Musik hervorrufen kann. Zu lernen, dass die Musik etwas mit einem macht. Darum geht es eigentlich immer.
Und der Look, das Versprechen, welches das Plattencover formuliert, gehört dazu
Es ist seltsam, weil mir einerseits so viele Posen zuwider sind. Aber andererseits: Das war schon sehr verführerisch für mich, wenn im Fernsehen eine Big Band kam. James Last, Horst Jankowski, ich bin mir nicht sicher, ob vielleicht meine Begeisterung fürs Aussehen schon vor meiner Begeisterung für die Musik da war. Ich liebte Uniformen, ich konnte mich in Italien, wo die Uniformen besonders elegant sind, kaum sattsehen daran, aber die beste Uniform, das fand ich schon als kleiner Junge, das waren die Smokings der Musiker in den Big Bands. So, fand ich, müssen Männer aussehen, solche Frisuren, solche Koteletten, schöne, breite Koteletten, und dazu Smoking tragen. Ein schwarzer Smoking, manchmal auch ein weißer, dazu das Gold der Instrumente: Ich glaube, ich war von diesem Anblick schon hingerissen, bevor ich anfing, genauer auf die Musik zu achten.
Die Musik der Big Bands, das war ja nicht gerade auf der Höhe der Zeit
Einmal, ich war elf oder zwölf, kam mitten in der Nacht, so kam es mir jedenfalls vor, ich schlief längst, mein Vater in mein Zimmer und zerrte mich richtig heraus aus dem Bett.
Du musst kommen, schnell, komm sofort, sagte er, und er setzte mich vor den Fernseher, wo die Sendung »Bio’s Bahnhof« lief. Ich sah, wie Alfred Biolek dastand und lachte, ich schaute hinein in den Schwarz-Weiß-Fernseher, den wir damals noch hatten, und sah diesen Typen im Kaftan, mit Backen, aufgeblasen wie ein Frosch, die Trompete war hochgebogen. Ich sah also, wie Dizzy Gillespie spielte, der unglaubliche Dizzy Gillespie spielte »A Night in Tunisia«, das war ein ganz unglaublicher Moment. Ich war natürlich nicht richtig wach, es war, als ob mir Dizzy Gillespie im Traum erschienen wäre.
Und dazu spielte die Big Band von Peter Herbolzheimer, »Peter Herbolzheimer Rhythm Combination & Brass«, deren große Zeit war noch gar nicht vorbei. Es war ihre große Zeit, niemand brachte in diese Sendung seine eigene Band, sein Orchester mit, die größten Stars spielten oder sangen mit Herbolzheimers Big Band. Ich weiß noch, wie Sammy Davis jr. in »Bio’s Bahnhof« aufgetreten ist, er sang erst »New York, New York«, dann plauderte er extrem entspannt mit Biolek, und dann sang er »The Lady is a Tramp«, war fertig, wurde vom Publikum angefeuert und sang noch eine Strophe. Und am Schluss setzte er sich ans Schlagzeug und spielte mit der Band, und alle hatten unglaublich gute Laune. Das, diese unglaubliche Stimmung, dieser Sound, den ich gar nicht als unzeitgemäß empfand, das war, was ich mir unter einer Big Band vorstellte.
Das Radio und das Fernsehen als Erzieher
Bevor ich anfing mit der Trompete, hatte ich schon begonnen, mir das Klavierspielen selber beizubringen. Meine Mutter hatte ein schönes Schimmel-Klavier mit in die Ehe gebracht, ein sensationell schönes Instrument aus den Fünfzigerjahren, auf dem habe ich mir das Klavierspielen selber beigebracht. Unterricht wollte ich nicht, klassische Klaviermusik interessierte mich nicht, ich war ein besessener Verehrer von Oscar Peterson.
Ein Kind, das Oscar Peterson sein will
Das Kind fängt natürlich an, auf dem Klavier herumzuhauen, weil das Klavier eben da ist. Und weil jeder da einen Ton herausbekommt. Du haust auf eine Taste, die bewegt einen kleinen Hammer, der auf eine Seite schlägt. Und wenn das Klavier nicht verstimmt ist, kommt da ein schöner, reiner Ton heraus. Das ist der wesentliche Unterschied zu den Blechblasinstrumenten. Aus denen kommt nur heraus, was du hineinbläst. Das ist das reine Glück, so ein Klavier, wenn dich niemand in die Klavierstunde prügelt.
Wie man sich selber das Klavierspielen beibringt
Zum Glück hat mich eben niemand in den Klavierunterricht gezwungen, ich lernte ja schon ein Instrument auf die orthodoxe Art – erst Blockflöte, dann Trompete. Das gab mir die Freiheit, auf dem Klavier zu tun, was ich wollte. Ich kann bis heute nicht richtig Klavier nach Noten spielen. Ich kann die Noten für die Melodie lesen, ich weiß, wie man mit der linken Hand Akkorde dazu greift, das ist es aber auch. Ich wollte Vergnügen haben auf dem Klavier, und mein Vergnügen sah so aus: Neben meinem Bett stand mein Radiorekorder, auf dem sollte ich mir zum Einschlafen irgendwelche Geschichten anhören. Ich nahm aber lieber die Jazz-Sendungen im Radio auf, und dann hatte ich »Night Train« von Oscar Peterson auf der Kassette, ein herrlich swingender Blues. Ich habe das Gerät aufs Klavier gestellt und kleine Passagen, immer nur ein paar Takte, so oft nachzuspielen versucht, bis es endlich ging. Bis ich es konnte.
Man muss die großen Meister kopieren, wenn man etwas lernen will
Ich verstehe bis heute nicht, dass meine Mutter nicht wahnsinnig geworden ist davon. Acht Takte, manchmal nur vier Takte, abgespielt auf dem Rekorder, dann nachzuspielen versucht, dann wieder das Band zurückgespult, hundert Mal vielleicht, nur nach Gehör. Und als ich die Passage dann einigermaßen konnte, war ich so stolz, dass ich sie in jedes Stück eingebaut habe, das ich sonst noch gespielt habe. Und so ist es weitergegangen: Ich hatte Lieblingstonarten, b zum Beispiel, dann habe ich zwei Wochen lang nur in b gespielt. Und die nächsten zwei Wochen in G, auch eine schöne Tonart. Und ich entdeckte, dass man auf so einem Schimmel-Klavier einen schönen Boogie-Woogie-Sound spielen kann, dass man Klänge so hinbekommt, dass du fast schon den Mississippi im Hintergrund rauschen hörst.
Und jeden Abend, von halb acht bis acht Uhr, saß ich wieder vor dem Radio, hörte die »Jazz Time« im Südwestfunk, nahm neue Stücke auf, ich habe an diesem Radio gehangen und war süchtig nach der Sendung; keiner durfte mich stören. Manche Aufnahmen habe ich heute noch, eine, vielleicht meine liebste, die ich heute natürlich auch als CD habe: der wunderbare Tenorsaxofonist Ben Webster mit Harry »Sweets« Edison, einem Swing-Trompeter, der nie so berühmt wurde wie Dizzy Gillespie, Miles Davis oder Chet Baker und der doch viele beeinflusst hat, links und rechts von ihm. »A Taste on the Place« heißt das Stück, das mit Websters warmem Tenorsaxofon beginnt. Und dann kommt Harry »Sweets« Edison...
| Erscheint lt. Verlag | 5.10.2010 |
|---|---|
| Verlagsort | Köln |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft | |
| Schlagworte | Biografie • Dozent • Erfolg • Jazz • Kunst • Künstler • Lehrer • Musiker • Musik-Forscher • Till Brönner |
| ISBN-10 | 3-462-30117-9 / 3462301179 |
| ISBN-13 | 978-3-462-30117-5 / 9783462301175 |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,7 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich