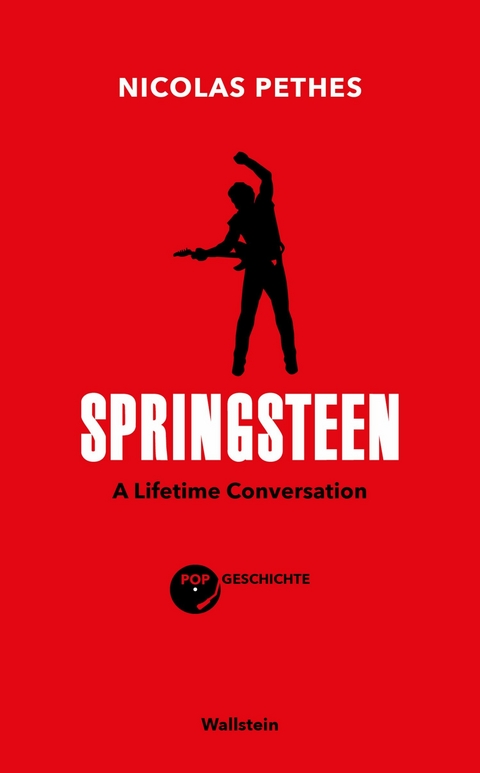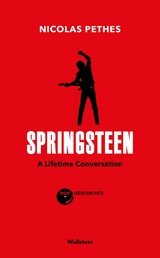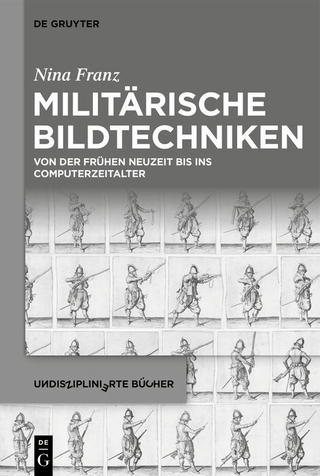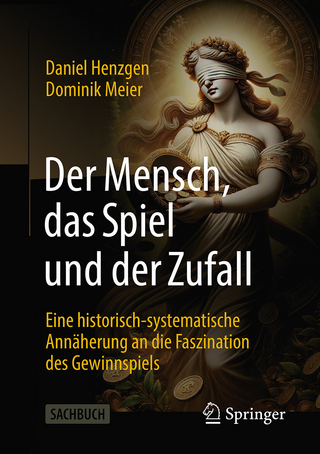Springsteen (eBook)
216 Seiten
Wallstein Verlag
978-3-8353-8745-4 (ISBN)
Nicolas Pethes, geb. 1970, ist Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität zu Köln. Er hat Forschungsprojekte zu medizinischen Fallgeschichten, zur Zeitschriftenliteratur und zur Geschichte medienkritischer Diskurse geleitet und ist seit 2012 Mitherausgeber der Zeitschrift »Pop. Kultur und Kritik«. Veröffentlichungen: Medienkritik und Wirkungsästhetik. Diskurse über Rezeptionseffekte (1750 bis heute), hg. zusammen mit Susanne Düwell, 2023; Lesen/Sehen. Literatur als wahrnehmbare Kommunikation, hg. mit Charlotte Coch und Torsten Hahn, 2023; Vermischte Schriften. Jean Pauls Romananthologie D. Katzenbergers Badereise (1809), 2022.
Nicolas Pethes, geb. 1970, ist Professor für Neuere deutsche Literatur an der Universität zu Köln. Er hat Forschungsprojekte zu medizinischen Fallgeschichten, zur Zeitschriftenliteratur und zur Geschichte medienkritischer Diskurse geleitet und ist seit 2012 Mitherausgeber der Zeitschrift »Pop. Kultur und Kritik«.
1 »A means of communication«
Verbindungen suchen
An einem wolkenverhangenen Vormittag kurz vor Frühlingsanfang gehe ich über den Boardwalk am Atlantikstrand von Asbury Park, New Jersey. Im Sand steht ein Schild, das Gäste mit der Aufschrift »Greetings from Asbury Park« begrüßt. Ein paar Schritte links davon ist auf der Bude einer Wahrsagerin »Madam Marie’s« zu lesen und dahinter auf Ocean Avenue das flache, weiße Backsteingebäude mit der Aufschrift »The Stone Pony« zu sehen, in dem ich am Abend ein paar lokale Nachwuchsbands hören werde. Ich bin am Tag zuvor nach dem Konzert von Bruce Springsteen und der E Street Band in Philadelphia über Freehold und Colts Neck hierhergefahren und wohne im Empress-Hotel, dessen Schriftzug man spiegelverkehrt auf dem Cover von Springsteens erster Top Ten-Single, »Hungry Heart« von 1980, erkennen kann. Zum ersten Mal bewege ich mich also zwischen den Erinnerungsorten, an denen Springsteens Karriere vor über einem halben Jahrhundert begonnen und die er immer wieder besungen hat. »Seaside Bar Song«. »Born to Run«. »My Hometown«. »Tunnel of Love« (ein Songtitel, dessen Schriftzug eine weitere Bar auf Ocean Avenue ziert). »My City of Ruins« …
Während mir trotz der menschenleeren Spielarkaden an der Uferpromenade leise die Zeile »a carnival life forever« aus dem Song »4th of July, Asbury Park (Sandy)« durch den Kopf geht, schließt sich ein Kreis zu der Zeit, in der ich Springsteens Musik das erste Mal gehört habe – in einer südwestdeutschen Kleinstadt Mitte der 1980er Jahre vor dem Kassettenrekorder kauernd, um bei der Hitparade auf SWF 3 rechtzeitig auf »play« und »record« zu drücken, wenn das Intro eines Stücks vielversprechend klang. Bis meine druckbereiten Finger einmal erstarrten, als über einem gedämpften Gitarrenpicking eine Stimme ertönte, deren physische Präsenz im Raum sich direkt an mich zu richten schien. Was diese Stimme sang, verstand ich seinerzeit noch gar nicht so richtig, aber dass da jemand »on fire« war, vermittelte sich auch so – und galt von diesem Augenblick an auch für mich.
Die Wirkung dieser zündenden Begegnung hat sich als nachhaltig erwiesen. Auf der wenig später angefertigten Kassettenkopie von Bruce Springsteens Album Born in the U. S. A. folgte auf »I’m on Fire« der Schlagzeugwirbel, der »No Surrender« eröffnet, eine Hymne auf den Jugendtraum von Freiheit und Musik. »We learned more from a three minute record, baby / Than we ever learned in school«, lautete hier die Botschaft, deren Wahrheit ich gerade am eigenen Leib erfuhr, und auch der Glaube »we could cut someplace of our own with these drums and these guitars« schien kein bloßer Wunschtraum, sondern hier tatsächlich verwirklicht worden zu sein.
Fast vierzig Jahre nach dieser Begegnung eröffnet »No Surrender« auch das erste Konzert, das ich auf Springsteens Tour 2023 in Philadelphia besuche, und wenige Tage darauf höre ich in State College, Pennsylvania auch »I’m on Fire«. Das ist nicht unbedingt ein Lieblingslied, aber eines, dessen ungezähltes Erklingen zwischen Konstanz am Bodensee und dem Hinterland östlich des Susquehanna für die Beständigkeit eines Gefühls steht, das mein Erwachsen- und Älterwerden begleitet hat: von dieser Musik und dieser Stimme angesprochen zu werden.
Dieses Gefühl hat offensichtlich keine reale Grundlage. Popmusikerinnen und Popmusiker singen in Studiomikrophone bzw. sehen bei Live-Auftritten ihr Publikum im Gegenlicht der Scheinwerfer kaum – geschweige denn, dass sie einzelne Fans adressieren können. Und dennoch ist es als Gefühl real und wird, im Fall von Springsteen, zudem von Millionen Menschen weltweit geteilt. Man muss nur einen Blick in Fanforen wie Backstreets BTX werfen, eine Folge des Podcasts That One Lyric hören oder den Dokumentarfilm Springsteen and I ansehen, um einen Eindruck davon zu erhalten, wie viele Menschen Springsteens Musik nicht nur schätzen, sondern empfinden, dass sie ihr Leben berührt und geprägt hat. Trotz seines seit Jahrzehnten etablierten Status als Superstar und obwohl ihm all diese Fans im Regelfall nie begegnet sind, nehmen Fans Bruce Springsteen als authentisch greifbare Person wahr, deren Songtexte, Bühnenansprachen und Interviewaussagen Botschaften vermitteln, die als energetisierende Inspiration, sinnstiftende Stütze und mitunter sogar als rettender Ausweg aus Lebenskrisen beschrieben werden.
Diesen Empfindungen wollte ich nach meinen Eindrücken aus Asbury Park und den vielen Begegnungen mit anderen Springsteen-Anhängerinnen und -Anhängern in Philadelphia, State College sowie einer Reihe weiterer Orte auf der Europatour im Frühjahr und Sommer 2023 nachgehen: Wie ist es möglich, dass sich Fans immer wieder aufs Neue gemeint und verstanden fühlen, wenn sie Songs wie »Thunder Road«, »Badlands« oder »The River« hören? Um eine solche Beziehung zwischen einem Künstler und seinem Publikum nachvollziehen zu können, müsste man Popmusik selbst als eine bestimmte Form von Kommunikation begreifen – und genau das möchte ich in diesem Buch versuchen.
Bruce Springsteen ist in der langen Geschichte der Pop- und Rockmusik nur ein Beispiel für einen solchen kommunikativen Austausch – schon für den Beginn der Erfolgsgeschichte des Rock’n’Roll war es dem Produzenten Sam Phillips zufolge der »factor of communication«, den Elvis Presley anderen Künstlerinnen und Künstlern voraushatte (Guralnick 1994, 141). In den 1960er und 70er Jahren waren es die Grateful Dead, die für ihre Anhänger (die »Deadheads«) zum lebensbegleitenden Soundtrack wurden. Jüngeren Jahrgängen werden Pink, Taylor Swift oder Harry Styles näherstehen – auch deren Erfolg beruht darauf, sich als nahbare und warme Persönlichkeiten zu geben, die Kontakt zu ihrem Publikum suchen. Und doch scheint die Verbindung, die Fans über Jahrzehnte hinweg mit Springsteens Musik und Person empfinden, in der Popgeschichte von besonderer Intensität zu sein – zumal vor dem Hintergrund, dass andere Stars wie Bob Dylan, Mick Jagger oder Madonna ihren Erfolg auf das entgegengesetzte Modell gründen und auf eine Aura des Geheimnisses, der Coolness oder der Unnahbarkeit setzen. »[H]e’s real«, hat Foo Fighters-Sänger Dave Grohl nach einer Begegnung mit Springsteen einmal als Grund angegeben, warum »millions of people identify with him« (Dore 2022, 267). Und der Singer-Songwriter Steve Earl hat in einem jüngeren Interview bündig befunden: »Bruce Springsteen is the best communicator I ever saw in rock’n’roll.« (Ebd., 148)
Der besondere Stellenwert dieser Vorstellung einer Kommunikation zwischen Künstler und Publikum gründet auch darauf, dass Springsteen sie selbst zum Kern seiner Karriere erklärt hat. So sagte er 2012 in einem Gespräch mit dem Comedian Jon Stewart im Rolling Stone:
The only thing I do keep in mind is that I’m in the midst of a lifetime conversation with my audience, and I’m trying to keep track of this conversation […], while giving myself the musical freedom I need. […] I’m proud of our band in that we’ve maintained an audience who want to listen to us, in the sense that they’re interested in not just what you were saying in ’85 or ’80, but interested in what we’re saying right now – what’s the next step we’re going to take together, what are we going to argue about, what are we going to debate the meaning of? (Stewart 2012, 43)
Den Grundstein für diese Fancommunity hat der 1949 geborene Springsteen Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre mit verschiedenen Bar-Bands in dem Küstenstädtchen Asbury Park eine Autostunde südlich von New York gelegt. Sein erstes Album – dessen Titel eine Postkarte der Stadt zitierte und im Gegenzug heute auf dem eingangs beschriebenen Schild am Strand zitiert wird – brachte ihm 1973 den Ruf eines »New Dylan« ein. Im Jahr 1975 gelang ihm mit dem Album Born to Run der Durchbruch als »rock and roll future«, und seit der Tour zu Darkness on the Edge of Town von 1978 gelten Bruce Springsteen und die E Street Band als einer der besten Live Acts der Rockgeschichte. Ihren Höhepunkt erreichte diese Karriere mit dem Album Born in the U. S. A. und der anschließenden Welttournee 1984 /85 (vgl. Marsh 1987). Zu ihren Besonderheiten gehört aber, dass Springsteen die Konversation mit seinem Publikum nicht nur aufrechterhalten, sondern in späten Alben wie The Rising (2002) oder Wrecking Ball (2012) weiter vertieft hat, so dass seine Tourneen auch nach einem halben Jahrhundert immer noch in Minutenschnelle ausverkauft sind und Konzerte des mittlerweile weit über siebzigjährigen Musikers generationenübergreifenden Massenpartys gleichen.
Und obwohl man Teil eines solchen Massenpublikums ist, kann man sich persönlich angesprochen und als Teil einer »lifetime conversation« fühlen. Das ist auf den ersten Blick erstaunlich, anhand einiger Besonderheiten von Springsteens Arbeit aber durchaus erklärbar: Seine Liedtexte handeln von persönlichen Erfahrungen, Hoffnungen und Verletzungen und vermitteln diese in Bildern und Szenen, die zwar individuell und persönlich, zugleich aber offen und verallgemeinerbar sind. Hinzu kommt, dass sie in der Abfolge von Springsteens Alben sämtliche Lebensphasen von der Adoleszenz bis zum Alter abdecken und damit gewissermaßen ein lebenslanges Identifikationsangebot machen. Springsteens Musik ist damit ein Gegenentwurf zum Programm des »I hope I die before I get old«, wie es The...
| Erscheint lt. Verlag | 11.9.2024 |
|---|---|
| Reihe/Serie | Popgeschichte |
| Mitarbeit |
Herausgeber (Serie): Gerhard Kaiser |
| Verlagsort | Göttingen |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geschichte ► Teilgebiete der Geschichte ► Kulturgeschichte |
| Schlagworte | Alben • Beziehung • Biographie • Botschaften • Emotionen • Fankultur • Fans • Gesellschaftspolitik • Hymnen • Kommunikation • Kontakt • Künstler • Musik • musikalische Tradition • Musikgeschichte • Parasoziale Beziehungen • Popkultur • Publikumskontakt • Rock'n'Roll • Tour |
| ISBN-10 | 3-8353-8745-6 / 3835387456 |
| ISBN-13 | 978-3-8353-8745-4 / 9783835387454 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,5 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich