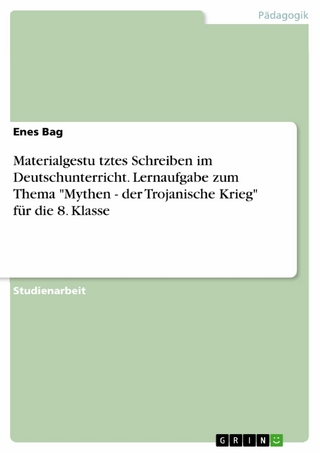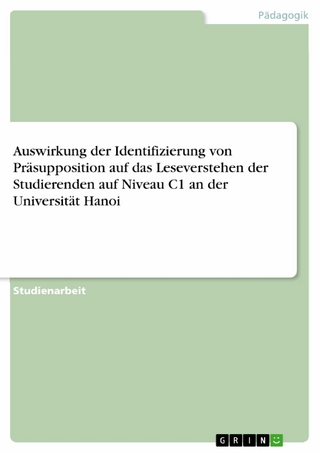Vergnügen (eBook)
144 Seiten
StudienVerlag
978-3-7065-6310-9 (ISBN)
IDE ist die Zeitschrift für den Deutschunterricht. IDE hält den Dialog zwischen der Praxis in der Schule und didaktischer Forschung aufrecht. IDE ist das Podium für den ständigen Erfahrungsaustausch zwischen DeutschlehrerInnen in der Praxis. IDE öffnet Klassenzimmer und Konferenzräume: Informationen und Kommunikation über Praxis und Projekte, über Erfahrungen, Reaktionen, über Wünsche und Horizonte. Für alle Schultypen. Für alle Schulstufen. IDE - INFORMATIONEN ZUR DEUTSCHDIDAKTIK erscheint viermal im Jahr.
IDE ist die Zeitschrift für den Deutschunterricht. IDE hält den Dialog zwischen der Praxis in der Schule und didaktischer Forschung aufrecht. IDE ist das Podium für den ständigen Erfahrungsaustausch zwischen DeutschlehrerInnen in der Praxis. IDE öffnet Klassenzimmer und Konferenzräume: Informationen und Kommunikation über Praxis und Projekte, über Erfahrungen, Reaktionen, über Wünsche und Horizonte. Für alle Schultypen. Für alle Schulstufen. IDE – INFORMATIONEN ZUR DEUTSCHDIDAKTIK erscheint viermal im Jahr.
Vergnügungstheoretische Überlegungen für Wissenschaft und Schule
[…] eine vollkommene Ordnung wäre sozusagen der Ruin alles Fortschritts und Vergnügens. (Musil 2002, S. 1451)
Ich bin nicht hier, um mich zu bemühen
Ich bin hier, um zu glüh’n
Ich bin hier, um zu blüh’n
Ich bin nicht hier, um dir zu gefall’n
Ich bin nicht hier für die Bilanz
Ich bin hier für den Glanz
Und ich bin hier für den Tanz
Ich bin nicht hier, um dir zu gefall’n
Ich bin nicht hier, um dir zu gefall’n
Nein, ich bin hier für die Sterne
Und ich bin hier sehr gerne
Und ich bin hier, weil ich lerne
Ich bin nicht hier, um dir zu gefall’n
Ich bin nicht hier, um dir zu gefall’n
(Dota 2018)
»Intensives, hier und jetzt« (Moser 2006a, S. 9)
Das vorliegende Heft ist unserer lieben Kollegin und Freundin Gerda Elisabeth Moser gewidmet, die am 29. April 2021, für uns alle völlig überraschend, verstorben ist. Wiewohl wir sie sehr vermissen, möchten wir dieses Heft nicht nur der Erinnerung an sie widmen, sondern als eine Gelegenheit begreifen, ihr Schaffen und Denken, ihr oft ungewöhnliches und gänzlich unkonventionelles Forschen und Handeln weiterwirken zu lassen. Gerda hat für und über Menschen geforscht und nicht in erster Linie für die akademische Community, so geschätzt ihre Erkenntnisse in dieser auch waren. Es war ihr immer ein besonderes Anliegen, Aspekte ihrer wissenschaftlichen Arbeit mit der unterrichtlichen Praxis in Verbindung zu bringen, so dass sie dort wirksam werden und insbesondere jungen Menschen die Zugänge einer aufgeschlossenen Wissenschaft verdeutlichen kann, die über kulturelle Phänomene der Gegenwart nachdenkt. So hat Gerda E. Moser mit uns gemeinsam Tagungen gestaltet, publiziert, ist zur Herausgeberin eines ide-Heftes geworden und ihre »Auftritte« bei Lehrer:innenfortbildungen, etwa im Rahmen unserer PFL-Lehrgänge, waren immer äußerst beliebt und sind im Gedächtnis geblieben. Das hatte wohl mehrere Gründe: Einerseits war das darauf zurückzuführen, dass sie Dichotomien ablehnte, also auch jene, die hierarchische Unterschiede begründeten und die Schule von der Universität im Denken streng trennen. Derlei Gegensätze wusste Gerda gekonnt zu ignorieren, was Lehrpersonen wie Kolleg:innen nicht selten erstaunte, auch befremdete, etwa wenn sie den kommerziellen computeranimierten Trickfilm Madagascar für die Verwendung in Bildungskontexten als ebenso geeignet erachtete wie die populäre Ratgeber- und Bestsellerliteratur. Mit ihr betraten also stets unerwartete oder marginalisierte Themen die akademische Bühne und es gab Neues zu denken und zu tun – eine Erfahrung, die uns gerade in Bildungskontexten häufig fehlt und nach der sich viele, die in diesen arbeiten, sehnen.
»Genießen, das sich selbst genügt, ist nicht daran interessiert, Herrschaft auszuüben.« (Moser 2006b, S. 10)
Selbstverständlich wäre es für Gerda nicht infrage gekommen, derlei Medien unreflektiert einzusetzen – woraus die Welt beschaffen war, in allen ihren Teilen, war für sie interessant, wertvoll, vergnüglich, aber auch der Analyse und des Hinterfragens würdig. Mit Gerda zu arbeiten war meist ein humorvolles, lebendiges Ereignis, und diese Lust am präzisen Wahrnehmen und Denken konnte sie wunderbar auf ihre Zuhörer:innen übertragen, deren Anmerkungen und Fragen sie immer ernst genommen hat. Sie wollte ihre Arbeit dem widmen, was das Leben der Menschen in seiner populär-kulturellen Dimension ausmacht, und hat deshalb gerade den üblicherweise nicht als »beforschenswert« erachteten kulturellen Erzeugnissen – Filmen, Bildern, Fotografien etc. – ihre Aufmerksamkeit und ihr scharfes analytisches Verständnis gewidmet. Nicht zuletzt, aber auch nicht zuvorderst, um die Strukturen freizulegen, die sich dahinter verbergen, jene der Macht, der Simplifizierung komplexer Zusammenhänge, aber auch jene des Vergnügens und des (konsumierenden) Genusses. Sie mochte noch so sehr durch die Schule Theodor W. Adornos gegangen sein, die Lust am Konsumieren ließ sich Gerda nicht austreiben, weder als Privatperson noch als Wissenschaftlerin. Die neue bunte Hose oder der Eisbecher beim Uniwirt waren ihr lieb und teuer und über die Scherze in Madagascar konnte sie herzlich lachen. Die Suche nach einem metaphysischen Sinn hat sie stets als durch den sinnlichen Genuss vertretbar betrachtet, und die Art und Weise, in der ihr die Emanzipation eines der wichtigsten Prinzipien überhaupt war, lässt sich nur als »ganzheitlich« bezeichnen. All das könnte nun aber auch auf einen Menschen zutreffen, der seine wissenschaftlichen Ziele vehement verfolgt und darüber den Genuss vergisst, mag er noch so sehr im Zentrum theoretischer Überlegungen stehen. Auf Gerda E. Moser traf das nicht zu, sie wusste Theorie und Lebenspraxis mit Leichtigkeit zu verbinden und hat das Potenzial dieser besonderen Begabung auch in ernsten, ja sogar in existenziell bedrohlichen Situationen genutzt.
»Genießen tut gut. Aus ihm ergeben sich weder Fragen noch Antworten. Diese entstehen im Leiden.« (Moser 2006a, S. 9)
Das hat die Ernsthaftigkeit des Erlebens, die Tiefe der Beobachtung und die Verletzlichkeit nicht gemindert, ganz im Gegenteil. »Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste«, behauptete Friedrich Hölderlin (1969, S. 256), die allzu profan erscheinenden Genüsse des Sokrates verteidigend, und das hätte Gerda wohl auch für ihr Verhältnis zu Vergnügen und Genuss als zutreffend bezeichnet. Sie konnte am Stammtisch mitdiskutieren, aber genauso bei einer wissenschaftlichen Tagung mit ihrer Eloquenz, dem umfangreichen Wissen und dem, was sie daraus im Rahmen ihrer Forschung gemacht hat, beeindrucken. Die Verbindung dieser vermeintlichen Gegensätze war ihr das Wertvollste und sie hätte niemals das eine gegen das andere ausgespielt oder sich eine Entscheidung zwischen beiden Welten abgerungen. Das Leben in dieser schillernden, sinnlichen und äußerst ambivalenten Fülle war ihr Element, nach einem anderen hat sie nicht gesucht, und so war ihr alles zusammengenommen letztlich ein Vergnügen, aus dem Sorge, Verlust und Trauer nicht ausgeschlossen waren.
»Eklektische Ansammlungen von Themen und Motiven« (Moser 2006a, S. 310)
In diesem Heft können wir nur einige der Themen ansprechen, mit denen sich die intellektuell so umtriebige Gerda E. Moser beschäftigt hat. Beinahe alle Autor:innen dieses Bandes haben Gerda persönlich gekannt und verspüren eine innere Verbundenheit, die oft das Private überschritten und ins Berufliche, also die einzelnen Forschungsinteressen, hineinragte. Dieser Band gewährt also all jenen, die Gerda nicht mehr kennenlernen konnten, einen kleinen Einblick in ihr Denken und erinnert jene, die sie gekannt, mit ihr gearbeitet und gelebt haben, an dessen Grundzüge.
Gleichzeitig hat dieses Heft aber auch den Lehrer:innen viel zu bieten. Die meisten Menschen haben die Schule nicht als einen Ort des Vergnügens kennengelernt und dabei wäre das doch, wenn wir Gerdas Überlegungen folgen, ein so selbstverständlicher und sinnvoller Zusammenhang, jener zwischen Bildung und Vergnügen. Den Gründen hierfür und auch der Frage, weshalb sich diese beiden Aspekte dann doch wieder nicht so einfach ineinanderfügen, geht Werner Wintersteiner in seinem Beitrag nach, in dem er sowohl ein ursprüngliches Vergnügen an der Bildung als auch den unauflöslichen Widerspruch zwischen Wollen und Müssen thematisiert, in dem die Institution Schule gefangen ist. Noch grundlegender widmet sich zuvor Alice Pechriggl der Frage danach, was denn das Vergnügen eigentlich sei. Die Annahme, dass dieses nicht ein in sich homogenes Geschehen sei, sondern aus unterschiedlichen Phasen bestehe, lässt uns einen differenzierteren Blick auf den vereinheitlichenden Begriff werfen, der dieses Heft dominiert. Das Vergnügen wird in diesem Beitrag außerdem in seinem Verhältnis zur Zeit, in seinen Verschränkungen mit der Negativität und auch dem Sinn als ein grundlegendes Phänomen von großer innerer Diversität betrachtet.
Doch nicht alles, was vergnüglich erscheint, ist hell, froh und strahlend. Den »dunklen Seiten des Vergnügens« widmet sich der Beitrag des Sozialwissenschaftlers Oliver Dimbath, der auf Schriftsteller:innen zu sprechen kommt, die für Gerda E. Moser wesentliche Bezugspunkte waren und eben jene abgründige Seite des Vergnügens betrachtet haben. Dazu gehört der Marquis de Sade, der seine minutiös geplanten Orgien auf Kosten jener inszenierte, deren Bedürfnisse dabei zugunsten des Vergnügens der Wenigen bewusst ignoriert wurden. Dieser Beitrag betont somit die Tatsache, dass man sich im Vergnügen stets entlang eines schmalen Grats bewegt, wobei der Absturz damit verbunden ist, dass der Andere gänzlich aus dem Blick gerät. Für Gerda war diese ethische Dimension des Themas immer besonders wichtig und schwierig und auch wenn sie die »dunklen« Seiten des Vergnügens nicht moralisch bewertet hat, war sie sich der Abgründe bewusst, die dort lauern.
Martin A. Hainz begibt sich auf die Spuren des...
| Erscheint lt. Verlag | 25.1.2024 |
|---|---|
| Reihe/Serie | ide - information für deutschdidaktik |
| ide - information für deutschdidaktik | |
| Verlagsort | Innsbruck |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Schulbuch / Wörterbuch ► Lektüren / Interpretationen ► Deutsch |
| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Literaturwissenschaft | |
| Schlagworte | Deutschdidaktik • Deutschunterricht • Diversifizierung im Unterricht • Diversität • Globale Entwicklung • Globalisierung • hegemoniale Denkart • Identität • Literaturunterricht • Medienbildung • Migration • Postkolonialismus • Sprachdidaktik |
| ISBN-10 | 3-7065-6310-X / 370656310X |
| ISBN-13 | 978-3-7065-6310-9 / 9783706563109 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 1,3 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich