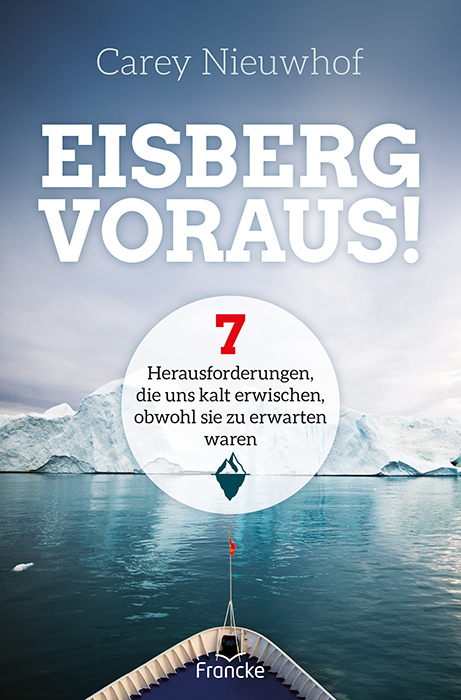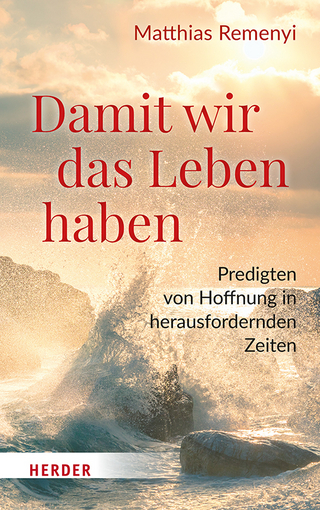Eisberg voraus!
Francke-Buch (Verlag)
978-3-96362-235-9 (ISBN)
Carey Nieuwhof ist verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und lebt nördlich von Toronto/Kanada. Der frühere Anwalt ist Pastor und Gründer der Connexus Kirche in Barrie, Ontario. Er beschäftigt sich nicht nur in seinen Büchern mit dem Thema Führungsrollen, sondern schreibt darüber auch in seinem Blog und spricht auf Konferenzen. Er produziert zudem einen Podcast, in dem er wöchentlich mit unterschiedlichsten Gästen über Themen rund um (kirchliche) Führungsthemen spricht.
1. Ein glücklicher Anwalt ist schwer zu finden Wie Pessimismus die Hoffnung auslöscht Sie hätten nie gedacht, dass Sie einmal als Pessimist enden würden, oder? Schließlich haben Sie nicht im Jahrbuch Ihres Abschlussjahrgangs neben Ihrem Foto den Eintrag hinterlassen: »Ich hoffe, dass ich spätestens mit vierzig Jahren das Leben satthabe und von der ganzen Menschheit enttäuscht bin. Ich hoffe auch, dass mein Pessimismus meiner Familie schadet und mich zu einem unausstehlichen Kollegen macht. Alles Gute!« Wenn Sie das geschrieben hätten, dann hätte sicherlich irgendjemand darauf bestanden, dass Sie eine Therapie machen, und zwar sofort. Aber das war natürlich nicht Ihr Text. Sie waren optimistisch, hoffnungsvoll. Und mit Anfang zwanzig, nachdem Sie das Joch Ihrer Eltern abgeschüttelt hatten, waren Sie idealistisch. Sie wussten, wie man die Welt zu einem besseren Ort macht, und waren ganz versessen darauf, es zu tun. Das ist auch meine Geschichte. Als junger Jurastudent, der mitten in Toronto arbeitete, versprühte ich Optimismus und wusste, wie man die Welt wieder in Ordnung bringt. Ich wollte mich auf Verfassungsrecht spezialisieren und noch vor meinem dreißigsten Geburtstag meinen ersten Fall vor dem Obersten Gerichtshof von Kanada verhandeln. Ich entdeckte, dass man mit einer positiven Einstellung und einer gesunden Arbeitsmoral sogar eine Kanzlei mitten in der Großstadt verändern kann. Ich war frisch verheiratet und wurde noch während meines ersten Berufsjahres Vater. Ich wollte gern erfolgreich sein und trotzdem nicht die vielen Stunden Sklavenarbeit leisten, für die junge Anwälte berüchtigt waren: jeden Abend im Büro verbringen und die meisten Wochenenden noch dazu. Es gab in der Stadt sogar Kanzleien, die Liegen bereitstellten und Köche engagierten, damit ihre Angestellten nicht nach Hause gehen oder das Büro verlassen mussten. So wollte ich aber nicht enden. Also strengte ich mich an. Ich war morgens um sieben im Büro, arbeitete ohne Mittagspause durch und schlich mich um fünf Uhr nachmittags wieder aus der Tür, wenn niemand mich sah, damit ich nach Hause zu meiner Frau Toni und unserem kleinen Sohn konnte. Den ganzen Tag über bemühte ich mich darum, äußerst produktiv zu sein und Erfolge zu erzielen, über die unsere Klienten (und meine Vorgesetzten) sich freuen konnten. Tatsächlich gelang mir das alles. Mit meinem Idealismus nahm ich rasch alle Hürden. Ich schaffte es nicht nur, die unmöglichen Arbeitszeiten zu vermeiden, die für Anwälte so typisch sind, ich verdiente sogar Geld für unsere Firma – was von einem Studenten nicht unbedingt erwartet wurde. Und so machten mir die Partner der Kanzlei nach meinem Praktikum ein Jobangebot. Allerdings stellte ich bald fest, dass mein Idealismus als aufstrebender Anwalt durch etwas beeinträchtigt wurde, das ich überall um mich herum bemerkte: Ich war von lauter Anwälten umgeben, die nicht glücklich waren. Ja, viele von denen, die noch nicht einmal vierzig waren, fühlten sich geradezu mise- rabel. Ich erinnere mich noch gut an einen Freitag, als ein Anwalt, der etwa Mitte dreißig war, in die Kanzlei kam und mit einem Lotterieschein herumwedelte. »Seht ihr das?«, rief er. »Wenn ich gewinne, dann seht ihr mich nie wieder.« Das Seltsame daran war, dass ihm die Kanzlei gehörte (und er jedes Jahr riesige Summen verdiente). Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn der Eigentümer einer gut gehenden Firma sich einen Lotterieschein kauft und auf den Jackpot hofft, um alles hinter sich lassen zu können. Ich sagte immer wieder zu meinen Mitabsolventen: »Wenn ihr in dieser Stadt einen glücklichen Anwalt finden könnt, dann gebe ich euch eine Million Dollar.« Ich wusste, dass ich diese Wette nie verlieren würde, denn keiner von uns konnte einen solchen Anwalt finden. Nagende Enttäuschung Wie kann es sein, dass Menschen, die scheinbar alles besitzen, so schnell desillusioniert sind und alles satthaben? Die Kombination von eleganten Bürotürmen, Luxuskarossen, maßgeschneiderten Anzügen und teuren Restaurantbesuchen, gepaart mit einer chronischen Unzufriedenheit, überrascht mich auch heute noch. Aber wieso eigentlich? Denn Jesus hat uns ja schon gesagt, es sei durchaus möglich, ja sogar sehr wahrscheinlich, dass wir die ganze Welt gewinnen und dabei unsere Seele verlieren. Das verstehe ich durchaus. Doch ich beobachtete bei den Menschen um mich herum in ihrem Kampf um den Erfolg viel mehr als nur ein Glücksdefizit. Ich nahm etwas viel Tieferes und Durchdringenderes wahr: Pessimismus. Oft fragte ich mich: Wie wird man innerhalb weniger Jahre vom Idealisten zum Pessimisten? Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sie so etwas in Ihrer Umgebung auch schon beobachtet haben: Ihre Freundin, deren Herz zu oft gebrochen wurde, ist jetzt der Überzeugung, dass man den Männern nicht über den Weg trauen kann. Ihr einst optimistischer WG-Mitbewohner, der inzwischen Investmentbanker ist, meint, alle seine Kollegen würden sich selbst bereichern, weshalb er es jetzt auch tut. Ihr Schwager, Polizist von Beruf, hat schon zu viel erlebt, um noch an das Gute im Menschen zu glauben. Selbst Ihre Teamkollegin in der Firma verwirft jede Idee, die Sie vorbringen, und führt sofort zahlreiche Gründe an, warum Ihre Strategie zum Scheitern verurteilt ist. Die Menschen, mit denen wir zusammen sind, können uns ganz schön deprimieren. Doch mindestens so erschreckend wie das, was wir um uns herum wahrnehmen, ist das, was wir in uns selbst spüren. Pessimismus ist nicht nur eine Erfahrung, die andere machen – er kann auch in uns wachsen. Je nachdem, was wir erlebt haben, variiert der Ablauf ein wenig, aber bei den meisten Menschen sieht es ungefähr so aus: Der Optimismus, den wir als Teenager oder mit Anfang zwanzig verspüren, weicht dem Realismus, wenn wir in den Dreißigern sind. Freunde, die bis über beide Ohren verliebt waren, haben sich bis dahin wieder getrennt; unsere einst enthusiastischen Arbeitskollegen hassen mittlerweile ihren Job; und viele unserer vermeintlich soliden Freundschaften haben sich in Luft aufgelöst. Wohin aber führt uns der Realismus, wenn wir in den Dreißigern sind? Das kommt ganz darauf an. Wenn wir ihn nicht in seine Schranken weisen, kann er uns in den Abgrund des Pessimismus stürzen. Treibsand voraus Ich weiß noch, wie es war, als ich das erste Mal dieses deprimierende Gefühl von Pessimismus in mir wachsen spürte. Ich war damals Anfang dreißig. Und seltsamerweise geschah es während meiner Tätigkeit als Pastor, dass diese zutiefst skeptische Haltung in meinem Herzen Wurzeln schlug – und nicht während ich als Rechtsanwalt arbeitete. Ich hatte mein Jurastudium zur Hälfte abgeschlossen, als ich den Eindruck bekam, dass Gottes Weg mich in den Dienst als Pastor führte. Ich war in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. In der Pubertät hatte ich mich eher vom Glauben abgewandt, aber mit Anfang zwanzig fand ich wieder zurück und übergab mein Leben neu Jesus Christus. Dennoch blieb die juristische Laufbahn weiterhin mein Ziel. Ich hätte mir zu dem Zeitpunkt nie träumen lassen, dass ich diese einmal aufgeben würde, um Prediger zu werden oder einen Dienst in einer Gemeinde zu übernehmen. Aber so ist es nun einmal, wenn man sich zu etwas berufen fühlt: Man wird in eine neue Richtung gelenkt und in ein unerwartetes Abenteuer geschickt. Als ich Gottes Berufung zum Pastor verspürte, brauchte ich noch ein paar Jahre, um herauszufinden, was das genau für mich bedeutete. In der Zwischenzeit beendete ich mein Jurastudium und absolvierte den gefürchteten Vorbereitungskurs für das Staatsexamen. Nachdem ich dieses bestanden hatte und als Rechtsanwalt zugelassen war, schockierte ich alle in meinem Familien- und Bekanntenkreis (auch mich selbst) damit, dass ich meiner Berufung folgte, alles hinter mir ließ und ein Theologiestudium aufnahm. Weil ich mir nicht sicher war, wie es weitergehen sollte, beschloss ich nach der Hälfte des Theologiestudiums, zum ersten Mal in den Gemeindedienst hineinzuschnuppern. Ich zog mit meiner Frau und unserem kleinen Sohn nach Oro-Medonte, einer kleinen Stadt, etwa eine Stunde nördlich von Toronto, und begann meinen Dienst genau dort, wo ich heute noch lebe. Meine Aufgabe bestand darin, mich um drei kleine Gemeinden zu kümmern, die in über vierzig Jahren weder einen hauptberuflichen Pastor angestellt hatten noch sonst in irgendeiner Weise gewachsen waren. Sie nannten mich ihren »Studentenpfarrer«. Das bedeutete nicht, dass ich Studierende unterrichtete, sondern dass ich in diesen Gemeinden als leitender Pastor arbeitete, während ich selbst noch studierte. Es bedeutete auch, dass ich nur die Hälfte von dem bekam, was man einem »richtigen« Pastor als Gehalt gezahlt hätte. Dennoch klang das Ganze in meinen Ohren nach einer Berufung. Die Gemeinden waren winzig. In der einen kamen sonntagmorgens durchschnittlich nur sechs Leute zum Gottesdienst. Als meine Frau, mein Sohn und ich dazustießen, wuchs die Gemeinde über Nacht um fünfzig Prozent. Das war einfach sensationell. In der zweiten Gemeinde kamen sonntags meistens etwa vierzehn Besucher. Und die »Megakirche« unter den dreien verzeichnete einen Gottesdienstbesuch von dreiundzwanzig. Wenn man in so kleinen Gemeinden Pastor ist, dann besteht der eigene Dienst überwiegend aus Beziehungsarbeit. Man besucht die Leute und bringt sich für sie ein, während man gleichzeitig versucht, ihnen eine größere Vision und eine bessere Strategie zu vermitteln, mit denen sie ihre Mission verwirklichen können. Selbst als Hunderte von Menschen zu unseren Gemeinden dazukamen, gab ich immer noch mein Bestes, um gute Beziehungen zu ihnen allen aufrechtzuerhalten. In den ersten zehn Jahren meines Dienstes ging ich jeden Tag in den Häusern ein und aus. Es war ungeheuer aufregend zu sehen, wie allmählich immer mehr neue Leute zur Gemeinde dazukamen. Ich erinnere mich noch gut, wie eines Sonntagmorgens ein Paar zur Tür hereinkam, das ich hier Roger und Mary nennen will. Es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass die beiden richtig große Probleme hatten. Sie besaßen nicht viel Geld. Ihr kleines Auto blieb ständig liegen. In praktisch allen Bereichen ihres Lebens schlitterten sie von einer Krise in die nächste. Obwohl ich mittlerweile gut ausgelastet war, weil ich Gemeinden mit Hunderten von Mitgliedern zu leiten hatte, beschloss ich, den beiden zu helfen, wo immer ich konnte. Zwar hatte unsere Gemeinde nur ein kleines Budget, aber wir schafften es trotzdem, Roger und Mary Lebensmittel und Gutscheine zukommen zu lassen. Wir gaben ihnen Geld für Benzin und sorgten dafür, dass ihr Auto fahrtüchtig blieb. Regelmäßig besuchte ich die beiden in ihrer Wohnung am Südende der Stadt (eine zwanzigminütige Fahrt hin und zurück), um mit ihnen zu beten, sie zu ermutigen und ihnen auf alle erdenkliche Weise zu helfen. Roger und Mary fanden immer neue Gründe, uns um Hilfe anzuflehen. Ihre Anrufe wurden häufiger und oft fuhr ich noch spätabends zu ihnen, um sie durch die nächste Krise zu begleiten. Mit allem Einsatz betete ich für ihre Familie und setzte mich auf vielfältige Weise für sie ein. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass ich in den ersten zehn Jahren meines Dienstes mit keiner Familie so viel Zeit verbrachte wie mit ihnen. Inzwischen waren die drei kleinen Gemeinden schnell gewachsen. Immer mehr Menschen waren dazugekommen und das bedeutete, dass es für mich schwieriger wurde, die einzelnen so oft zu besuchen wie früher. Es waren einfach zu viele. Doch selbst in dieser neuen Situation forderten Roger und Mary weiter meine Aufmerksamkeit. Sie waren arm und ich wusste, dass Gott sich besonders der Armen annimmt. Doch inmitten all dessen bemerkte ich bei dem Paar auch eine wachsende Undankbarkeit und immer neue Probleme. Ihnen zu helfen kam mir manchmal so vor, als würde ich versuchen, den Ozean mit einem Löffel zu leeren. Dennoch war ich entschlossen, ihnen weiter zu dienen und ihnen Gottes Gnade zu zeigen. Nach einiger Zeit brachten Roger und Mary ihre zweijährige Nichte regelmäßig mit zum Gottesdienst mit. Sie war ein tolles Kind, aber Disziplin war keine große Stärke dieser Familie. Eines Sonntags rannte die Kleine während des gesamten Gottesdienstes auf dem Mittelgang der Kirche hin und her und verärgerte damit viele Gemeindeglieder. Das Thema kam auf die Tagesordnung einer Gemeindevorstandssitzung. Einige Mitglieder des Gremiums bestanden darauf, dass gegen diese Störung des Gottesdienstes etwas unternommen werden musste. Ich jedoch setzte mich für Rogers und Marys Familie ein und sagte dem Vorstand, ich hätte lieber eine Kirche voller unartiger Kinder als eine Kirche voller gut erzogener Senioren. Glücklicherweise war das Thema damit erledigt und ich teilte Roger und Mary mit, es gäbe hier kein Problem mehr. Doch selbst nachdem diese Kontroverse gelöst war, schien das Paar sich in unserer wachsenden Gemeinde immer weniger wohlzufühlen. Eines Sonntags schließlich packte Roger seine Nichte bei der Hand, marschierte aus der Kirche und sagte so laut, dass alle es hören konnten: »Das hier ist nicht mehr unser Platz. Wir sind euch doch völlig egal! Wir gehen!« Verdutzt folgte ich ihm und fragte, was denn passiert sei. »Ihr macht einfach nicht genug für uns«, entgegnete er. Das verschlug mir die Sprache. Im Ernst? Wir tun nicht genug für euch? Das soll wohl ein Witz sein! Seine Worte trafen mein kleines, aber stets wachsendes Pastorenherz und schnitten eine tiefe Wunde hinein. »Roger«, brachte ich schließlich hervor, »das macht mich wirklich tieftraurig. Es ist bestimmt nicht übertrieben, wenn ich sage, dass ich in meinem bisherigen Dienst als Pastor mit niemandem persönlich so viel Zeit verbracht habe wie mit dir und deiner Familie. Und nicht nur ich. Unsere ganze Gemeinde hat viele Opfer gebracht, um euch immer und immer wieder zu helfen.« Doch meine Worte schienen nicht zu ihm durchzudringen. Er beharrte darauf, unsere Bemühungen würden nicht ausreichen und in Wirklichkeit seien er und seine Familie uns, damit meinte er mich, doch ganz egal. Er behauptete, unsere Gemeinde hätte ihn und seine Familie im Stich gelassen, als es ihnen am schlechtesten ging. Ich wusste nicht, was ich noch tun sollte, um die Situation zu retten. Roger und Mary wollten es offenbar nicht, sondern verließen unsere Gemeinde endgültig. Das Abrutschen in den Pessimismus beginnt Ich war schockiert. Und wütend. Und tief verletzt. Ich konnte das, was passiert war, einfach nicht einordnen. In diesem Augenblick spürte ich, wie eine Woge des Pessimismus in mir aufstieg. Es war, als ob eine innere Stimme sagte: Es ist zwecklos. Alles, was du investiert hast, war eine totale Verschwendung von Zeit und Kraft. Und weißt du was? Wenn der dir das angetan hat, dann werden andere es auch tun. Also setz dich nicht mehr so ein wie bisher. Investiere nicht mehr so viel in andere. Opfere dich nicht mehr so auf. Die Leute nutzen dich ja doch nur aus und am Ende stoßen sie dich weg. Es hat keinen Sinn. Damals hatte ich noch nicht begriffen, wie wichtig es war, Grenzen zu setzen. Außerdem war ich noch nicht so geschult darin, mögliche psychische Störungen bei Menschen zu erkennen. Ich versuchte aufrichtig zu helfen und am Ende hatte ich mir gründlich die Finger verbrannt. So fängt der Pessimismus an. Er macht sich nicht deshalb breit, weil uns alles egal ist, sondern weil wir uns so intensiv einsetzen. Pessimismus beginnt, weil wir unser Herz in etwas investiert haben und kaum etwas dabei herausgekommen ist. Oder vielleicht ist etwas herausgekommen, aber es war das Gegenteil von dem, was wir erwartet hatten. Wir haben uns verliebt, doch die Beziehung zerbricht. Wir haben uns mit aller Kraft in unserem Job engagiert, nur um am Ende zu erfahren, dass wir entlassen werden. Wir waren ganz und gar für unsere Mutter da, und nun wirft sie uns vor, wir seien für sie eine riesige Enttäuschung. Und dann fragen wir uns unwillkürlich: Was soll’s? Die meisten Pessimisten sind einmal optimistisch gewesen. Man sollte es nicht für möglich halten, aber es gab tatsächlich eine Zeit, in der sie hoffnungsvoll, enthusiastisch, ja sogar fröhlich gewesen sind. Etwas im Menschen möchte hoffen, möchte daran glauben, dass die Dinge besser werden. Fast jeder beginnt sein Leben mit einer positiven Perspektive. Aber was geschieht dann? Wie wird aus einem positiv eingestellten Menschen jemand, der alles so negativ sieht? Mindestens drei Dinge geschehen im Innern eines Menschen, bis er zum Pessimisten wird. 1. Wir wissen zu viel Man könnte meinen, dass Wissen etwas Gutes ist. Aber seltsamerweise bereitet es uns nicht selten Kummer. König Salomo, den wir später noch kennenlernen, war für seine Weisheit berühmt. Doch er sah das Ganze so: »Je größer die Weisheit, desto größer der Kummer; und wer sein Wissen vermehrt, der vermehrt auch seinen Schmerz.« Das klingt nicht gerade inspirierend. Der Vers mag nicht gerade für eine Glückwunschkarte zum Geburtstag geeignet sein, aber die Einsicht, die er vermittelt, ist durchaus hilfreich. Manchmal kann Nichtwissen nämlich geradezu ein Segen sein. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass Menschen wie Roger und Mary enttäuscht waren, nachdem sich eine ganze Gemeinschaft so intensiv für sie eingesetzt hatte, wäre es mir leichtgefallen – ja, es wäre fast automatisch geschehen –, dass ich mich weiterhin für andere engagiert hätte. Doch jetzt, wo ich sozusagen ein gebranntes Kind war, begann ich bedürftige Menschen misstrauischer zu betrachten. Würden sie auch so mit mir umspringen? Würden sie auch einfach weggehen? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass auch Sie schon mit Menschen wie Roger und Mary zu tun hatten. Vertrauen fällt schwerer, weil Sie zu viel wissen. Wenn andere Ihnen nicht schon ein Dutzend Mal das Herz gebrochen hätten, würde es Ihnen leichter fallen, eine neue Beziehung einzugehen. Wenn Ihr Geschäftspartner Sie nicht betrogen und die Firma ruiniert hätte, wären Sie möglicherweise immer noch Unternehmer. Wenn Ihre Nachbarn nicht so schwierig gewesen wären, hätten Sie vielleicht nie einen Zaun errichtet. Aber jetzt haben Sie all diese Erfahrungen schon gemacht. Sie haben Liebeskummer, Verrat und üble Nachrede erlebt. Sie wissen, wie es ist, wenn andere Sie im Stich lassen. Ihnen ist klar geworden, dass man manchen Leuten nicht trauen kann. Sie wissen, dass Liebe wehtun kann. Sie haben erkannt, dass andere untreu und egoistisch sind. Sie mussten feststellen, dass nicht jeder erfolgreich ist, selbst wenn er die besten Absichten hat und sich große Mühe gibt. Je länger Sie leben, desto mehr Erfahrung und Wissen sammeln Sie. Und deswegen ist Pessimismus mit zunehmendem Alter häufiger anzutreffen. Warum bringt König Salomo mehr Wissen mit mehr Kummer in Verbindung? Weil das Leben so ist. Ich möchte Sie ja nicht deprimieren, aber seien wir ehrlich: Das Leben ist nicht einfach; es ist ein Kampf voller Enttäuschungen und Rückschläge. Schauen Sie sich nur lange genug um und Sie werden überall Kummer entdecken. Sie sehen menschliche Schwächen und Fehler, Intrigen und Manipulation. Sie erkennen die Machtspielchen und egoistischen Schachzüge, die einen so großen Teil der menschlichen Existenz ausmachen. Das Buch Prediger ist der Leitfaden eines Pessimisten zum Verständnis der Welt. Mit dem Erfolg stellt sich eine zermürbende Leere ein. Und ein Leben mit fehlerhaften Menschen hinterlässt ein Gefühl der Verzweiflung und Zerbrochenheit in uns. Doch keine Sorge: Es gibt Hoffnung. Wir müssen an dieser Stelle nur noch ein wenig länger ausharren, um zu verstehen, warum so viele Pessimisten mit ihrem Leben so zu kämpfen haben. Wissen bringt Kummer. Wir sehen das Leben, wie es wirklich ist, und es ist … mangelhaft. 2. Wir projizieren Erfahrungen aus der Vergangenheit auf die Zukunft Der Pessimismus wächst über sein Anfangsstadium hinaus, wenn wir beginnen, uns vor künftigen Verletzungen zu schützen. Wenn wir uns ein- oder zweimal die Finger verbrannt haben, wollen wir nicht zu den Idioten gehören, die sich auch ein drittes Mal verbrennen. Also beginnen wir unser Herz zu schützen. Wir errichten einen Zaun um unsere Seele. Doch was als Selbstschutz begann, verwandelt sich bald in etwas viel Heimtückischeres. Wir haben allmählich alles satt. Wir bilden uns ein, ein bisschen klüger geworden zu sein, doch bei näherer Betrachtung sieht die Sache anders aus. Was wir errungen haben, ist nicht Klugheit, sondern vielmehr Furcht und Schmerz, die um unser Herz herum Schwielen bilden. Klug, wie wir sind, beginnen wir nach Mustern Ausschau zu halten. Und zu unserer Überraschung entdecken wir tatsächlich welche. Viele Menschen sind nicht vertrauenswürdig. Deshalb besteht die Lösung vielleicht nicht darin, die Firma zu wechseln, weil die Leute in der anderen Firma auch keinen glücklichen Eindruck machen. Und wir sehen, wie der Schmerz der Enttäuschung sich in vielen Ehen unserer Freunde ebenso breitmacht wie in unserer. Je älter wir werden und je mehr Erfahrungen wir sammeln, desto besser gelingt es uns, solche Muster auszumachen. Ganz allmählich tun wir das, was viele Pessimisten instinktiv tun: Wir projizieren das Scheitern in der Vergangenheit auf die Zukunft. Wir lernen ein neues Paar kennen und haben gleich den Verdacht, dass sie uns genauso ausnutzen werden wie Roger und Mary. Also kommt man ihnen sicherheitshalber nicht allzu nahe. Wir bekommen eine neue Chefin und gehen davon aus, dass sie vielleicht genauso unfair und arrogant ist wie unser früherer Chef. Jemand wird unserem Team zugewiesen und wir sind sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er alles vermasselt. Unsere Cousine heiratet und wir fragen uns, wie lange es wohl dauert, bis das frisch vermählte Paar ernsthafte Probleme hat. Wir sehen die Menschen nicht mehr so, wie sie sind. Und wir betrachten bestimmte Situationen auch nicht mehr so, wie sie sein könnten. Wir sehen nur noch die potenzielle Gefahr. Der Schmerz der Vergangenheit wird zum zukünftigen Schmerz, wenn wir es zulassen. Also lassen wir es erst gar nicht zu. Das war auch bei mir so. Denn es waren nicht nur Roger und Mary, die mir Kummer bereiteten. Es gab auch noch andere, darunter Freunde von uns. Tatsächlich wurde meine pessimistischste Phase (als ich Anfang dreißig war) durch eine Reihe von Ereignissen verursacht, die nur wenige Jahre auseinanderlagen. Roger und Mary waren nicht die Einzigen, die weggingen. Als wir ein paar radikale Neuerungen in unseren Gemeinden einführten, kehrten uns noch mehr Menschen den Rücken. Männer und Frauen, von denen ich gedacht hatte, dass sie ein Leben lang an Bord bleiben würden, wandten sich von uns ab. Obwohl unsere Gemeinden mehr neue Leute aufnahmen, als sie Mitglieder verloren, milderte das nicht die Enttäuschung, die ich empfand. Während der ersten Jahre unseres Dienstes platzte eine ganze Reihe enger Freundschaften. Es waren Freunde, mit denen man eigentlich sein Leben verbringt: Konzerte, gemeinsame Mahlzeiten, Ferien. Ich war zwar ihr Pastor und sie besuchten unsere Gemeinde, aber trotzdem pflegten wir eine intensive Freundschaft. Doch aus unerfindlichen Gründen kamen diese Freunde innerhalb eines Jahres nicht mehr in unsere Gemeinde und waren kurze Zeit später auch nicht mehr unsere Freunde. Das tat weh. Zutiefst. Und ich weiß auch heute noch nicht so genau, warum das alles zerbrach. Versuche, die Sache wieder ins Lot zu bringen, scheiterten. Ich weiß zwar, dass auch ich meinen Teil zu dieser schmerzhaften Situation beigetragen habe, aber es ist dennoch alles ein wenig rätselhaft und nebulös. Und diese Erfahrung führte dazu, dass ich (zumindest eine Zeit lang) den Weg des Pessimisten einschlug. Vielleicht ist Ihnen auch Ähnliches passiert. Irgendwann zehrt einen diese skeptische Einstellung aus. Vorsicht und Misstrauen verwandeln sich in Wut und Verbitterung. 3. Wir hören auf zu vertrauen, zu hoffen und zu glauben Nachdem diese Freundschaften zerbrochen waren, sagte ich zu Toni: »Ich brauche keine Freunde mehr. Wirklich. Sich auf Freundschaften einzulassen war keine gute Idee. Ich komme auch allein zurecht.« Hört sich dumm an, ich weiß. Doch aus diesen Worten sprach mein Schmerz. Und damals ergab das für mich durchaus einen Sinn. Ja, diese Strategie erschien mir sicherer als das Risiko, das eine neue Freundschaft mit sich bringen würde. Es ist ja meistens nicht der erste Kummer, der uns das Herz für immer bricht. Bei mir hatte es auch vorher schon ein paar Freundschaften gegeben, die im Lauf der Jahre eingeschlafen waren. Und so fragte ich mich irgendwann, ob es sich überhaupt lohnte, sich auf andere Menschen einzulassen. Manchmal überlegte ich sogar, ob ich irgendeinen fatalen Charakterfehler hatte, der alle Freundschaften zerstörte. Das Problem mit der Verallgemeinerung – der Übertragung einer Situation auf alle anderen Situationen – besteht in Folgendem: Der Tod des Vertrauens, der Hoffnung und des Glaubens ist wie ein Virus, das alles infiziert. Wir meinen uns vor der Zukunft zu schützen. Dabei wirkt sich unsere veränderte Haltung auch auf die Gegenwart aus. Die Menschen, die uns im Hier und Jetzt am wichtigsten sind, leiden darunter. Denn als Pessimist projizieren wir unser neues Misstrauen auf alles und jeden. Unsere gegenwärtigen Beziehungen kommen zum Stillstand oder machen Rückschritte. Unser Rückzug betrifft nicht nur die Zukunft, sondern auch die Gegenwart. Wir werden gleichgültig gegenüber den Menschen, die wir am meisten lieben, sogar gegenüber unserem Ehepartner und den Kindern. Wir sehen selbst in den Situationen, die uns früher mit Freude erfüllt haben, ein schlechtes Ende voraus. Unser Job erregt in uns Widerwillen. Wir haben keine Lust, den Neuen kennenzulernen, denn wir wissen ja schon im Voraus, wie er ist. Und die Projekte und Ziele, die uns bisher motiviert und begeistert haben, können das plötzlich nicht mehr. Noch viel mehr beunruhigen sollte uns jedoch, dass sich der Pessimismus auch auf unsere Beziehung zu Gott auswirkt. Wenn wir anderen Menschen gegenüber unser Herz verschließen, dann verschließen wir es auch vor Gott. Wir vertrauen weniger und zweifeln mehr. Wenn wir die Bibel lesen, würden wir fast alle Verheißungen dort am liebsten mit einer kritischen Anmerkung versehen und uns einreden, dass sie für uns nicht gelten. Selbst unser Gebet verkümmert. Denn was nützt es überhaupt? Wir haben das Gefühl, für Dinge zu beten, die sowieso nicht eintreffen werden, also wozu die ganze Mühe? Es ist eine Entwicklung, die uns immer mehr in die Enge treibt: Wir haben unsere Erfahrungen gemacht, übertragen die Vergangenheit in die Zukunft und ersticken schließlich Vertrauen, Hoffnung und Glaube. Wenn dieser Prozess einsetzt, dann haben wir die unverwechselbaren Zutaten für eine pessimistische Lebenseinstellung. Und ganz egal ob wir dreiundzwanzig oder dreiundsechzig sind: Es ist traurig – und unnötig –, wenn wir so unser Leben führen. Warum ist das überhaupt wichtig? Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es relativ wenige »ausgeglichene« Senioren gibt? Sie kennen das bestimmt: Wenn wir zwischen zwanzig und vierzig sind, dann haben wir gute und schlechte Tage. Es gibt Höhen und Tiefen, aber auf lange Sicht pendelt sich alles wieder ein. Allerdings scheint dieses Muster zu verschwinden, wenn Menschen ein bestimmtes Alter erreichen. Die meisten älteren Menschen, die ich kenne, sind auf der einen oder der anderen Seite der Mittellinie gelandet. Sie sind entweder glücklich und dankbar oder verbittert und unzufrieden. Es ist, als ob man ab einem gewissen Alter mit einem Magneten von der Mittellinie weggezogen wird und entweder auf der Seite des Glücks oder der Seite des Elends landet. Das Gefühl »Ich habe heute einen schlechten Tag«, das wir in jüngeren Jahren manchmal hatten, verwandelt sich für manche Menschen in ein »Ich habe ein schlechtes Leben«, wenn sie siebzig sind. Warum ist das so? Meine Theorie hierzu lautet: Mit zunehmendem Alter werden wir mehr so, wie wir bereits sind. So wie unser Körper etwas unbeweglicher wird, ist auch unsere Persönlichkeit dann weniger flexibel. Es ist, als würde in uns ein Krieg um die Hoffnung stattfinden – und entweder gewinnt der Pessimismus oder er verliert. Doch wir werden nicht nur ein bisschen pessimistisch oder ein bisschen hoffnungsvoll. Die Würfel sind gefallen, der Beton härtet aus. Als ich in den Vierzigern war, spürte ich diese Dynamik sehr stark. Es war, als würde ein Krieg um meine Seele toben. Allmählich begann ich zu verstehen, warum manche Menschen pessimistisch, lustlos und hartherzig werden. All das war auch in mir angelegt. Die Hoffnung war noch nicht gestorben, aber der Pessimismus drohte sie auszulöschen. Ich erkannte, dass es einfach war, die Verzweiflung siegen zu lassen. Ja, ich merkte sogar: Wenn ich nichts unternahm, würde der Pessimismus auf jeden Fall die Oberhand gewinnen. Aber wir haben immer noch die Wahl, ob wir pessimistisch werden oder nicht. Als Pessimist wird man nicht geboren, sondern dazu wird man gemacht. Doch nicht das Leben macht uns dazu, sondern wir selbst. Das ist allerdings nicht immer eine bewusste Entscheidung. Doch überlegen wir einmal, was hier auf dem Spiel steht. Pessimisten verändern niemals die Welt. Sie erzählen uns nur, warum die Welt sich nicht ändern kann. Darüber wissen sie alles. Und ich wusste, dass ich auch so enden würde, wenn ich meinen Kurs nicht änderte. Wenn Sie selbst schon pessimistische Züge an sich erkennen, dann ist dies nicht passiert, weil Ihr Herz verschlossen war, sondern weil es einmal offen war. Es ist passiert, weil der Idealist in Ihnen idealistisch war. Und dann kam das Leben. All die Verletzungen. Und jetzt stehen Sie vor der Entscheidung. Was werden Sie tun? Ein Pessimist wird natürlich sagen, dass man da gar nichts tun kann. Er meint, sein Zustand sei ganz normal, schließlich habe er sich im Leben schon viel zu oft die Finger verbrannt. Es ist nicht schwierig, all den Philosophen zuzustimmen, die zu dem Schluss kommen, das Leben sei »ein einsames, kümmerliches, rohes und kurz dauerndes« oder jenen oder die feststellen, die Hölle, das seien die anderen. Leider bleiben nur allzu viele bei dieser Aussage stehen. Dabei ist Pessimismus nichts Unvermeidliches. Und selbst wenn wir dazu tendieren, muss es ja nicht für immer so bleiben. Es gibt einen Weg zurück. Es ist ein Weg für Tapfere und für solche, die sich danach sehnen, wieder hoffen zu können. Es gibt ein Gegenmittel gegen den Pessimismus. Die Frage ist nur: Wollen Sie es anwenden?
1. Ein glücklicher Anwalt ist schwer zu findenWie Pessimismus die Hoffnung auslöschtSie hätten nie gedacht, dass Sie einmal als Pessimist enden würden, oder? Schließlich haben Sie nicht im Jahrbuch Ihres Abschlussjahrgangs neben Ihrem Foto den Eintrag hinterlassen: »Ich hoffe, dass ich spätestens mit vierzig Jahren das Leben satthabe und von der ganzen Menschheit enttäuscht bin. Ich hoffe auch, dass mein Pessimismus meiner Familie schadet und mich zu einem unausstehlichen Kollegen macht. Alles Gute!«Wenn Sie das geschrieben hätten, dann hätte sicherlich irgendjemand darauf bestanden, dass Sie eine Therapie machen, und zwar sofort. Aber das war natürlich nicht Ihr Text. Sie waren optimistisch, hoffnungsvoll. Und mit Anfang zwanzig, nachdem Sie das Joch Ihrer Eltern abgeschüttelt hatten, waren Sie idealistisch. Sie wussten, wie man die Welt zu einem besseren Ort macht, und waren ganz versessen darauf, es zu tun.Das ist auch meine Geschichte. Als junger Jurastudent, der mitten in Toronto arbeitete, versprühte ich Optimismus und wusste, wie man die Welt wieder in Ordnung bringt. Ich wollte mich auf Verfassungsrecht spezialisieren und noch vor meinem dreißigsten Geburtstag meinen ersten Fall vor dem Obersten Gerichtshof von Kanada verhandeln. Ich entdeckte, dass man mit einer positiven Einstellung und einer gesunden Arbeitsmoral sogar eine Kanzlei mitten in der Großstadt verändern kann. Ich war frisch verheiratet und wurde noch während meines ersten Berufsjahres Vater. Ich wollte gern erfolgreich sein und trotzdem nicht die vielen Stunden Sklavenarbeit leisten, für die junge Anwälte berüchtigt waren: jeden Abend im Büro verbringen und die meisten Wochenenden noch dazu. Es gab in der Stadt sogar Kanzleien, die Liegen bereitstellten und Köche engagierten, damit ihre Angestellten nicht nach Hause gehen oder das Büro verlassen mussten. So wollte ich aber nicht enden.Also strengte ich mich an. Ich war morgens um sieben im Büro, arbeitete ohne Mittagspause durch und schlich mich um fünf Uhr nachmittags wieder aus der Tür, wenn niemand mich sah, damit ich nach Hause zu meiner Frau Toni und unserem kleinen Sohn konnte. Den ganzen Tag über bemühte ich mich darum, äußerst produktiv zu sein und Erfolge zu erzielen, über die unsere Klienten (und meine Vorgesetzten) sich freuen konnten.Tatsächlich gelang mir das alles. Mit meinem Idealismus nahm ich rasch alle Hürden. Ich schaffte es nicht nur, die unmöglichen Arbeitszeiten zu vermeiden, die für Anwälte so typisch sind, ich verdiente sogar Geld für unsere Firma - was von einem Studenten nicht unbedingt erwartet wurde. Und so machten mir die Partner der Kanzlei nach meinem Praktikum ein Jobangebot.Allerdings stellte ich bald fest, dass mein Idealismus als aufstrebender Anwalt durch etwas beeinträchtigt wurde, das ich überall um mich herum bemerkte: Ich war von lauter Anwälten umgeben, die nicht glücklich waren. Ja, viele von denen, die noch nicht einmal vierzig waren, fühlten sich geradezu mise-rabel. Ich erinnere mich noch gut an einen Freitag, als ein Anwalt, der etwa Mitte dreißig war, in die Kanzlei kam und mit einem Lotterieschein herumwedelte. »Seht ihr das?«, rief er. »Wenn ich gewinne, dann seht ihr mich nie wieder.«Das Seltsame daran war, dass ihm die Kanzlei gehörte (und er jedes Jahr riesige Summen verdiente). Es ist nie ein gutes Zeichen, wenn der Eigentümer einer gut gehenden Firma sich einen Lotterieschein kauft und auf den Jackpot hofft, um alles hinter sich lassen zu können.Ich sagte immer wieder zu meinen Mitabsolventen: »Wenn ihr in dieser Stadt einen glücklichen Anwalt finden könnt, dann gebe ich euch eine Million Dollar.« Ich wusste, dass ich diese Wette nie verlieren würde, denn keiner von uns konnte einen solchen Anwalt finden.Nagende EnttäuschungWie kann es sein, dass Menschen, die scheinbar alles besitzen, so schnell desillusioniert sind und alles satthaben? Die Kombination von eleganten Bürotürmen, Luxuskarossen, maßgeschneiderten Anzügen und teuren Re
| Erscheinungsdatum | 01.06.2021 |
|---|---|
| Übersetzer | Anja Findeisen-MacKenzie |
| Sprache | deutsch |
| Original-Titel | Didn't see it coming |
| Maße | 135 x 205 mm |
| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Lebenshilfe / Lebensführung |
| Religion / Theologie ► Christentum ► Moraltheologie / Sozialethik | |
| Schlagworte | Burn-Out-Prophylaxe • Lebenskrise • Midlifecrisis • neue Hoffnung • Pessimismus • Resignation • Stressmanagement • Stressprävention • Überforderung • Zynismus |
| ISBN-10 | 3-96362-235-0 / 3963622350 |
| ISBN-13 | 978-3-96362-235-9 / 9783963622359 |
| Zustand | Neuware |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
aus dem Bereich