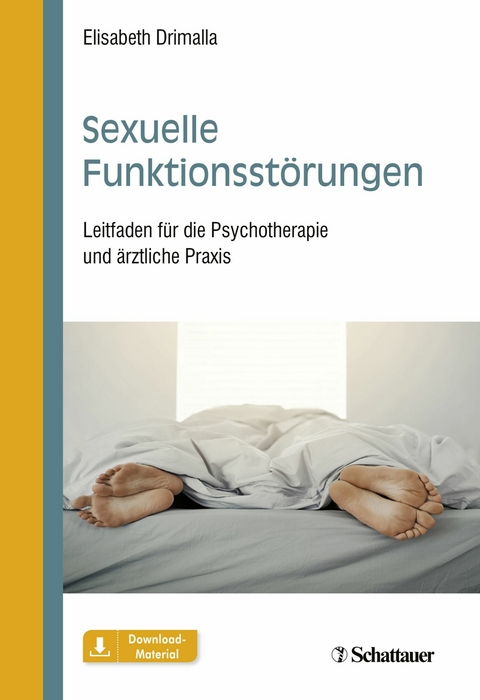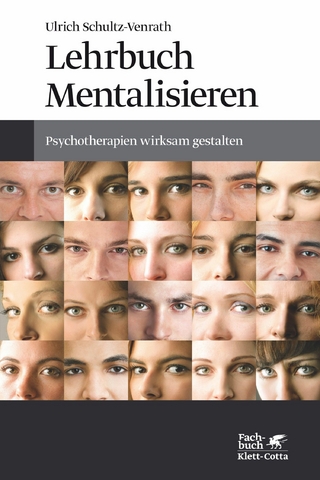Sexuelle Funktionsstörungen (eBook)
256 Seiten
Schattauer (Verlag)
978-3-608-12110-0 (ISBN)
Elisabeth Drimalla, Dr. med., arbeitet als Einzel- und Gruppenpsychotherapeutin sowie als Paar- und Sexualtherapeutin in eigener Praxis. Zudem lehrt sie als Dozentin und Supervisorin des IPAW (Institut für Psychotherapeutische Aus- und Weiterbildung) der Medizinischen Hochschule Hannover, des HIP-WI (Hannoversches Institut für Psychotherapie im Winnicott Institut) und des tiefenpsychologischen Ausbildungsinstituts der Universität Oldenburg. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und leitet den Qualitätszirkel Sexualmedizin der Ärztekammer Niedersachsen. Sie hat zahlreiche Vorträge und Workshops zu den Themen sexuelle Funktionsstörungen, Paardynamik und Sexualität im Alter gehalten und ist als Expertin im Rahmen von Patientengesundheitstagen und -foren aufgetreten.
Elisabeth Drimalla, Dr. med., arbeitet als Einzel- und Gruppenpsychotherapeutin sowie als Paar- und Sexualtherapeutin in eigener Praxis. Zudem lehrt sie als Dozentin und Supervisorin des IPAW (Institut für Psychotherapeutische Aus- und Weiterbildung) der Medizinischen Hochschule Hannover, des HIP-WI (Hannoversches Institut für Psychotherapie im Winnicott Institut) und des tiefenpsychologischen Ausbildungsinstituts der Universität Oldenburg. Sie ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und leitet den Qualitätszirkel Sexualmedizin der Ärztekammer Niedersachsen. Sie hat zahlreiche Vorträge und Workshops zu den Themen sexuelle Funktionsstörungen, Paardynamik und Sexualität im Alter gehalten und ist als Expertin im Rahmen von Patientengesundheitstagen und -foren aufgetreten.
Abb. 1-1 Biopsychosozialer Ansatz.
Die Sexualität und sexuelle Funktion eines Menschen werden von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren beeinflusst, die sich wiederum wechselseitig aufeinander auswirken (Abb. 1-1). Biologische Faktoren, wie beispielsweise altersbedingte physiologische Veränderungen oder somatische Erkrankungen, können die sexuelle Funktion beeinträchtigen. Das kann Versagensangst auslösen und/oder am Selbstwert kratzen, was wiederum zusätzlich zur beeinträchtigten sexuellen Funktion die Paarbeziehung beeinflusst und umgekehrt. Ebenso können soziale Ereignisse, zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch kulturelle Faktoren wie Darstellung und Umgang mit Sexualität in der Gesellschaft eine Rolle für die sexuelle Funktion des Einzelnen und des Paares spielen. Das gleiche gilt natürlich auch für psychische Faktoren. Je nach Lebensgeschichte und Erfahrungen, Persönlichkeit, Strukturniveau und Bindungssicherheit werden wir uns Lebenspartner suchen, mit denen wir die Paarbeziehung und die Sexualität leben, die uns beiden möglich ist, zusätzlich beeinflusst von unserer Lebenssituation und Gesundheit. Auch wie wir beispielsweise mit körperlicher Erkrankung oder Kündigung umgehen, wird von diesen psychischen Gegebenheiten und der Qualität der Paarbeziehung beeinflusst.
Sehen wir uns das Zusammenspiel dieser Faktoren an einem Beispiel an. Ist ein Mann an Diabetes mellitus erkrankt und er bemerkt ein Nachlassen der Erektionsfähigkeit, so kann es aufgrund von Gefäß- und/oder Nervenschäden zu der Erektionsstörung gekommen sein; diese kann aber auch dadurch verstärkt oder sogar ausgelöst sein, dass er ein Nachlassen und Versagen lediglich befürchtet. Die Art und Weise, wie er auf die sexuelle Symptomatik reagiert, hängt von seiner eigenen psychischen Konstitution und Struktur sowie dem Verhalten seiner Partnerin ab. Für seine psychische, aber auch körperliche Gesundheit wäre es eine schlechte Lösung, wenn er sich jetzt aus der Beziehung und Sexualität zurückziehen würde, ohne die Problematik anzusprechen und wenn auch seine Partnerin dies geschehen ließe und es sogar noch auf die eigene vermeintlich fehlende Attraktivität zurückführen würde. Hoffen wir für diesen Patienten, dass die behandelnden Ärzte ihn auch nach seiner Sexualität und seinem häuslichen Umfeld fragen und die biopsychosozialen Ursachen der Erektionsstörung abklären. Vielleicht beziehen sie sogar die Partnerin mit ein (mehr dazu auf Seite 30 ff., 140, 169 ff.) und suchen gemeinsam mit dem Paar nach Lösungsmöglichkeiten für den Umgang mit der belastenden Lebenssituation, so dass die Partner wieder körperlich und verbal ins Gespräch kommen. Das würde die Chancen des Patienten für mehr körperliches und psychisches Wohlbefinden verbessern.
Mittlerweile gibt es umfangreiche Daten, die zeigen, dass es einen starken Zusammenhang zwischen der Qualität der Paarbeziehung und der körperlichen und auch psychischen Gesundheit sowie der Lebenserwartung der Partner gibt (aktueller Überblick bei Frisch et al. 2017). In einer der größten jemals durchgeführten Metaanalysen (Roelf et al. 2011) mit Daten von mehr als 500 Millionen Menschen zeigte sich, dass Verheiratete gegenüber Alleinstehenden ein um 24 % niedrigeres Sterberisiko haben. Dabei spielt eine Rolle, dass die Partner eine gewisse soziale Kontrolle hinsichtlich des Gesundheitsverhaltens aufeinander ausüben und einander im Krankheitsfall beistehen. Es konnte auch ein Zusammenhang zwischen einer konflikthaften Belastung in der Paarbeziehung und negativer Auswirkung auf verschiedene Parameter des Immunsystems (Kiecolt-Glaser 1987, 1993, 2001, 2005 zit. nach Roesler 2018) oder auch einer Erhöhung des Risikos für Herzerkrankungen (Devogli et al. 2007, 2018) nachgewiesen werden. Sich zunehmend verschlechternde Partnerschaften haben Einfluss auf die Entwicklung von Bluthochdruck und Arteriosklerose. Es ist bemerkenswert, dass beide Erkrankungen auch Risikofaktoren für eine erektile Dysfunktion sind.
Ein weiteres sehr wichtiges Argument für die Einbeziehung des Partners sowohl bei psychischen als auch bei schweren oder chronischen körperlichen Erkrankungen ist die unmittelbare Auswirkung auf die Verbesserung der körperlichen Symptomatik und die Überlebenswahrscheinlichkeit. Es kommt zu einer Reduktion von depressiven Symptomen, bei Herzerkrankungen kann die Mortalität gesenkt werden. Bei Frauen mit Brustkrebs konnte nachgewiesen werden, dass ihre Überlebenschancen signifikant höher sind, wenn sie von ihrem Partner emotionale Unterstützung erfahren (Reynolds et al. 1994). Auch zwischen Verlauf und Rückfallrisiko einer depressiven Erkrankung konnten Zusammenhänge mit der Qualität der Partnerschaft gezeigt werden (Bodenmann 2013).
Interessanterweise wird das problematische Interaktionsmuster in Partnerschaften depressiver Patienten auch für männliche Patienten mit Orgasmushemmung beschrieben. Die Partner vermeiden nämlich, Ärger und Feindseligkeit zu kommunizieren (Fiedler et al. 1998, Reich 2003).
Aus verschiedenen Studien wissen wir, dass die überwiegende Mehrheit der Patienten einem Gespräch über Sexualprobleme mit ihrem Hausarzt positiv gegenübersteht. Aber nur bei ca. jedem vierten ihrer Patienten thematisieren die Ärzte Sexualität, u. a. aus der Sorge heraus, es könne den Patienten unangenehm sein. Für diese Befürchtung finden sich in Studien keinerlei Belege (Cedzich & Bosinski 2010).
Stellen wir uns vor, der diabetische Beispielpatient hatte nicht das Glück, auf kompetente, nachfragende Ärzte zu treffen. Er entwickelt eine reaktive depressive Symptomatik und wird von der Hausärztin zur Psychotherapeutin überwiesen. Wenn diese dann auch nur nach seinen depressiven Symptomen, nicht aber nach der Sexualität fragt, weil sie glaubt, der Patient wolle nicht darüber sprechen oder weil es ihr unangenehm ist, wird eine weitere Chance vertan.
50–90 % der depressiven Patienten leiden an Beeinträchtigungen der Sexualität. Weniger als 30 % der Patienten, die Antidepressiva einnehmen müssen, beenden die verordnete medikamentöse Therapie regulär – der wichtigste Grund für die Therapieabbrüche sind die sexuellen Nebenwirkungen. Bei den medikamentös unbehandelten depressiven Patienten leidet aber auch ein Drittel an Libidoverlust, verzögerter Ejakulation, Anorgasmie und Erektionsstörungen (Hartmann 2007). Auch bei Angststörungen besteht eine Komorbidität mit sexuellen Funktionsstörungen bei Frauen besonders mit Erregungsstörungen und genito-pelviner Schmerzstörung, aber auch mit Orgasmusproblemen und Luststörungen. Basson & Gilks nehmen an, dass die Aktivierung des sympathischen Nervensystems bei sexueller Erregung durch die entsprechenden körperlichen Reaktionen, wie sie auch bei Angst auftreten (schnellere, flachere Atmung, Muskelanspannung), bei diesen Patientinnen als bedrohlich interpretiert werden und sie den Kontrollverlust fürchten (Basson & Gilks 2018). Auch bei 60–80 % der Patientinnen mit Psychosen bestehen aus unterschiedlichsten Ursachen sexuelle Dysfunktionen (Basson & Gilks 2018).
Deshalb ist es sowohl in der somatischen Therapie als auch in der Psychotherapie so unerlässlich, nach der Sexualität zu fragen, die biopsychosozialen Faktoren und ihr Zusammenspiel zu eruieren, diagnostisch abzuklären und bei dem therapeutischen Vorgehen zu berücksichtigen.
Im Diagnostischen und Statistischen Manual Psychischer Störungen, dem DSM-5 (American Psychiatric Association 5. Auflage 2013; dt. Ausgabe 2015), wird das Zusammenwirken der biopsychosozialen Faktoren ebenfalls aufgeführt. Bei allen sexuellen Funktionsstörungen sollen die fünf folgenden Faktoren berücksichtigt werden, die für die Entstehung, das individuelle Störungsbild und/oder die Behandlung relevant sein könnten:
-
Partnerfaktoren (z. B. sexuelle Probleme des Partners, Gesundheitszustand des Partners)
-
Beziehungsfaktoren (z. B. schlechte Kommunikation, Diskrepanzen im Verlangen nach ...
| Erscheint lt. Verlag | 13.3.2021 |
|---|---|
| Verlagsort | Stuttgart |
| Sprache | deutsch |
| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Psychologie ► Allgemeine Psychologie |
| Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Psychiatrie / Psychotherapie | |
| Schlagworte | Allgemeinmedizin • Angststörung und Sexualität • Appetenzstörung • Bindung und Sexualität • biopsychosoziale Ursachen • Depression und Sexualität • Ejaculatio praecox • Erektionsstörung • Erregungsstörung • Fallstricke Paartherapie • Fallstricke Sexualtherapie • Gynäkologie • interpersoneller Konflikt und Paarbeziehung • intrapsychischer Konflikt und Sexualität • Kollusionsmodell • Luststörung • Medikamente und Sexualität • Orgasmusstörung • Paartherapie • PLISSIT-Modell • Psychiatrie • Psychodynamik Sexualtherapie • Psycho-Sexualtherapie • Schmerzen beim Sex • Sexualmythen • sexualtherapeutisches Wissen • Sexualtherapie • sexuelle Funktionsstörungen biopsychosozial • sexuelle Symptome • sexuelle Symptome Psychotherapie • Stress und Sex • Strukturniveau Sexualität • Therapiezielklärung Sexualtherapie • Übungen Sexualtherapie • Urologie • Vaginismus • verzögerte Ejakulation |
| ISBN-10 | 3-608-12110-2 / 3608121102 |
| ISBN-13 | 978-3-608-12110-0 / 9783608121100 |
| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 3,8 MB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich